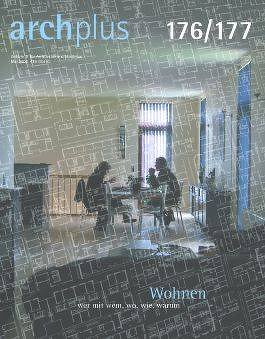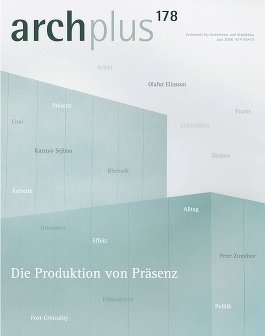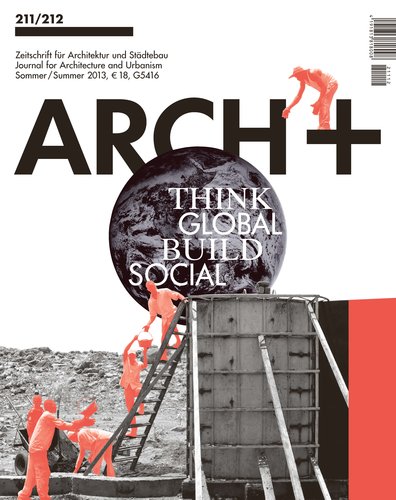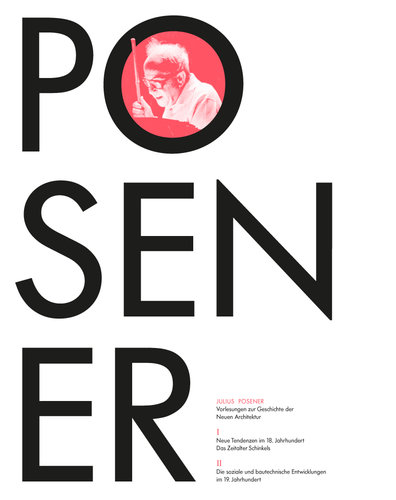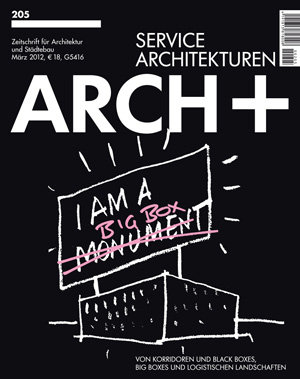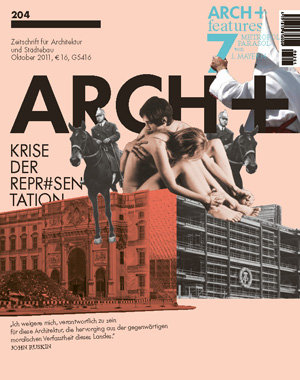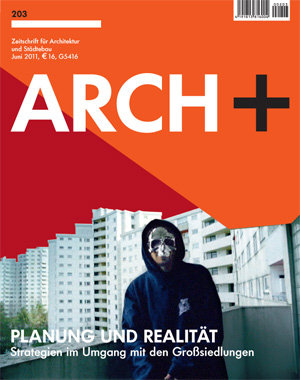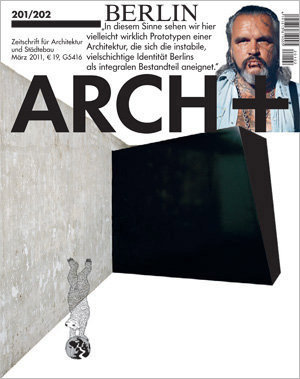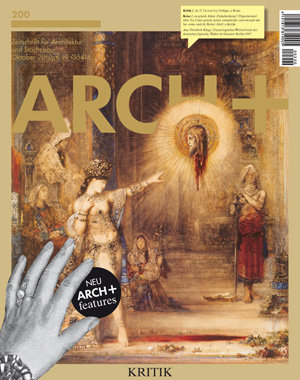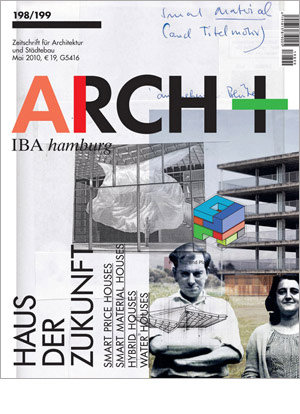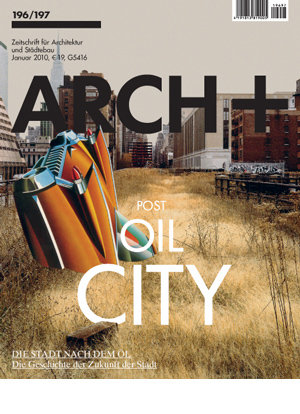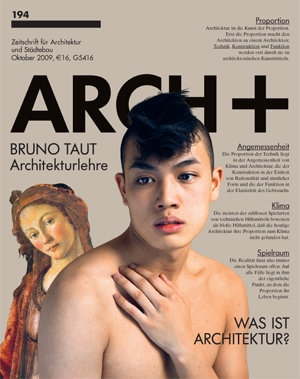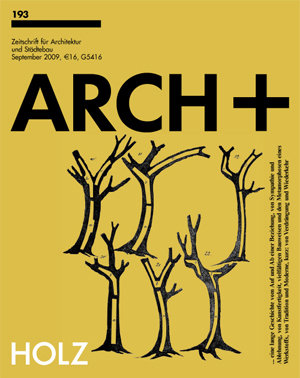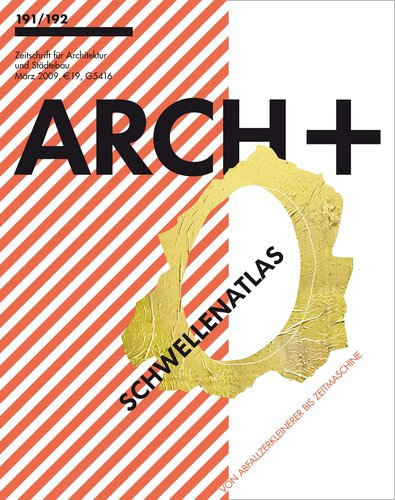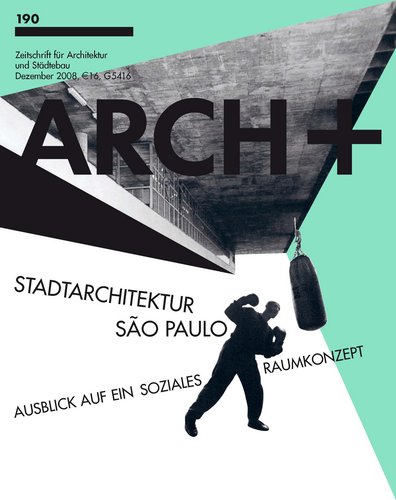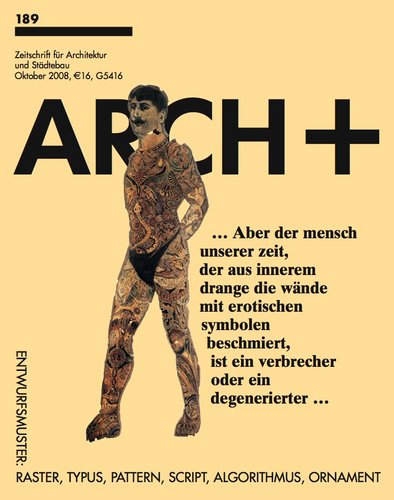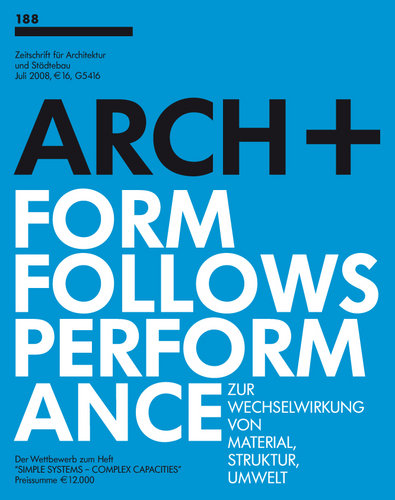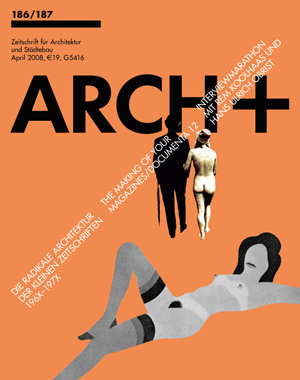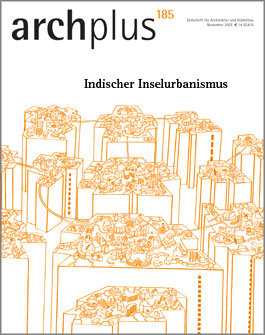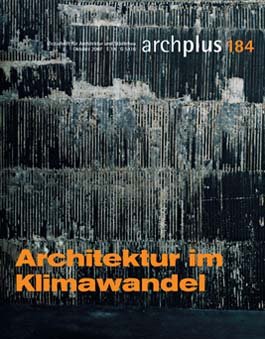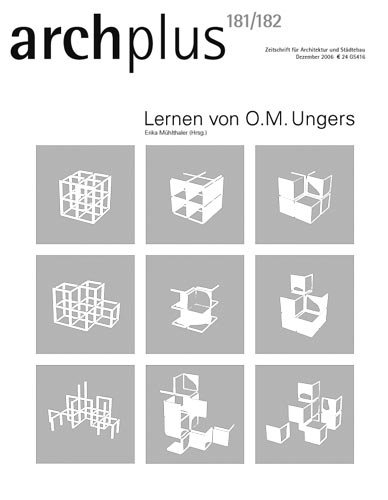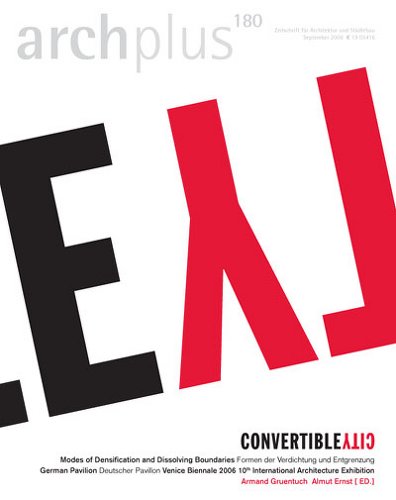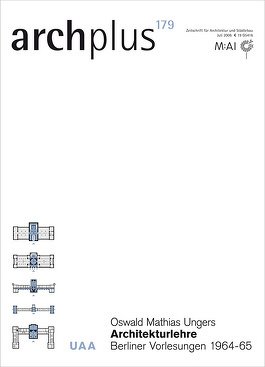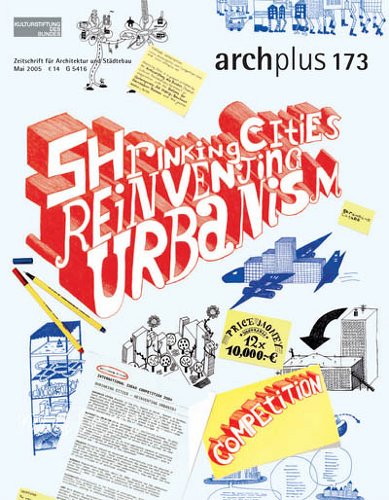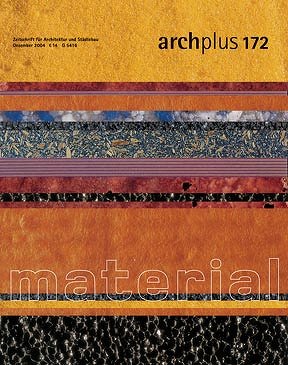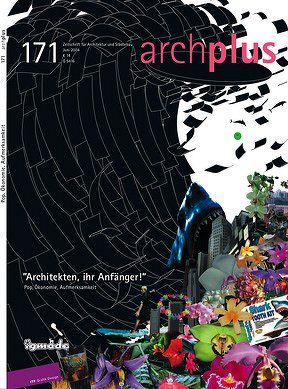Digitale Schreinerei
Der Holzbau bietet aufgrund der im Vergleich zu anderen Baustoffen leichten spanenden Bearbeitbarkeit von Holz und Holzwerkstoffen ein weites Experimentierfeld...
Der Holzbau bietet aufgrund der im Vergleich zu anderen Baustoffen leichten spanenden Bearbeitbarkeit von Holz und Holzwerkstoffen ein weites Experimentierfeld...
Der Holzbau bietet aufgrund der im Vergleich zu anderen Baustoffen leichten spanenden Bearbeitbarkeit von Holz und Holzwerkstoffen ein weites Experimentierfeld für digitale Entwurfs- und Fertigungstechniken: In keinem anderen Baumaterial ist es so einfach, individuelle Bauteile herzustellen. Dementsprechend sind in den letzten fünf Jahren eine ganze Reihe ungewöhnlicher Experimente im Maßstab 1:1 realisiert worden, die den traditionellen Werkstoff Holz in einen neuen Kontext stellen. Ungewöhnlich insofern, als diese Experimente weder unter die Kategorie der klassischen Stabkonstruktionen subsumiert werden können, noch direkte Verwandtschaft mit den neueren kartenhausartigen Plattenkonstruktionen aufweisen. Bei aller Unterschiedlichkeit verbindet die Projekte ein gemeinsames Vielfaches, das in der Suche nach einer neuen Form der Plastizität zu liegen scheint; man könnte es als ein räumliches Modellieren in Holz bezeichnen, das traditionell unter allen Formen der Holzbearbeitung nur das Schnitzen auszeichnete.
Es stellt sich die Frage, inwieweit diese Experimente der Inkubator für eine anders geartete holzspezifische Formensprache und neue Tragwerkskonzepte im Holzbau sind, oder ob sich der Neuheitswert in der Umsetzung mit erstaunlich weit vorangetriebenen computergestützten Planungs- und Fertigungsmethoden erschöpft. Zweifel sind zumindest angebracht. Sie können anhand zweier Kriterien, wenn auch sicher nicht abschließend geklärt, so doch in der Diskussion zumindest erhärtet bzw. abgeschwächt werden. Diese Kriterien liegen zum einen in der Methode der Formfindung und zum anderen in der Nutzung der Materialeigenschaften bzw. der erforderlichen Zahl von Arbeitsschritten der Fertigung bezogen auf das Rohmaterial Holz. Die auf den folgenden Seiten aufgeführte Reihe aktueller Projekte ist in vier Gruppen geordnet:
A Eierschneider, einfach
Als „einfache Eierschneiderstrukturen“ können die Ringve Viewing Platform (1), das Semper Depot (2) und in gewisser Weise auch die Wandprototypen (3) bezeichnet werden. Mit der Methode des Zerschneidens in parallele Ebenen, wie es das Haushaltsgerät zur präzisen Herstellung gleich dicker Scheiben hartgekochter Eiern leistet, lassen sich mit einem einzigen Schnitt auf recht einfache Weise beliebig modellierte Volumen in Scheiben zerlegen.
Die im Schneidevorgang entstehenden Teile sind alle gleich breit.
Dadurch ist es einerseits einfach, sie mit einem durchgängigen Konstruktionsprinzip zu verbinden. Andererseits wird die Suche nach einem geeigneten Rohmaterial, aus dem die Einzelteile gefertigt werden können, erheblich erleichtert. Beim Semper Depot (2) sind dies Holzwerkstoffplatten gleicher Materialstärke, aus denen wie bei einem Ausschneidebogen die Einzelteile herausgetrennt werden; bei der Ringve Viewing Platform (1) und den Wandprototypen (3) können die Volumina sogar aus identischen Stabprofilen gefügt werden. Die im Entwurfsprozess vorausgegangene Formbestimmung wird durch die unterschiedliche Ablängung der Stäbe realisiert; durch die Verschränkung der individuellen Einzelelemente in unterschiedlichen Winkeln bzw. ihre schrittweise Positionsänderungen von Schnittebene zu Schnittebene lassen sich plastische Formen als dynamische Bewegung darstellen.
Eierschneiderarchitekturen sind nicht zufällig reine Außenrauminstallationen oder Innenausbauten, da das System in sich rigide ist und sich nur schwer eine Verbindung dieser Strukturen mit der Vielzahl der Anforderungen vorstellen lässt, die an ein Gebäude gestellt werden. Da die parallelen Ebenen linear aneinander gereiht sind, ist eine Ecklösung innerhalb des gleichen Konstruktionsprinzips ausgeschlossen.
B Eierschneider, zweifach
Ecklösungen gelingen durch das Hinzufügen eines zweiten Schnitts mit dem Eierschneider. Dieser wird entweder rechtwinklig zur ersten Schnittebene geführt, so dass wie bei Camera Obscura (4), Metropol Parasol (6) und Serpentine Gallery (7) aus der Schnittrichtung ein Quadratraster entsteht; oder aber in einem anderen Winkel ein Rautenmuster erzeugt wird wie bei Burst (5) und dem Austria Center (8). Der zweite Schnitt bringt einen konstruktiven Vorteil mit sich, da die dabei entstehenden Teile als Abstandshalter für die im ersten Schnitt erzeugten Teile eingesetzt werden können; dies erlaubt es, die Mehrfach-Eierschneiderstrukturen wesentlich luftiger zu gestalten als die massiven Einfach-Eierschneider. Gleichzeitig aber zeigt sich bei den Mehrfach-Eierschneidern eine stärkere Tendenz, die Faserrichtung des Holzes außer Acht zu lassen und plattenförmige Holzwerkstoffe als Ausschneidebögen für die Einzelteilfertigung einzusetzen. Dies ist besonders augenfällig bei Projekten wie Metropol Parasol (6), bei denen die Formgebung in keinerlei Beziehung zur Konstruktion zu stehen scheint. Befremdlich wirken dann auch die pilzförmigen Stützen der Parasols, die das Quadratraster enorm verzerren, da sie parallel zur Schneiderichtung stehen und die nur dreiachsig bearbeiteten Einzelelemente in der Verschneidung der Bauteile mit der gekrümmten Oberfläche des modellierten Volumens offenkundig nicht zusammenpassen. Die Serpentine Gallery (7) umgeht diese Problematik, indem sie die fünf Raumbegrenzungsflächen getrennt voneinander mit jeweils zwei Eierschneiderschnitten bearbeitet.
Einzig der Camera Obscura (4) gelingt es, ein plastisches Volumen aus Vollholzstäben zu erzeugen, indem der als Ausgangsform dienende Würfel nach zweimaligem Zerschneiden um seine Mittelachse verdreht wird. Die Bauteile des Austria Centers (8) hingegen sind so groß, dass sie ohne den Umweg über die Holzwerkstoffplatte projektspezifisch als gekrümmt verleimtes Brettschichtholz wie klassische Leimbinder gefertigt wurden und somit die Faserrichtung dem modellierten Volumen folgen kann. Der rautenförmige Verschnitt der Binder ist allerdings konstruktiv nicht erforderlich.
C Faltstrukturen
Während die Eierschneider-Strukturen mehr oder weniger deutlich nicht konstruktiv motiviert sind, versuchen Faltstrukturen wie der Origami Bogen (9) und die Kapelle St. Loup (10) der Brettsperrholzplatte ein Potenzial für Tragwerke abzugewinnen. Insofern besteht eine gewisse Affinität zu den neueren Plattenkonstruktionen. Durch das Auffalten von Flächen in einzelne Brettsperrholzelemente sollen diese gezielt mehr durch Normalkräfte in der jeweiligen Ebene als durch Momente beansprucht werden. Das Auffaltungsprinzip ist allerdings eher von der Umsetzung japanischer Papierfalttechnik mit den Möglichkeiten des Brettsperrholzes als der digitalen Fertigungstechnik geleitet; dies zeigt sich an der manuell gefertigten Konstruktion des Bogens (9) wie auch an der durch intuitives Papierfalten entwickelten Form der Kapelle (10).
D Strukturen mit Kassettenelementen
Größte gestalterische Freiheit ermöglichen Konstruktionen aus individuellen Kassettenrahmen, da ihre jeweilige Geometrie lediglich von den benachbarten Kassetten abhängt. Ein Nachteil solcher Strukturen liegt im Materialaufwand, den die statisch nicht erforderliche Verdopplung der Wandungen mit sich bringt. Wie unterschiedlich der Umgang mit diesem Prinzip sein kann, illustrieren der Swissbau Pavillon (11) und das Betriebsrestaurant Dietzingen (12). Während der Swissbau Pavillon auf einer Kugeloberfläche ein Zellwachstum um gegebene quadratische Öffnungen herum simuliert, dient bei Dietzingen die Kassettenstruktur lediglich dazu, die Flächen zwischen den Primärträgern dekorativ zu unterteilen. Der Swissbau Pavillon ist die einzige Struktur unter den vorgestellten Projekten, die mit einer rechnergestützten Wachstumssimulation aus den Relationen der Einzelelemente ermittelt wurde. Der Beweis, dass ein Bottom-up-Verfahren nicht nur als Forschungsselbstzweck an Europas größter CAD-Professur, sondern auch in einem funktionalen Bauprojekt mit Dutzenden von Gewerken umgesetzt werden kann, steht noch aus.
E Flechtstrukturen
Die beiden Projekte mit den mit Abstand größten Abmessungen und Spannweiten sind das Yeoju Golf Resort (13) und das Centre Pompidou Metz (14). Man kann die beiden nur graduell unterschiedlichen Projekte als eine Weiterentwicklung der Eierschneidermethode betrachten: In beiden Fällen wird eine doppelt gekrümmte Oberfläche von einem hexagonalen Raster (also drei Schnittrichtungen) durchstoßen. Im Gegensatz zu den ein- und zweifachen Eierschneidern wird aus dieser geometrischen Operation nicht das Volumen der Einzelteile, sondern nur deren Mittelachsen errechnet. Die tatsächlichen Volumina der Träger werden dann entlang dieser Mittelachsen in parallelen Trägerlagen jeweils rechtwinklig zur Dachfläche „extrudiert“. Auf diese Weise ist es möglich, sich verwindende, aber in ihren Abmessungen konstante rechtwinklige Querschnitte zu erhalten.
Wie auch beim Origami handelt es sich um metaphorische Entwürfe, welche die Prinzipien anderer Materialien in Holz übertragen: Zur Herleitung der Struktur des Centre Pompidou Metz (14) diente dem Architekten ein geflochtener chinesischer Strohhut. Wenn auch das Flechten der elastischen Halme maßstabsbedingt wirklich nichts mehr mit dem Verleimen und Fügen von starren Brettschichtholzträgern zu tun haben kann, so veranschaulicht die Flechtmetapher doch das mehrlagige „Extrudieren“ der Volumina entlang der Mittelachsen.
Vergleicht man das Centre Pompidou (14) mit der mehrfach gekrümmten Fläche der 35 Jahre älteren Gitterschale der Multihalle Mannheim, stellt man irritiert fest: Beim Centre Pompidou überspannen sechs Brettschichtholzlagen von je 14 x 44 cm bis zu 50 m. Bei der Multihalle überspannen vier Schnittholzlagen von 5 x 5 cm bis zu 60 m. Ob dies damit zu tun hat, dass bei der Formfindung der Multihalle kein chinesischer Strohhut, sondern ein Hängemodell Pate stand?
Was Yeoju (13) und Centre Pompidou (14) deutlich machen, ist das große Potenzial der technischen Umsetzung im Zusammenspiel von Holzbauer, Statiker und Geometrieberater. In der engen Zusammenarbeit war es nicht nur möglich, tausende unterschiedlich gekrümmter Bauteile zu fräsen, sondern durch Formverleimung der Brettschichtholzrohlinge deren Faserwinkel maximal 5° von der Bauteil-Mittelachse abweichen zu lassen. Wobei nicht verschwiegen bleiben sollte, dass von diesen individuell verleimten Rohlingen im nächsten Arbeitsgang noch fast 50 % zerspant werden müssen, bis die endgültige Bauteilgeometrie vorliegt.
Resümee:
1. Die initiale Formgebung der beispielhaft gezeigten Projekte ist weder von den Bedingungen des Werkstoffs noch von funktionalen Anforderungen bestimmt. Ers-teres würde einen konstruktiv geleiteten Entwurf bedeuten, zweiteres im Falle von Gebäuden eine Entwicklung des Entwurfs von innen heraus. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind überdimensionale Holzplastiken, deren äußere Gestalt durch ein willkürlich gesetztes Volumen beschrieben wird; willkürlich meint hier einen formgebenden Akt, dessen Parameter nicht herleitbar sind, man könnte auch von sogenannter künstlerischer bzw. freier Gestaltung sprechen.
2. Die Objekte werden im 3D-CAD als geometrisch definierte Volumina ohne Schwerkraft und ohne den Einfluss von Umgebungsbedingungen modelliert. Die anschließende digitale Bearbeitung umfasst die Geometriebestimmung der Einzelelemente sowie deren Fertigungsplanung mitsamt den Stücklisten. Die eigentlichen Chancen eines digitalen Formfindungsprozesses, die nicht zuletzt darin liegen könnten, die Form im Wechselspiel mit den auf sie einwirkenden Kräften auszubalancieren, bleiben ungenutzt. Zu Konstruktionen mit Materialeigenschaften werden die Objekte erst in den anschließenden Berechnungen und Fertigungsplanungen der Ingenieure und Holzbaufirmen.
3. Obwohl die Objekte in ihrer spezifischen Form derzeit am besten in Holz ausgeführt werden können, sind es keine Holzkonstruktionen im klassischen Sinne. Das Zerschneiden modellierter Volumina impliziert genau genommen einen homogenen Werkstoffblock; für ein Material, dessen Eigenschaften richtungsabhängig variieren, ist es eine ungeeignete Methodik. Die Herstellung gekrümmter Formen mittels Fräsen erinnert stark an das eingangs erwähnte Schnitzen.
4. Plattenförmige Holzwerkstoffe als Ausgangsmaterial für den Zuschnitt individueller Bauteile sind in ihren Abmessungen, Materialzusammensetzungen und Eigenschaften genormte Halbzeuge. Gerade beim individuell wachsenden Rohstoff Holz ist zu fragen, ob ein solcher Umweg über die Halbzeug-Standardisierung eine Unikatfertigung, wie sie die gezeigten Objekte erfordern, nicht letztlich ad absurdum führt. Zumindest wird, wenn man vom Rohstoff ausgeht, die Kette der notwendigen Fertigungsschritte immer länger.
5. „Anything goes“: Es scheint, als könne man praktisch alles bauen – und als müsse man diese technologische Potenz, auch komplizierteste Formen erzeugen und umsetzen zu können, zur Schau stellen. Man macht es, weil man es kann. Einer anderen Begründung bedarf es nicht. Die amerikanische Historikerin Rosalind Williams schreibt dazu: „Instead of being a figure in the ground of history, technology has become the ground – not an element of historical change, but the thing itself.“
6. Die neu geschaffenen technologischen Möglichkeiten äußern sich – zumindest vorerst – in einem Überborden des Dekorums, was einhergeht mit einem freiwilligen Kompetenzverzicht des Architekten. Seine Rolle scheint sich – um es provokativ zu sagen – auf das Auswählen einer geeigneten Metapher oder einer dekorativen Geste, d.h. auf die Schaffung formaler Komplikationen zu fokussieren, die Beschränkungen in der Umsetzung weitgehend ausblendet. Beschränkungen aber sind nach Frank Lloyd Wright (1953) ein Nährboden der Architektur: „Aber wenn wir auf diese ungeheuren, homogenen menschlichen Berichte zurückblicken, kommen wir nicht umhin festzustellen, dass der Mensch immer dann am edelsten baute, wenn die Beschränkungen am größten waren und wenn von der Phantasie am meisten gefordert wurde. Beschränkungen scheinen stets die besten Freunde der Architektur gewesen zu sein.“
ARCH+, Di., 2009.09.29
verknüpfte Zeitschriften
ARCH+ 193 Holz