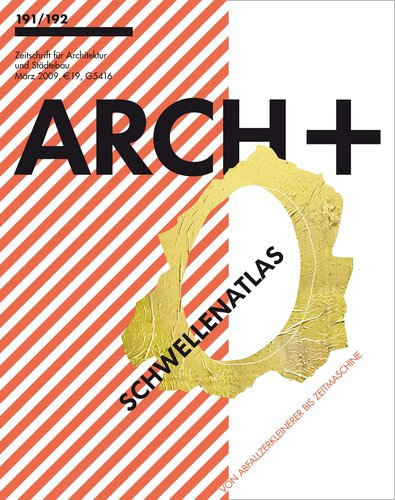Editorial
Der vorliegende „Schwellenatlas“ liefert – nach zahlreichen bautechnischen Kompendien wie dem Fassaden-, Dach- oder Holzbauatlas – endlich das umfassende Handbuch zur gebrauchsorientierten, kulturell und geschichtlich reflektierten Gestaltung von baulichen Ein-, Aus-, Durch- und Übergängen. Wann wird bei Entwurfsentscheidungen schon je in Betracht gezogen, wie ein automatischer Türschließer seine Nutzer diszipliniert, wie biometrische Zugangskontrolle den Körper fragmentiert oder was Spiegelglas über den Spätkapitalismus aussagt? Dabei verrät eine Auseinandersetzung mit den Hintergründen konkreter architektonischer Bauteile und technischer Gegenstände einiges über die Konventionen und Bedingungen gegenwärtigen Bauens.
Ausgangspunkt dieser Ausgabe ist eine Reihe von Forschungsseminaren über Mikroarchitekturen des Öffnens und Schließens, die an der Assistenzprofessur für Architekturtheorie am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) der ETH Zürich stattfanden. Mit einem interdisziplinären Ansatz, der aktuelle Untersuchungen zur anonymen Architektur mit Fragestellungen der Technik- und Kulturgeschichte verbindet, richteten die Seminare einen differenzierten Blick auf die Objekte der gebauten Umwelt und ihre Entstehungsgeschichte. Im vorliegenden Heft wird diese Forschung weiterentwickelt und zugespitzt: Ausgehend von spezifischen Bauteilen und technischen Apparaturen der Schwelle addressieren die Autorinnen und Autoren unterschiedliche Diskursfelder des Übergangs, die das Verhältnis zwischen Innen und Außen gedanklich fassen und gleichzeitig die architektonische Praxis mitbestimmen. Das Heft widmet sich der Frage, welchem Wandel die Konstruktion und Bedeutung baulicher Schwellen unterliegen und wie sich Raumauffassungen damit verändern.
Die Beiträge in diesem Heft sind alphabetisch geordnet. Ein Glossar erzählt Episoden der Technik- und Kulturgeschichte von 45 Schwellenelementen, die auf ihre Relevanz für die aktuelle architektonische und räumliche Praxis befragt werden. Für zehn Elemente trugen Autoren aus verschiedenen Disziplinen einen längeren Essay bei: automatischer Türschließer, Drehtür, Fahrstuhl, Fenster, Jalousie, Körper-Scanner, Müllschlucker, Spiegelglas, Strichcode und Telefon. Sie reflektieren die Zusammenhänge zwischen Architektur, Technik, sozialen und kulturellen Bedingungen und fragen damit nach dem Stellenwert von Diskursen über Privatheit, Hygiene oder Sicherheit für die Architektur. Interviews zeigen auf, wie unterschiedlich die Schwelle in den Kulturwissenschaften und in der architektonischen Praxis gedacht wird. Die Bildtafeln des Glossars dokumentieren an Schwellen generierte visuelle Informationen, Anweisungen für den Gebrauch, sowie bauliche Abwandlungen und Umdeutungen von Öffnungen.
Unser besonderer Dank gilt Georges Teyssot, auf dessen grundlegenden Arbeiten zur Schwelle in der Architektur dieses Heft aufbaut.
Elke Beyer, Kim Förster, Anke Hagemann, Laurent Stalder
Dank
Wir danken der Gastredaktion für die hervorragende Aufbereitung des Forschungsmaterials sowie für die gute und unermüdliche Zusammenarbeit während der letzten anderthalb Jahre.
Unser Dank gilt auch der Firma Siedle, die mit einer großzügigen Förderung die Publikation der umfangreichen Forschungsergebnisse ermöglichte.
Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo