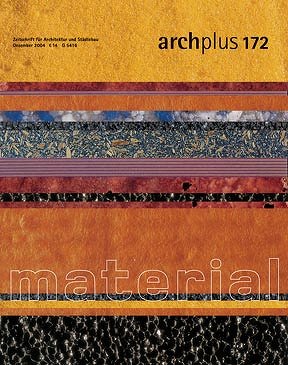Editorial
Denn unser Traum von einem geschmeidigen Material, das unseren Absichten so leicht folgt, wie die Sprache unseren Gedanken, wird in Erfüllung gehen.
Henry van de Velde
1981 entwickelte Mike Davies sein Konzept für eine polyvalente Wand: Ein wenige Mikrometer starkes Sandwich in eine Glasfassade eingebettet, das mit 9 Funktionsschichten alle Elemente für eine thermische, optische und akustische Umweltsteuerung vorsah. Diese Gebäudehaut sollte aus dynamisch variablen Materialien bestehen und sich als Bestandteil eines intelligenten Service-Systems an Nutzergewohnheiten anpassen.1 Was ist daraus geworden? Sind wir heute, rund 25 Jahre später, auch 25 Jahre weiter? Das ist nicht einfach zu beantworten. Die polyvalente Wand nach Davies' Konzept gibt es nicht - und wird es so wahrscheinlich auch nie geben. Nicht, weil es „nur“ eine Vision war. Dazu kannte er sich zu gut aus, was den Stand der Forschung über Photo- und Elektrochromie, Flüssigkristalle, Photovoltaik, piezoelektrische Effekte etc. betraf. Aber der Weg von der wissenschaftlichen Erkenntnis bis zur technologischen Umsetzung ist nach wie vor sehr weit und unterwegs passiert einiges an Irrtümern, Modifikationen etc. Davies' zentrale Idee einer steuerbaren, reagiblen Gebäudehaut machte jedoch Schule und wurde in der Folge auf alle möglichen Arten durchbuchstabiert. Die Erfahrungen sind bekannt und, obwohl das technische know how über Gebäudeperformance immens gewachsen ist, letztlich ernüchternd. Die Vorstellung des Gebäudes als ein sich selbst regulierendes technisches System scheint nur bedingt realisierbar zu sein: zu viele Einflußfaktoren, Anfälligkeiten, Fehl- bzw. Übersteuerungen und, nicht zuletzt, der dumme Benutzer, der von dem intelligenten Haus vor die Tür gesetzt wird.2 Geblieben ist der Systemgedanke, daß beim Leichtbau alle beteiligten Materialien ihren Beitrag zur Gebäudeperformance leisten sollten. Um so besser, wenn sie das von sich aus tun ohne zusätzliche Steuerung. Es wäre fatal, wenn das als Kehrtwende und Absage an high tech mißverstanden würde - den Weg zurück gibt es nur als Romantizismus; tatsächlich korrespondiert die Zerlegung eines Gesamtsystems in selbständig agierende Untereinheiten, die in ihrem Zusammenwirken stabiler und leistungsfähiger sind als ein zentrales System, mit den neueren Entwicklungen im elektronischen Bereich. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet also: Ja, wir sind weitergekommen, nicht gradlinig, aber in der Einschätzung dessen, was sinnvollerweise machbar ist. Und natürlich haben sich die Materialien weiterentwickelt, sowohl qualitativ, was ihre Eignung für spezifische Funktionen betrifft, als auch in einer quantitativen Explosion. Es gibt keine Zahlen, aber eine Verzehnfachung dürfte, Werkstoffe und Halbzeuge zusammengenommen, viel zu niedrig geschätzt sein. Vermutlich ist es eher, berücksichtigt man die wachsende Produktdiversifikation eines Stoffs, eine Verhundertfachung.
Das war eine der Schwierigkeiten bei der Konzipierung dieses Hefts. Die Welt der Materialien ist zu einem Schlaraffenland geworden, wo jeder Systematisierungsversuch im Reisberg steckenbleibt. Die Unterteilung in Fallstudien erlaubt sowohl eine selektive Vertiefung des Themas als auch die beispielhafte Dokumentation. Folgende Beobachtungen und Fragen waren für die Auswahl maßgeblich:
1. Ein Großteil der hippen Materialentwicklungen bzw. -entdeckungen, wie sie in den jüngst erschienen Materialkatalogen vorgestellt werden3, geschieht im Designbereich. Was davon hält den restriktiveren Anwendungskriterien des Bauens stand? Das Heft will nur Materialien vorstellen, die für das Bauen tatsächlich relevant sind oder werden können.
2. Natürlich konnte es nur um Leichtbau gehen. Die neuere Konjunktur massiver Bauweisen ist unter dem Aspekt der Materialentwicklung weniger interessant, obwohl auch hier, vor allem mit der Anmutung von Beton, experimentiert wird.
3. Obwohl sich im Umfeld von Glas nach wie vor viel tut, sind es nicht mehr die großen technologischen Neuerungen der 90er Jahre, sondern eher Festigung und Ausbau des erreichten Stands. Das betrifft jegliche Form von Verbundkonstruktionen und Glassandwiche. Von daher spielt Glas in diesem Heft nur eine marginale Rolle. Viel spannender ist, daß derzeit in der Architektur wieder alle Materialien im Spiel sind, und einer der Entwicklungsschwerpunkte bei Kunststoff und Beton als Leichtbaumaterialien liegt.
4. Die Beschäftigung mit den Herstellungstechniken ergab sich zwangsläufig aus der Frage nach der immer feinteiligeren Spezifizierung von Materialeigenschaften, sowohl in funktionaler wie inszenatorischer Sicht. Dabei zeigten sich material- übergreifende Prinzipien der Werkstoffentwicklung. Außerdem definieren die Herstellungstechniken die Anwendungschancen eines neuen Werkstoffs bzw. die Möglichkeiten des Transfers von Werkstoffen aus anderen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt und dem Automobilbau.
5. Diese Prinzipien der Werkstoffentwicklung lassen sich in drei Hauptgruppen aufspüren. Die erste und größte bilden die Komposite. Hier sind die Fallstudien über faserverstärkte Betone und Kunststoffe, aber auch die Phase Change Materialien einzuordnen. Die zweite Gruppe der Schäume (Fallstudie 4) definiert eine eigene Logik der Werkstoffherstellung, die gegenüber der Variation der Zusammensetzung eines Stoffs auf Strukturveränderungen basiert. Die dritte Gruppe schließlich bestreiten die Oberflächentechnologien (Fallstudie 5 und 6 über Nanowerkstoffe und Leuchtende Flächen). Beschichtungen wurden bis dato nicht als eigenständige Werkstoffgruppe definiert, sondern als eine Art Additiv zu bestehenden Werkstoffen. Das scheint in Anbetracht der wachsenden Bedeutung der Oberfläche und der Möglichkeiten der Beeinflussung von Eigenschaften durch Oberflächentechnologien nicht mehr gerechtfertigt.
6. Das Beispiel der polyvalenten Wand zeigt, daß die Orientierung am technisch Möglichen leider wenig über das praktisch Machbare aussagt und auch nicht über den Zeithorizont der Umsetzung. Offensichtlich ist es so, daß die eigentliche Innovation, die Erforschung von Zusammenhängen, die die Entwicklung von Technologien an-stößt, die leichteste Übung ist. Danach geht es mit den Schwierigkeiten los. Bis und ob ein verwertbares Produkt herauskommt, dauert es Jahre, und ob es dann für das Bauen taugt, unterliegt wieder anderen Kriterien. Aus diesem Grund präsentiert das Heft nur Werkstoffe, die kurz vor der Anwendung stehen bzw. gerade neu eingeführt wurden oder die in Pilotprojekten erste Anwendungserfahrungen gesammelt haben - also kommende Materialien.
Das gilt auch für die beiden vorgestellten Konzepte einer adaptiven Gebäudehülle, „Paul“ von Holzbach/Sobek (Fallstudie 3) und „SmartWrap“ von Kieran Timberlake (Fallstudie 7). Beide Konzepte gibt es als Prototypen, da sie sich nur tatsächlich verfügbarer Materialien bedienen. Trotzdem sind einige Zweifel an der Realisierbarkeit anzumelden, insbesondere was „SmartWrap“ be-trifft, das als eine Fortentwicklung der Idee der polyvalenten Wand betrachtet werden kann. LEDs und Solarzellen auf Polymerbasis werden in Displays und elektronischen Geräten eine breite An-wendung finden, das ist absehbar. Aber im Bauen? Hier gibt es zwei große Hemmnisse, den Konservativismus der gestandenen Praktiker nicht mitgerechnet. Erstens geht es beim Bauen immer um größere Mengen, und die jeweils neuesten Technologien sind teuer. Längerfristig bietet das allerdings die Chance der Verbilligung. Zweitens haben Gebäude einen mindestens sechsfach größeren Abschreibungszeitraum als consumer electronics, und eine vergleichsweise unbeschränkte Lebensdauer. Die Haltbarkeit dieser neuen Produkte muß sich erst noch erweisen.
Von daher werden Architekten auf vieles, daß heute technisch möglich ist und in anderen Bereichen umgesetzt wird, noch warten müssen. Das ist nichts für ungeduldige Menschen.
1 vgl. dazu Mike Davies, Eine Wand für alle Jahreszeiten, in: 104 ARCH+, S. 46 ff., Juli 1990
2 vgl. dazu Vilém Flusser, Ephemere, dialogische Architektur, S. 41, in: 111 ARCH+, März 1992
3 Die Kataloge sind im Leserservice auf S. 81 aufgeführt.