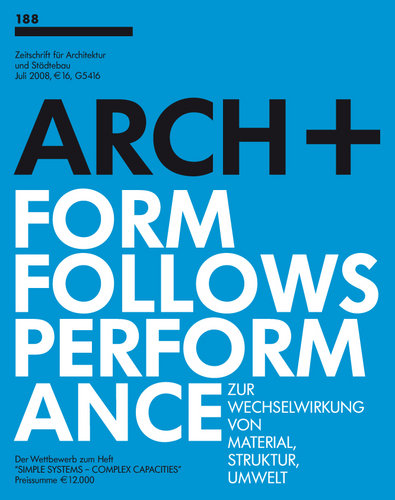Editorial
Zur Wechselwirkung von Material, Struktur, Umwelt
Kann man Architektur neu denken – nicht als einen Wechsel des Erscheinungsbildes, sondern von den maßgeblichen Parametern des Entstehens und Verhaltens von Gebäuden her, also von Grund auf? Und was wären die Ansatzpunkte dafür, an welchen Vorbildern könnte man sich orientieren?
ARCH+ 188 unternimmt diesen Versuch. Es ist, wie der Titel schon sagt, ein programmatisches Heft, ein Anfang auf dem Weg zu einer Architektur des Performativen.
Vorbild ist der integrierte Prozess der Form- und Materialwerdung natürlicher Systeme. Im Zentrum der Forschung und der vorgestellten Fallstudien stehen Materialsysteme, die in Wechselwirkung mit der Umwelt stehen und auf konstruktive, funktionale und performative Anforderungen eingehen können. Materialsysteme werden über Strukturen und die Möglichkeiten ihrer Differenzierung definiert, sie eröffnen für Architekten ein neues entwerferisches Potenzial, da sie auf einer neuen Maßstabsebene zwischen dem Mikromaßstab des Materials und dem Makromaßstab des Gebäudes angesiedelt sind.
Begleitend zur Ausgabe 188 lobt ARCH+ den Wettbewerb „Simple Systems – Complex Capacities“ aus. Der Wettbewerb soll für eine breitere Diskussion und eine experimentelle Weiterentwicklung des vorgestellten Konzepts sorgen.
Inhalt
04 Anpassungen
Kraft, Sabine
05 ARCH+ Ausblick: Simple Systems - Complex Capacities
Arch
06 ARCH+ Rückblick: Die schwarzen Seiten von Bruno Schindler
Schindler, Bruno
16 Am Anfang...einer neuen Architektur des Performativen*
Hensel, Michael / Menges, Achim
18 betr.: Material und Struktur: Form- und Materialwerdung
Hensel, Michael / Menges, Achim
26 betr.: Raum und Umwelt: Gebaute Umwelt und heterogener (Lebens-)raum
Hensel, Michael / Menges, Achim
31 betr.: Theorierahmen: Performance als Forschungs- und Entwurfskonzept
Hensel, Michael / Menges, Achim
38 Materialsysteme 01: Von der universellen zur performativen Komponente
Hensel, Michael / Menges, Achim
40 Poröse Ziegelgefüge
Sunguroglu, Defne
42 Vektor- und flächenaktive Struktur
Lee, Dae Sung
44 Reaktive Flächenstruktur
Reichert, Steffen
46 Materialsysteme 02: Verformungen
Hensel, Michael / Menges, Achim
48 Streifenmorphologien
Coll I Capdevila, Daniel
50 Endloslaminate
Jaeschke, Aleksandra
52 Adaptive Gleichteilstrukturen
Kellner, Joseph / Newton, David
54 Wandelbare Gitterschalen
Felipe, Sylvia / Truco, Jordi
56 Materialsysteme 03: Gradientensysteme
Hensel, Michael / Menges, Achim
58 Honigwabenstrukturen
Kudless, Andrew
60 Makro-Faserstrukturen
Doumpioti, Christina
62 Gewirkeverbund
Reinhardt, Nico
64 Poröse Guss-Strukturen
Sanchiz Garin, Gabriel
66 Materialsysteme 04: Membranen
Hensel, Michael / Menges, Achim
68 Membranelemente
Toet, Rene
69 Membranschichten
Fujii, Kazutaka
70 Membranen und Seilnetze
Sideris, Pavlos / OCEAN
72 Kinetische Membranen
Baselmans, Jaap
73 AA Membranprojekt
Hensel, Michael / Menges, Achim
76 Materialsysteme 05: Aggregate
Hensel, Michael / Menges, Achim
78 Aggregat natürlicher Partikel
Takahashi, Gen / Fallaha, Hani
80 Aggregat gefertigter Partikel 01
Matsuda, Eiichi
82 Aggregat gefertigter Partikel 02
Hawkins, Anne / Newell, Catie
88 betr.: Tragwerksindividuen: Strukturelle Vielfalt
Bollinger, Klaus / Grohmann, Manfred / Tessmann, Oliver
92 betr.: Fertigungstechniken: Die Mittel der Zeit
Schindler, Christoph
96 betr.: Assoziative Geometrie: Die Werkzeugmacher
SmartGeometry Group / Becker, Mirco
99 betr.: Biomimetik: Grenzüberschreitungen Architektur - Biologie
Vincent, Julian / Menges, Achim / Hensel, Michael
102 betr.: Monomaterialien: Rapid Manufacturing
Soar, Rupert / Menges, Achim
108 Baufokus: Licht und Energie
Mende, Julia von / Korwan, Daniel