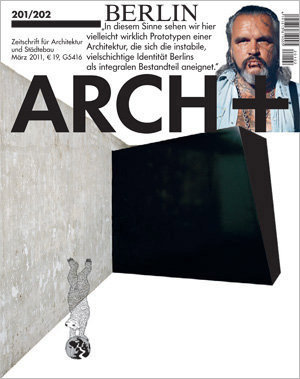Editorial
Zurück aus Neuteutonia
Berlin: unfertig und roh
Berlin ist nach Karl Scheffler dazu verdammt „immerfort zu werden und niemals zu sein“. Mit diesem viel zitierten Satz wird in Berlin Geschichte geschrieben und gemacht. Was Scheffler zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber in die griffige Formel gießt, ist weder Fortschrittsoptimismus noch Nostalgie, sondern eine präzise Problembeschreibung: die fortgesetzte Zerstörung einer Stadt, die sich das Neue nur auf den Ruinen des Alten vorzustellen vermag. So legt Florian Hertweck in einem Rückblick auf die städtebaulichen Kontroversen der 1990er Jahre in diesem Heft dar, wie sich diese „Genealogie der Zerstörung“, diese Logik der (Selbst-)Zerstörung von Generation zur Generation fortpflanzt: von Schinkels Versuch der klassizistischen Überwindung der barocken Stadtanlage, über den wilhelminischen Umbau Berlins zur Weltstadt, über die Kriegszerstörung und den Versuch der Moderne, die Stadt gleich grundsätzlich neu zu erfinden bis hin zur so genannten Kritischen Rekonstruktion, die nun die Moderne zu ihrem bevorzugten Gegner auserkor und durch Rückkehr zur vormodernen wilhelminischen Großstadt vergessen zu machen suchte. „Jeder Gesamtentwurf für Berlin sucht die Auslöschung seines Vorgängers“, so Hertweck (S. 12 ff.).
So macht auch die Gegenwart von dieser fatalen Regel keine Ausnahme. Sie arbeitet tatkräftig weiter an der Selbstzerstörung Berlins, indem sie bevorzugt die ästhetisch oder ideologisch nicht genehme Ostmoderne auslöscht und fast zwei Jahrzehnte lang mit einer engstirnigen Architekturdoktrin jede alternative Entwicklung auszuschließen sucht. Architektur ist jedoch, wie Heike Delitz und Joachim Fischer in ihrem Beitrag eindrücklich argumentieren, eine „datensetzende Macht“, die „Kraftfelder vergangener Zukünfte“ in sich birgt: „Gerade die Tiefenstrukturen der jeweiligen Gesellschaftsentwürfe bleiben im Netz der Stadt, prägen ebenso wie die expressiven Bauten aktuelle und künftige Denkweisen und Realisierungen. Kanalisierung, Straßen, Versorgungsleitungen, die rechtlichen Kodifikationen des Bodens schaffen je spezifische Möglichkeiten, sind die Vektoren künftiger städtischer Gestaltungen.“ Dieser Erkenntnis müsste sich eine tatsächlich gestaltende Stadtpolitik bewusst sein, wenn sie ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung gerecht werden soll. (Delitz/Fischer, S. 32 ff.)
Was aber geschieht in der Realität – unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle des Architekturdiskurses – auf der infrastrukturellen Ebene? Hier führt die Rivalität zwischen Brandenburg und Berlin zur Verfolgung sich grundsätzlich ausschließender Stadtvorstellungen: De- oder Re-Zentrierung der Stadt. Erstere wird eigensinnig vom Land Brandenburg verfolgt, durch die Öffnung der Stadt mit Hilfe neuer Autobahnen. Damit wird ein in der NS-Zeit von Speer mit dem Autobahnring begonnener Prozess fortgesetzt – durch den Ausbau der Radialstraßen jenseits der Stadtgrenzen zu autobahnartigen Schnellstraßen.
Demgegenüber bemüht sich Berlin um die Re-Zentrierung der Stadt durch Rekonstruktion des historischen Zentrums. Dieser Konflikt schlug sich jüngst im Vorschlag einer Gruppe von Berliner Planern nieder, die unter dem Titel „Radikal radial“ besagte Radialstraßen zum Thema der kommenden IBA 2020 machen wollten, um das Verhältnis zwischen Metropole und Umland zu thematisieren und damit an die lange Tradition dieser Straßen vom Postweg zur Bundesstraße anzuknüpfen und sie gleichzeitig stadträumlich neu zu fassen. Wohlgemerkt eben jene Radialstraßen, die durch die Brandenburger Planungen längst zu Autobahnzubringern degradiert worden sind. Dieser Prozess läuft gerade schrittweise auf Brandenburger Seite ab, unbeachtet von der Öffentlichkeit und mit unvorstellbarer Wucht, vor allem im Umkreis des Großflughafens BBI.
Wie lässt sich dieser Konflikt um die De- oder Re-Zentrierung der Stadt auflösen? Ohne dass er direkt oder indirekt zur weiteren Selbstzerstörung Berlins beiträgt? Zunächst muss man sich darüber im klaren sein, dass dahinter verschiedene Gesellschaftsmodelle stehen: Zum einen die Industriegesellschaft, zum anderen die post-materielle Gesellschaft. Wie Dieter Hoffmann-Axthelm in seinem Beitrag (S. 46 ff.) beschreibt, wird seit dem Wettbewerb „Groß-Berlin“ im Jansen-Plan (1910), über Speers Konzept der Autobahnringe im GBI-Plan (1936-39), Scharouns Konzept eines Autobahnnetzes im Kollektivplan (1946) und mit dem Strukturkonzept von 1957 versucht, die Verkehrsplanung als Motor der Industrialisierung einzusetzen und dabei die historische Stadt unterzupflügen, um sie, wie Phönix aus der Asche, als Weltstadt der 1920er, Germania der 1930er und Neues Berlin der 1950er Jahre wieder erstehen zu lassen (s. auch Strukturanalyse S. 52ff.).
Das Modell der post-materiellen Gesellschaft akzentuiert demgegenüber anders und behutsamer. Nicht mehr die Verkehrsplanung ist der Motor der Industrialisierung, sondern neue, post-materielle Werte sollen ihre Stelle übernehmen (s. Bastian Lange, S. 78f.), wie die städtischen Lebensverhältnisse, die Lebendigkeit der Stadt schlechthin. Und zu deren Gunsten treten die harten Fakten der an der Effizienz von Personen- und Warenströmen ausgerichteten Stadt in den Hintergrund und damit auch das Faszinosum der verkehrsgerechten, auto-affinen Stadt. In Berlin nun haben diese Zielsetzungen in der Stimmann-Ära zu einer eigentümlichen Maskerade geführt: zur Kostümierung der sich abzeichnenden post-materiellen Gesellschaft aus dem historischem Fundus der bürgerlichen Großstadt des 19. Jahrhunderts. Dieses Modell kann zwar ein manchmal auch überraschendes Bild von den vorwärtstreibenden Momenten der post-materiellen Gesellschaft vermitteln, die neue Betonung des Städtischen, der Dichte der Stadt, des Fußläufigkeit des Verkehrs. Aber sie ist nicht das Produkt der kommenden Gesellschaft, nur ein historisches Abziehbild mit überraschenden Analogien. Man sehe sich hierzu nur die Leibniz-Kolonnaden von Hans Kollhoff an, die eine bürgerliche Stadtanlage nachahmen, ohne dass die Architektur den Hautgout des Talmihaften verleugnen kann. Sie erzählt von einer falschen Bürgerlichkeit, von der die im Dämmerlicht der Nacht auf dem nahen Kurfürstendamm stehenden Osteuropäerinnen wohl einiges zu berichten wissen.
In diesem Sinne steht eine Stadtpolitik im Sinne Stimmanns sich selbst im Wege bei der Suche nach einer realen Wende zu einer urbanen Stadtpolitik. Diese wird die Stadt selbst in den Blick nehmen müssen, so wie sie da ist und nicht wie sie im historischen Rückblick erscheint. Sie wird die neuen Maskeraden der Stimmann-Zeit mit Schein-Plätzen, Schein-Straßen und Schein-Häusern, denen man schon im Rendering die geschlossene Gesellschaft anmerkt, für die sie konzipiert wurden, durchstoßen müssen, um zu dem vordringen zu können, was das Städtische der kommenden Gesellschaft ausmacht. Gerade auch, weil die okzidentale Stadt das historische Apriori (Foucault) unterschiedlicher Stadtvorstellungen ist, wie es Heike Delitz & Joachim Fischer in ihrem Beitrag so eindringlich belegen. Übersetzt heißt es: Um einer wirklich zeitgenössischen Stadtgesellschaft gerecht zu werden, müssen wir uns die historisch veränderbaren Möglichkeitsbedingungen, denn nichts anderes bedeutet der von Foucault geprägte Begriff, von Stadt immer vor Augen führen.
Diese Wende zu einer grundsätzlich anderen Stadtpolitik, die sich aus der bisherigen Zerstörungslogik Berlins befreit, suchen wir mit dieser Ausgabe zu formulieren. Sie mündet in das Konzept einer Stadt, deren Eigenschaften Florian Heilmeyer im Architekturteil als unfertig, roh und schroff beschreibt. Wobei unfertig, roh und schroff nicht allein ästhetisch gemeint sind, sondern einen Ansatz umschreiben, Stadt im eigentlichen Sinne erst entstehen zu lassen. Mit der Betonung des Unfertigen, Rohen und Schroffen soll also nicht ein neuer Stil kreiert werden, sondern auf die Möglichkeiten des Entstehens von Stadt verwiesen werden, die im Unfertigen und Rohen noch angelegt sind: „In diesem Sinne sehen wir hier“, so Heilmeyer, „vielleicht wirklich Prototypen einer Architektur, die sich die instabile, vielschichtige Identität Berlins als integralen Bestandteil aneignet. Eine Architektur, die nicht mehr „fertig“ sein muss und die auch typologisch nicht mehr eindeutig den alten Kategorien zuzuordnen ist.“ (S. 125 ff.)
Dieses neue Stadtkonzept lässt sich noch am ehesten mit der Strategie der behutsamen Stadterneuerung der IBA-Alt vergleichen. Fokussierte sich diese in den 1980er Jahren auf die alten Arbeiterquartiere in Berlin-Kreuzberg, die zuvor im Rahmen der Stadtsanierung hatten abgerissen werden sollen, so stehen heute die Überreste der untergehenden Industriegesellschaft insgesamt zur Disposition: Infrastrukturgebäude wie Heizkraftwerke, Pumpwerke, Wartungshallen, Fabriken, Gewerbebauten und was sonst noch alles dem Leerstand anheim gefallen ist und fällt. Hier setzt das neue Berlin an. Hier entsteht es. Aber es entsteht nicht, indem es die Ruinen der vorangegangenen Industriegesellschaft unter sich begräbt, sondern indem es sie behutsam weiterbaut, durch geringe Eingriffe umprogrammiert und dadurch neu nutzbar macht.
Zwar handelt es sich bei diesem Konzept um eine architektonische Strategie, gleichwohl steht sie für etwas Umfassenderes, nämlich für ein neues Stadtverständnis. Es scheint, dass eine neue Generation die „datensetzende Macht“ der Architektur verinnerlicht hat – und um deren Konsequenzen für die Stadt weiß. Denn die Stadt gibt nur die Disposition vor, sie ist aber nicht selbst das Medium der Intervention. Dieses ist architektonischer Natur. So verstanden ist Stadt nicht mehr ein Abstraktum, deduziert aus historischen oder utopischen Modellen, sondern etwas Konkretes, Situatives. Stadt so wie sie da ist, as found, wie es in den 1960er Jahren hieß. Und das heißt im Berliner Fall: Berlin als die heterogene und fragmentierte Stadt, die sie als Resultat der ungebrochenen Selbstzerstörung nun einmal ist, anzueignen und mit ihr weiterzubauen. In den überall spürbaren Brüchen ihre Qualität zu erkennen. Dafür steht Berlin heute, das macht seine Attraktivität weltweit aus, und nicht die sklerotische „Berlinische Architektur“, die niemanden interessiert.
In diesem andersartigen Ansatz sehen wir den Ausgang Berlins aus seiner selbstverschuldeten Tradition der Zerstörung. Dass die Dinge derzeit in Bewegung geraten, zeigen die weiteren Themen in dieser Ausgabe: die Frage nach den Arbeitsformen der Zukunft (Kapitel Arbeit), die wohnungs- und stadtpolitische Frage nach einer sozial gerechten Stadt (Kapitel Wohnen sowie ARCH features 4). Welche Möglichkeitsräume sich eröffnen, wenn man von Berlin als Konkretum ausgeht, und welche Phantasie, welcher Witz und welches Wissen gefordert sind, sich mit der Stadt, so wie sie da ist, auseinanderzusetzen, zeigt das Architekturkapitel. Ganz gleich, ob man sich mit expressiven Bestandsbauten (Berghain/Kubus, karhard), einer alten Werkstatt (Galerie Giti Nourbakhsch, Robertneun), aufgelassenen Hallen der Verkehrsbetriebe (Uferhallen Wedding, Anderhalten), mit Systemfehlern und Leerstellen (Berlin Gaps, brandlhuber ) oder mit den „rechtlichen Kodifikationen des Bodens“ (Debatte um Offenen Brief Berliner Architekten oder ExRotaprint) beschäftigt – überall hier entsteht das neue Berlin.
Schaut auf diese Stadt.
Redaktionsgruppe dieser Ausgabe: Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Nicole Opel mit Polina Goldberg, Christine Rüb, Sara-Lina Schlenk, Verena Schmidt, Dorit Schneider, Daniel Spruth
Mit dieser Ausgabe leistet ARCH einen diskursiven Beitrag zur Zukunft Berlins anlässlich der Ausstellung „Grand Paris in Berlin. Die Zukunft unserer Metropolen“, die vom 28. Januar bis zum 5. Mai 2011 im Kulturforum in Berlin zu sehen ist (s. Denis Bocquet, S. 18f.). Wir danken der Alfred Herrhausen Gesellschaft für die großzügige Förderung des Projekts.
Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo