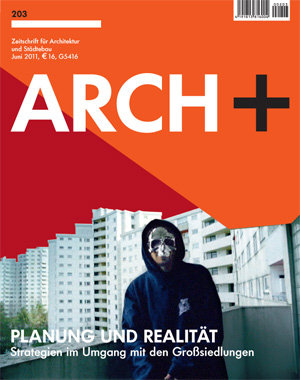Editorial
Die Großsiedlungen der 60er und 70er stehen im Zentrum dieser ARCH Ausgabe. Sie sind Zeitzeugen und zugleich die Problemkinder ihrer Zeit. Sie dokumentieren die Höhenflüge der Boomjahre und die unsanfte Landung in einer Wirklichkeit, die nach anderen und sich ändernden Vorgaben funktionierte, sie dokumentieren gleichermaßen die Leistungen des Sozialstaats und das Versagen der Gesellschaft gegenüber den neu erwachsenden Benachteiligungen, sie dokumentieren in gewisser Weise den oder vielleicht besser: einen Sieg und ein Scheitern der Moderne.
Woher diese Widersprüchlichkeit? Steigt sie auf aus der Kluft zwischen Planung und Realität, die so unvermeidlich ist wie im Brechtschen Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens „Ja mach nur einen Plan ...“, und die deswegen besonders groß zu sein scheint, weil es auch Planungen im großen Maßstab waren? Wenn diese Ausgabe den Titel „Planung und Realität“ trägt, so zielt das sehr wohl auf diese mangelnde Kongruenz zwischen beidem, aber es soll keinesfalls einem Planungsdefätismus das Wort geredet werden, der zu den beliebten Attituden der postmodernen Kritik an den Bauvorhaben der Zeit gehörte, im Gegenteil: Das Erkenntnisinteresse wird hier von der Frage geleitet, ob denn alles, was in der Nachkriegszeit geplant und gebaut wurde, so falsch gewesen sei. Gerade die Widersprüchlichkeit in der Bewertung dieser Phase, in die man sehr schnell auch heute noch verwickelt wird, suggeriert diese Frage.
Teil I: Zeitgeschichte geht mit mehreren Beiträgen zurück in die 60er/70er Jahre und versucht von der Gegenwart aus noch einmal in die Befindlichkeit der Zeit einzutauchen, soweit dies überhaupt möglich ist. Die Siedlungen aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus zu begreifen, ist Voraussetzung, wenn man aufspüren will, was auf dem Weg von der Intention bis zur Realisierung fehlgelaufen ist – womit nicht gesagt sein soll, dass es sich nur um ein Realisierungsproblem handelte und die Intention außen vor ist. Damit würde man es sich zu einfach machen. Diese spannende „Zeitreise“ erfolgt in Deutschland und in Frankreich vor dem Hintergrund der rasanten Modernisierung der Gesellschaft. Tilman Harlander und Martina Schretzenmayr skizzieren die Entwicklung in der BRD und DDR, Tom Avermaete und Anne Kockelkorn behandeln zwei aufeinanderfolgende Zeitabschnitte in Frankreich. Die Beschränkung auf die zwei Länder bzw. drei Staaten innerhalb Europas war aus Platzgründen notwendig, aber die Auswahl ist nicht beliebig, da Frankreich mit seinem ausgeprägten Staatsdirigismus gewissermaßen eine Position zwischen der BRD und der DDR einnimmt, die interessante Vergleiche erlaubt. Das zeigt sich auch in der quantitativen Dimension: Während in den 90er Jahren nur jeder 60. Bundesdeutsche in einer Siedlung der Nachkriegszeit wohnte, war in Frankreich jeder sechste Bürger Bewohner eines Grands ensembles und in der DDR war sogar jeder vierte Bürger in einer Plattenbausiedlung untergebracht. Die Planungseuphorie jener Zeit, nach der Mondlandung schien es keine Grenzen des Machbaren mehr zu geben, die nicht gesprengt werden könnten, wird von Klaus Jahn Philipp auch gerade vor dem Hintergrund der Konkurrenz der politischen Systeme diskutiert. Als Abschluss von Teil I versucht Sabine Kraft mit Blick auf das Raumkonzept der Siedlungen und die Faktoren, welche die internen Verhältnisse bestimmt haben, eine differenziertere Antwort auf die Frage nach dem Scheitern zu finden bzw. nach dem, was Bestand haben könnte.
Der Focus Wohnungsversorgung ist als Bindeglied zwischen den beiden Teilen des Heftes konzipiert. Er hat die Aufgabe, zur aktuellen Bedeutung der Siedlungen überzuleiten. In einem Gespräch mit Bernd Hunger, einem Vertreter der Wohnungswirtschaft, werden die Rolle des Mietwohnungsbaus und Probleme der Verwaltung des Bestands erörtert.
Teil II: Die Siedlungen beschäftigt sich in zehn Fallstudien mit der gegenwärtigen Situation. Wo möglich, wurde die Entstehungsgeschichte und das Originalkonzept anhand historischer Pläne und Fotografien dokumentiert Die Auswahl erfolgte in strategischer Absicht. So ähnlich in vielen Fällen die Siedlungen zu Beginn ihrer „Karriere“ erscheinen mögen, so unterschiedlich präsentieren sie sich heute. Sei es, dass ihr Ausgangspunkt doch recht divergent gewesen ist und sie sich in gegensätzliche Richtungen entwickelt haben, oder sei es, dass die Umgebungsfaktoren eine unterschiedliche Entwicklung genommen haben. In sozialer Hinsicht, und das ist letztlich der einzig maßgebliche Aspekt, gibt es Siedlungen, die gut funktionieren und sich auch „funktionstüchtig“ gegenüber ihren Bewohnern verhalten, und es gibt Siedlungen, die sich zu sogenannten „Sozialen Brennpunkten“ entwickelt haben, die ein anderes Maß an Aufmerksamkeit und andere Strategien verlangen. Ausschlaggebend sowohl für die soziale Situation in den Siedlungen als auch für die Ebene des Eingriffs ist es, ob sie sich in einer schrumpfenden oder prosperierenden Region befinden. Auch die Qualität der räumlichen Situation und der Bausubstanz, sowohl in formaler wie bauphysikalischer Hinsicht, erfordert im Umgang mit den Siedlungen ein differenziertes Vorgehen und für ihre Anpassung an heutige Standards einen unterschiedlichen Investitionsaufwand.
Fallstudie 1 und 2 rücken die soziale Situation in den Mittelpunkt der Betrachtung. Vorgestellt werden die Neue Vahr in Bremen als Siedlungsprojekt, das seit seinem Bestehen ein hohes Maß an Bewohnerzufriedenheit aufweist, sowie Darmstadt- Kranichstein und Bremen-Tenever, stellvertretend für die vielen Siedlungen, in denen durch nicht-investive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ eine Verbesserung der sozialen Situation der Bewohner erreicht werden soll. Fallstudie 3 und 4 setzen den Fokus auf den Einfluss, den Stadtentwicklungsprozesse auf das Schicksal der Siedlungen nehmen. Mit dem Stadtumbau Ost ist der Abriss und Rückbau von Siedlungen in schrumpfenden Regionen das Thema, während die Stadterneuerung in den Niederlanden vor dem Hintergrund wirtschaftlichen Wachstums geschieht und ebenfalls Abrissstrategien verfolgt, nicht aus dem Zwang der Abwanderung heraus, sondern als Politik der Aufwertung. In Stadtumbau Ost wird mit dem Oleanderweg in Halle-Neustadt ein Rückbau gezeigt, der mit geringem Aufwand eine Neuorganisation der Gebäude und beachtliche neue Qualitäten hervorbringt, mit den Stadthäusern in Amsterdam-Osdorpwird ein Low cost-Neubauprojekt in den Niederlanden vorgestellt. Fallstudie 5 und 6 zeigen die Erhaltung von Siedlungen, die unter Denkmalschutz gestellt wurden, auf eine bemerkenswert radikale Weise. Die Sanierung der Siedlung Park Hill in Sheffield, international berühmt wegen ihrer „streets in the sky“, basiert auf einer totalen Entkernung, bei der nur das Skelett stehenblieb, das Olympische Dorf in München, ein heiß begehrtes Studentenquartier, wurde zum Zwecke seiner Erhaltung sogar abgerissen und leicht modifiziert wieder aufgebaut – ein Strategie, die an den japanischen Umgang mit Tradition erinnert. Fallstudie 7, 8 und 9 sind dem aktuellen Thema der energetischen Sanierung im Hinblick auf den Klimaschutz gewidmet. Was im Rahmen dieser Ausgabe wenig interessierte, waren die üblichen, überall durchgeführten Dämmmaßnahmen. Dazu werden im BAUFOKUS zusätzlich sieben weitere Projekte vorgestellt. Für die Auswahl in den SCHWERPUNKT musste mindestens noch ein weiterer Aspekt hinzukommen. Die Cité du Lignon in Genf hatte mit den Schwierigkeiten der sogenannten „energetischen Ertüchtigung“ unter Vorgaben des Denkmalschutzes zu kämpfen, die Sanierung des Piusviertel in Ingolstadt bezog die Wohnungen und den Außenraum mit in die Erneuerung ein. Den Tour-Bois-Le-Prêtre in Paris nur unter energetischen Gesichtspunkten zu behandeln, würde dem Projekt nicht gerecht werden, obwohl es mit der Schaffung von innen nach außen gestufter Klimazonen ein sehr intelligenter Beitrag zu diesem Thema ist. Hier wird mit sehr einfachen und billigen Maßnahmen eine immense Steigerung des Gebrauchswerts erreicht. Fallstudie 10 schließlich zum Sozialen Wohnungsbau in Singapur soll nicht zuletzt darauf verweisen, dass die großen Bauvorhaben der 60er/70er Jahre, um deren Erhaltung es derzeit geht und die in Europa allein wegen des mangelnden Bevölkerungswachstums keine Renaissance finden werden, in unzähligen Neubauprojekten im asiatischen Raum und in anderen stark wachsenden Weltregionen ihre Fortsetzung finden.
Redaktionsgruppe dieser Ausgabe: Juliane Greb, Sabine Kraft, Philipp Schneider Mitarbeit: Friederike Obst