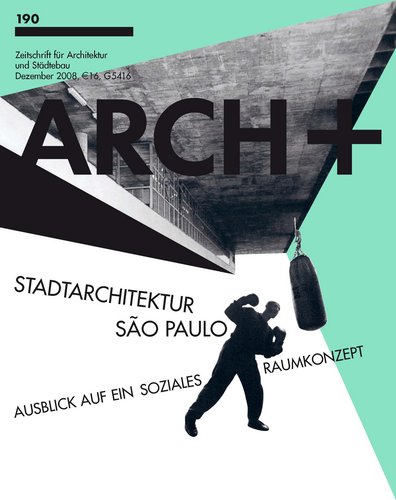Editorial
Stadtarchitektur oder Stadt der Mauern?
„Die Portugiesen kamen vorbei, um mitzunehmen“, so beschreibt Dawid Danilo Bartelt in seinem Beitrag lakonisch das „fluide Imperiumskonzept“ der Portugiesen in Brasilien, das vor allem auf Warenströmen basierte. Im Gegensatz zu den Spaniern, die kamen, um zu herrschen und zu siedeln, war Städtebau bei den Portugiesen kein großes Thema. Darin liegt auch der Unterschied zwischen dem improvisierten Charakter portugiesischer Kolonialstädte und den rigiden Rasterstädten der spanischen Kolonisatoren begründet. Das Fluidum, das Brasilien seit jeher umweht, hat somit einen realpolitischen Hintergrund. Es ist auf einem kulturellen Nährboden gediehen, der von Anfang an vom Austausch geprägt war. Vor nun bald 80 Jahren kam Le Corbusier zum ersten Mal nach Brasilien, nicht nur um mitzunehmen, sondern auch um zu geben. Mit seinem „fremden Blick“ entdeckte er in der tropischen Landschaft etwas in sich selbst, das ihn veränderte. Mit dieser Veränderung legte er wiederum den Keim für eine der außergewöhnlichsten Entwicklungen in der Geschichte der modernen Architektur: die brasilianische Moderne (vgl. Queiroz, S. 34).
Die Fähigkeit, sich das Fremde einzuverleiben und es zugleich zu verwandeln, postulierte der brasilianische Intellektuelle Oswald de Andrade 1928 in seinem „Anthropophagischen Manifest“ als Wesensmerkmal der brasilianischen Kultur. Wie sich der „Kannibale“ die Kräfte und den Mut des Feindes buchstäblich einzuverleiben suche, könne Brasilien die kulturelle Abhängigkeit und damit die postkoloniale Machtkonstellation nur überwinden, indem es das Fremde verschlinge und verinnerliche. Die Anthropophagie steht dabei als Metapher für einen ungehemmten Synkretismus und eine selbstbewusste Form der Kulturaneignung (vgl. Andrade, S. 30; Filho, S. 32). Und in der Tat scheint sich Brasilien die architektonische Moderne dergestalt einverleibt zu haben, dass es – im Gegensatz zu China und Indien, den beiden anderen von uns bisher behandelten BRIC-Staaten – unsere Sehnsucht nach einer ungebrochenen Moderne perfekt bedient (vgl. ARCH 168 Hochgeschwindigkeitsurbanismus und ARCH 185 Inselurbanismus). Eine Moderne, die weit über ihre europäischen Ursprünge hinausgeht und in ihren besten Beispielen eine zivile, ethische und urbane Architektur hervorgebracht hat, die den Traum der europäischen Moderne transzendiert.
Vor diesem Hintergrund wollen wir nicht wie gewohnt urbanistisch argumentierten, d. h. mit einem eurozentrischen Blick auf die Probleme, Auswüchse und Dynamiken städtischer Agglomerationen hinweisen. Stattdessen setzen wir mit dem vorliegenden Heft die Stadtreihe mit einem eher architektonischen, besser gesagt: mit einem „stadtarchitektonischen“ Fokus fort. Den Begriff „Stadtarchitektur“ verwendet der brasilianische Architekt Alexandre Delijaicov im Heft, um das besondere Stadt- und Architekturverständnis seines außergewöhnlichen Schulbauprojekts CEU in São Paulo zu charakterisieren. Dieses Konzept hält in der Verschränkung der beiden Ebenen ein einzigartiges Raumkonzept bereit, das in der Lage ist, den „Knoten der schizophrenen Aufteilung in Architektur und Urbanismus“ zu lösen, wie es der brasilianische Pritzker-Preisträger Paulo Mendes da Rocha gefordert hat (vgl. Delijaicov/Rosa, S. 92).
In diesem Heft wollen wir uns auf São Paulo und auf die nach der Stadt benannte Paulista-Schule konzentrieren, deren derzeit prominentester Vertreter Paulo Mendes da Rocha ist. Im Zentrum unseres Interesses steht der Beitrag dieser Architekturrichtung zur Herausbildung eines sozialen Raumkonzepts, das den Kern einer neuen „Stadtarchitektur“ bildet. Damit ist jedoch das Gegenteil dessen gemeint, was vor allem Europäer mit Aldo Rossis „Architektur der Stadt“ (1966) verbinden. Es geht hier nicht wie bei Rossi um eine Herleitung der Architektur aus dem Geist der Geschichte, nicht um eine Entwurfsmethodik, deren Grundlage die historischen Stadttypologien bildeten. Vielmehr wird mit Stadtarchitektur ein soziales Projekt umschrieben, dessen Ideen u.a. auf die brasilianischen Reformpädagogen Anisio Teixeira und Paulo Freire und die Architekten Affonso Eduardo Reidy und João Batista Vilanova Artigas zurückgehen. Der soziale Charakter der Architektur steht dabei im Mittelpunkt: die Architektur urbaner Infrastrukturen, wie Plätze, Straßen und Verkehrssysteme; die Architektur öffentlicher Einrichtungen, wie Park- und Unterrichtsschulen, CEU und Kultureinrichtungen wie SESC und die Architektur des sozialen Wohnungsbaus (vgl. Wisnik, S. 52; Hehl, S. 74).
Indem wir auf die zivile, ethische und urbane Dimension der brasilianischen Architektur verweisen, wollen wir zugleich unterstreichen, dass die Lösungsansätze für ein drängendes Probleme der heutigen brasilianischen Stadt im Kern bereits vorliegen. Die Stadtsoziologin Teresa Caldeira benennt dieses Problem mit der metaphorischen Beschreibung São Paulos als „Stadt der Mauern“. Damit weist sie auf die städtischen Herausforderungen hin, auf die soziale Segregation von morro und asfalto, von Favela-Bewohnern oben auf den Hügeln (morro) und den Wohlhabenden in den Apartments unten auf dem Asphalt (asfalto), von Zentrum und Peripherie, von Landlosen und Stadtbewohnern. Damit greift sie über den alten Stadt-Land-Gegensatz hinaus und macht deutlich, dass Stadt und Stadtgebrauch an Eigentumstitel gebunden sind (vgl. Bartelt, S. 6).
Die „Stadt der Mauern“, mit denen sich die wohlhabenden Schichten gegen die Invasion von den Hügeln und aus dem Hinterland, dem „Sertão“, wappnen wollen, gibt es nur um den Preis der Aufgabe der sozialen Durchlässigkeit der Stadt. Dem setzen wir in dieser Ausgabe ein Konzept von Stadtarchitektur entgegen, das einschließt statt auszuschließen, das ent-grenzt statt auszugrenzen und zwar in der Absicht, den Stadtkörper so zu organisieren, dass er wieder gesellschaftsfähig wird. Die Angst vor der Invasion der Hügelbewohner geht inzwischen so weit, dass die „Stadt der Mauern“ selbst vom Boden abhebt und nach neuen Lagen „on-the-air“ sucht, aber nicht mehr aus Gründen politischer Utopie, wie die Immeubles Villas von Le Corbusier, sondern aus schieren Sicherheitsbedürfnissen (vgl. Oswalt, S. 110).
Die europäischen Ursprünge der brasilianischen Architektur beginnen und enden mit Le Corbusier. Damit sind nicht nur seine zwei Reisen nach Südamerika gemeint, 1929 und 1936, sondern auch diejenigen Bezüge, die durch den englischen Architekturhistoriker Reyner Banham und die Architekten Alison und Peter Smithson vermittelt auf Le Corbusier zurückverweisen: der „Brutalismus“ der Paulista-Schule (vgl. Wisnik, S. 52). 1946 entwirft Le Corbusier die Unité d’habitation für Marseille und bildet hierbei das Fluchttreppenhaus am Ende der rue interieur als Architekturplastik aus, und das ganze Gebäude als „soziale Plastik“. Diese Architekturplastik wird in Beton gegossen, der aufgrund seiner sichtbar bleibenden Spuren der Schalungsbretter béton brut genannt wird. Von diesem Terminus technicus leitet sich der nach ihm benannte „Brutalismus“ ab. Allerdings ist dieser allzu schnell zum Ismus verkommen, weswegen Banham zwischen dem Brutalismus als Stilbegriff und dem „New Brutalism“ der englischen Mitglieder des Team 10 unterscheidet. Letztere traten für eine sozial motivierte Kritik an den CIAM-Grundsätzen in Architektur und Städtebau und nicht für das Material béton brut ein: „Bisher ist der Brutalismus als Formproblem behandelt worden“, schreiben Alison und Peter Smithson diesbezüglich, „während er in seinem Wesen ethisch ist.“ Banham sieht in diesem Neuen Brutalismus eine Haltung, die jenseits der bloßen Zurschaustellung unbearbeiteter Oberflächen das Fanal für einen Neuanfang der europäischen Nachkriegsarchitektur bilden könnte. „The New Brutalism“ nannte er folgerichtig seine bahnbrechende Veröffentlichung von 1966 und fügt als Untertitel die Frage hinzu „Ethic or Aesthetic“, um damit anzudeuten, dass darunter die Neuerfindung der Architektur in ethischer Absicht gemeint ist.
Vor dem Hintergrund der sozialen Segregation in Brasilien scheint es naheliegend, dass die ethische Problemstellung des „Brutalismus“ bei Architekten wie Vilanova Artigas auf fruchtbaren Boden fiel (vgl. Moreira, S. 58). Denn eine wesentliche Frage für Architektur und Städtebau betrifft den Umgang mit der Heterogenität der modernen Gesellschaft. In Europa versuchten damals die Vertreter des New Brutalism darauf zu antworten, indem sie das Projekt nicht mehr als monolithische Einheit betrachteten, sondern als Ergebnis einer fraktalen Montage heterogener Elemente, seien sie funktional, sozial, räumlich oder stadträumlich. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Wettbewerbsentwurf für die Universität Sheffield von Alison und Peter Smithson. Während die Moderne dazu neigte, den Baukörper monolithisch zu konzipieren und alle Funktionen in einem Gehäuse zu konzentrieren, versuchten die Smithsons nun, ihn in eine Folge von heterogenen Elementen aufzulösen und zugleich als Cluster zusammenzufassen. Dadurch bildete sich eine heterogene Struktur, die durch die Verkehrswege aus Rampen, Brücken und Straßendecks und dem zugrunde liegenden Montageprinzip zusammengehalten wird. „Aufgrund dieser Zurschaustellung des inneren Verkehrssystems wird der Zusammenhang der Verkehrswege – in Ermangelung jeder erkennbaren visuellen Ästhetik – zum verbindenden Prinzip des Entwurfs“ – und zu seiner neuen ethischen Basis. Banham charakterisierte diesen Ansatz als „topologisches Entwerfen“. Es zeichnet sich durch eine weitere Verflüssigung des fließenden Raums der Moderne aus, indem es den Akzent von der Funktion auf die Bewegungssequenz verlagert und dadurch die Bewegung als das dem Entwurf zugrundeliegende Montageprinzip einführt. Allerdings muss hier einem verbreiteten Missverständnis vorgebeugt werden: Damit wird nicht einer szenographischen Architektur das Wort geredet, wie sie Jahrzehnte später vielfach zur Erklärung der Arbeiten von Rem Koolhaas herangezogen wurde, sondern der abstrakten Bewegung als solcher. In architektonischen Begriffen könnte man vom Bewegungsdiagramm als Entwurfsmuster sprechen.
Die Paulista-Schule hat das in Europa abgebrochene Projekt des „New Brutalism“ und dessen Suche nach einer ethischen Begründung der Architektur fortgesetzt. Indem sie es mit den sozialen und klimatischen Bedingungen Brasiliens verschmilzt, entwickelt sie ein soziales Verständnis von Architektur und bildet damit ein neues Entwurfsmusters aus, das in einer spezifischen Art von Stadtarchitektur mündet (vgl. Brinkmann, S. 46; Spiro, S. 100).
Sehen wir uns hierzu das Projekt der Park- und Spielschulen genauer an (vgl. Wisnik, S. 52; Delijaicov, S. 92). Wie die Smithsons suchen die brasilianischen Architekten das Konzept des monolithischen Gebäudes in eine Folge von heterogenen Körpern aufzulösen und nach neuen Kriterien zu montieren. Die Organisation des Verkehrsflusses gehorcht dabei ebenfalls dem Montageprinzip. Die funktionalen Einheiten werden so arrangiert, dass sie sich um einen meist überdachten Pausenhof legen. Gleichzeitig erweitern sich die Schulen nach außen um Höfe und Gärten – daher auch der Name Park- und Spielschule. Als punktuelle Intervention wirken sie über sich hinaus und auf den bestehenden Stadtraum ein. Die Schule wird dadurch nicht nur zu einer Bildungsstätte, sondern auch zu einem sozialen Zentrum für die Anwohner. Diese können die Schule abends und am Wochenende als Versammlungsort und Treffpunkt nutzen (Bibliothek, Theater, Kino). Es handelt sich also um wenige gezielte Eingriffe – die Erweiterung der Schule um Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die Anordnung dieser Einrichtungen um einen Pausenhof und Öffnung des Schulkomplexes nach außen in eine abgestufte Folge von Höfen und Gärten, sprich um die Auflösung der Grenzen nach innen und außen – zwischen den Funktionen und zwischen Architektur und Stadt. Dadurch entsteht eine neue Art von Stadtarchitektur und eine architektonische Alternative zum Segregationsprinzip der Stadt der Mauern. Diese neue Stadtarchitektur, eine Architektur der urbanen Landschaft (vgl. Queiroz, S. 34), basiert zwar auf europäischen Anregungen und dem Denken in Bewegungssequenzen sowie dessen Umsetzung in Bewegungsdiagramme. Diese Bewegungsdiagramme werden jedoch anders als in Europa räumlich akzentuiert und das Räumliche wird wiederum sozial-räumlich verstanden.
Aber wie kann Architektur „das Soziale“ verräumlichen? Die gleiche Frage hat Richard Sennett kürzlich anlässlich der Entgegennahme des Gerda-Henkel-Preises in Bezug auf die Soziologie gestellt. Er betonte, dass es Ziel der soziologischen Literatur sein müsse, „ein Gefühl gelebter Erfahrung durch geschriebenen Text hervorzurufen“. Denn als schreibender Soziologe gelte es, mit literarischen Fähigkeiten in den Lesern „einen Sinn für „das Soziale“ als problematische Kategorie“ zu wecken. Wir können hier leicht anstelle des schreibenden Soziologen den bauenden Architekten und statt den geschriebenen Text gebaute Räume einsetzen, um die Relevanz dieser Antwort im architektonischen Kontext zu verstehen. Es gehe darum, so Sennett weiter, „einen öffentlichen Raum zu schaffen, so wie Hannah Arendt ihn verstand – einen Raum von miteinander geteilter, kollektiver Intelligenz“.
Genau in dieser kollektiven räumlichen Intelligenz sehen wir das neue Entwurfsmuster, das die brasilianische Moderne hervorgebracht hat und das wir in Anlehnung an Henri Lefebvre als Muster zur Produktion von Räumen bezeichnen möchten. Dadurch verschiebt sich erneut der Akzent: Haben wir am Beispiel des Brutalismus beschrieben, wie sich der Entwurfsansatz von der Funktion zur Bewegung verlagert, so können wir nun festhalten, dass hier die Produktion von Räumen im Mittelpunkt steht und damit die Frage, wie Räume entstehen und welche Programme sie erfüllen können. Räume definieren sich aber im Rahmen dieses Ansatzes nicht mehr nach den Unterscheidungen von privat und öffentlich, von gebunden und nicht gebunden, sondern nach sozial situativen Kriterien. Damit wird nicht nur die Unterscheidung von Privatheit und Öffentlichkeit hinfällig, sondern auch die von Architektur und Stadt. Und diese Räume werden zu etwas, was sich sozial konstituiert, situativ einstellt und kodiert – sich aber durch formelle Kriterien weder eingrenzen noch erfassen lässt.
Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Stadtarchitektur entstanden, gerade weil sie ein soziales Projekt und ein architektonisches Konzept verfolgt. Als stadtarchitektonische Interventionen unternehmen sie den Versuch, die duale Stadt und ihre Grenzen nach innen und außen aufzulösen, so dass am Horizont die Vision einer sozial durchlässigen Stadt wieder vorstellbar wird (vgl. Ribbeck, S. 22; Vigliecca, S. 26).
Redaktionsgruppe dieser Ausgabe: Carolin Kleist, Anne Kockelkorn, Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Marcos L. Rosa mit Christian Berkes, Ernst Gruber und Christina Lenart
Diese Ausgabe ist in Kooperation mit dem Stadtforschungsprojekt Urban Age entstanden, einer Initiative der Alfred Herrhausen Gesellschaft und der London School of Economics. Wir danken Wolfgang Nowak, Ute Weiland, Jessica Barthel und Anja Fritzsch sowie dem Team der LSE für die gute Zusammenarbeit.