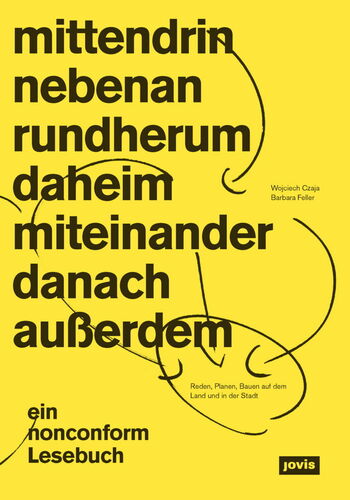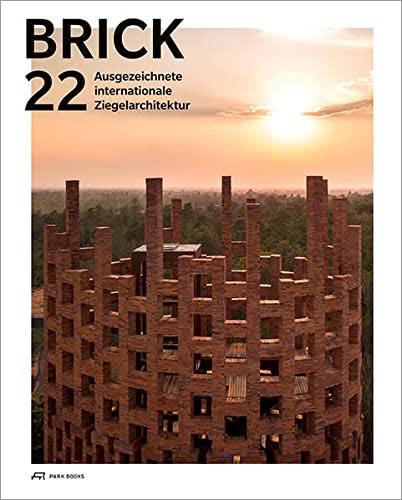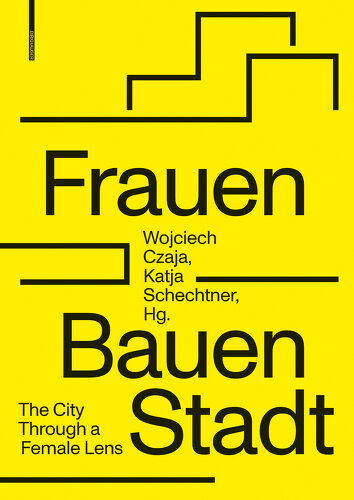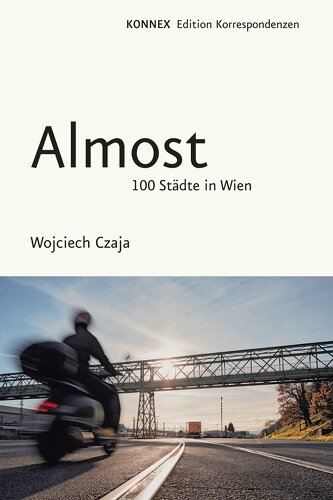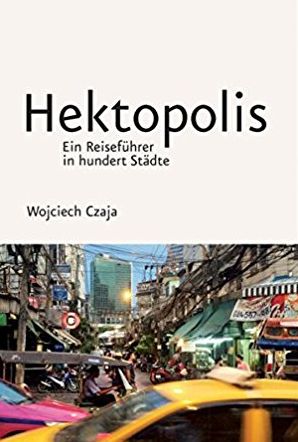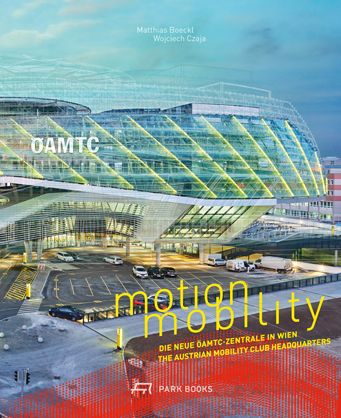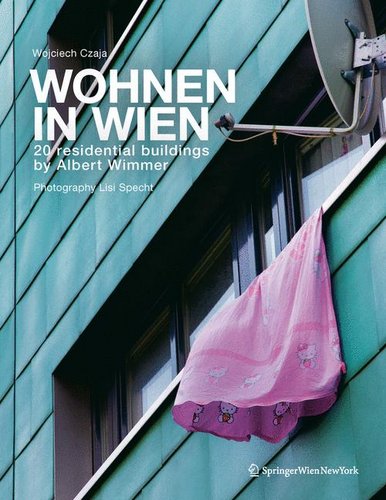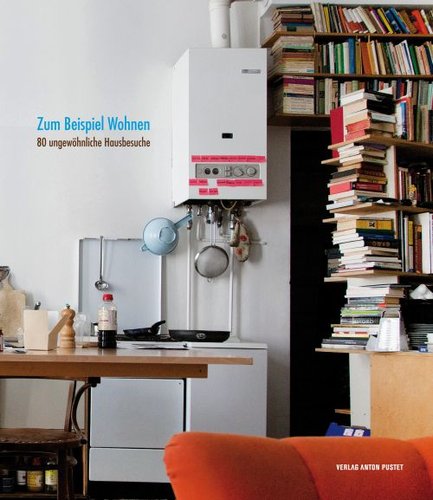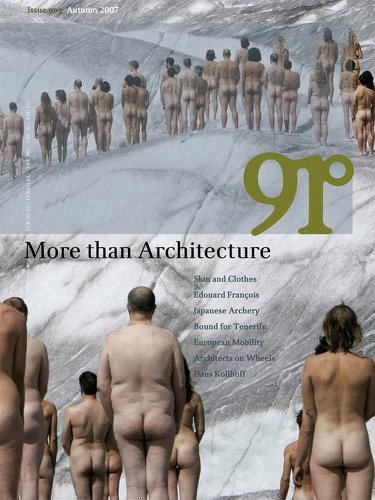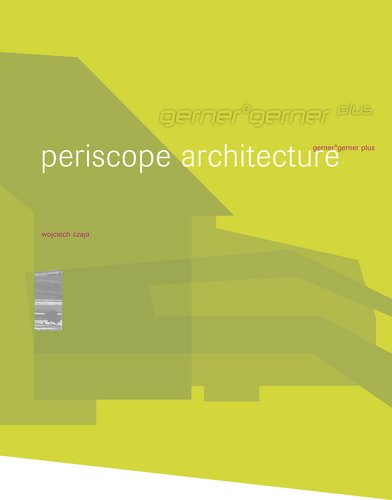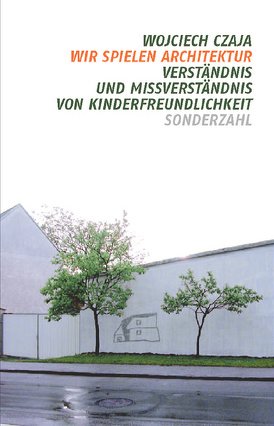Gestern glänzende Motor City, seit Juli bankrott. Ein großes Raunen geht um die Welt. Alles schon gehört. Oder doch nicht? Detroit nach der Pleite: wie eine neue Stadt in der Stadt entsteht.
Gestern glänzende Motor City, seit Juli bankrott. Ein großes Raunen geht um die Welt. Alles schon gehört. Oder doch nicht? Detroit nach der Pleite: wie eine neue Stadt in der Stadt entsteht.
Es ist mucksmäuschenstill. Keine Menschenseele weit und breit. Nur ab und zu entweicht diesem gottlosen Ort ein Vogelgezwitscher, ein Grillengezirpe, irgendein plötzliches unheimliches Rascheln im Busch.
Ob da noch jemand wohnt? Ich meine, nicht in diesem Haus, sondern überhaupt in diesem Viertel? „Ihr mit eurem Ruinenporno! Natürlich leben hier noch Menschen“, sagt Nick Tobier. Der 44-Jährige, eine hagere Gestalt mit Lockenkopf und dem Grinsen eines Hochzeitsplaners, ist Architekturprofessor an der University of Michigan in Ann Arbor und entwickelt Überlebensstrategien für die wenigen noch verbliebenen Einwohner in den Suburbs. „Meist sind es ältere Bewohner ohne Familie, die sich weigern, ihre alten Häuser zu verlassen und in eine bessere, noch funktionierende Gegend zu ziehen. Doch solange diese Menschen hier leben, sind die Neighborhoods noch lange nicht tot.“
Knapp 80.000 Häuser im Stadtgebiet Detroit stehen leer und rotten vor sich hin. Es ist ein Häuserfriedhof bis zum Horizont, gefühlterweise ohne Anfang und ohne Ende. Manche davon, einst klassische Suburbian Homes wie überall in den USA, haben kein Dach, andere keine Fenster und Türen, wiederum andere sind nur noch in eingestürzten, verkohlten Fragmenten vorhanden. Das Abfackeln verwaister Holzhäuschen, muss man nämlich wissen, ist ein beliebter Sport unter Jugendlichen. In der Devil's Night, der Nacht vor Halloween, ziehen sie in Banden durch die Straßen und setzen alte, leerstehende Ruinen in Brand. „Die Zahl der Brandstiftungen war bereits rückläufig“, sagt Nick. „Seit 2010 nimmt die Lust am Zerstören aber wieder zu. Wer will schon Süßes oder Saures, wenn er auch ein kleines Flammeninferno haben kann?“
Von Jahr zu Jahr verändert Detroit sein Gesicht, schrumpft, wird immer toter und toter. Waren es 1950, in der Hochblüte von General Motors, Chrysler und Ford, noch zwei Millionen Menschen, die hier lebten, sind es heute nur noch 680.000. Zwei von drei Einwohnern sind bereits weg. „Der Verfall Detroits ist seit Jahrzehnten zu beobachten, und in den letzten Monaten wusste schon jeder, dass der Bankrott unausweichlich ist“, sagt Nick. „Doch jetzt, seitdem es offiziell ist und Bürgermeister Dave Bing handlungsunfähig und mundtot gemacht wurde, schaut uns das ganze Land dabei zu, wie wir am Ende sind. Es ist demütigend.“
Miserabel: Platz eins für Detroit
18 Milliarden US-Dollar (rund 14 Milliarden Euro) an Verbindlichkeiten hat die Kommune nach Berechnungen des Insolvenzanwalts Kevyn Orr angehäuft. Das ist die mit Abstand größte US-Stadtpleite aller Zeiten. Detroit war einmal die reichste Großstadt Amerikas. Heute ist sie nicht nur die ärmste, sondern auch diejenige mit der höchsten Kriminalität: 2137 Gewaltverbrechen pro 100.000 Einwohner, darunter 344 Morde, Aufklärungsrate weniger als zehn Prozent. Hinzu kommen rund 19 Prozent Arbeitslosigkeit. In einigen Stadtvierteln, schätzt man, ist sogar jeder Zweite ohne Job. Laut Wirtschaftsmagazin Forbes, rankinggeil wie immer, liegt „The D“, wie Detroit von seinen Bewohnern auch genannt wird, aktuell auf Platz eins der miserabelsten Städte Amerikas.
Nick kriegt das Grinsen nicht weg. Seine Stimme ist immer noch von guter Laune getragen. Bei manchen Worten gluckst sie unüberhörbar nach oben. „Aber wir sind nicht am Ende! Denn die jetzige Situation, so dramatisch sie für einen Außenstehenden auch scheinen mag, ist endlich wieder eine Chance für einen Neubeginn. Die Stadt kann sich neu positionieren. So ähnlich wie seinerzeit Berlin.“ An der Ecke Kercheval und Meldrum Street, im sogenannten „Black Bottom“ im Osten der Stadt, wo die wenigen verbliebenen Einwohner fast zur Gänze afroamerikanischer Abstammung sind, ist ein selbstgebasteltes Holzschild in den Boden gerammt: „Earthworks Urban Farm and Soup Kitchen“. Dahinter Büsche und Gemüse, dutzende Meter weit.
„Hey Brother“, sagt Daryl Howard, Latzhose, Wollmütze, Erde unter den Fingernägeln. Was sagt man da zurück? Hey? Hey! Howard kommt frisch von der Arbeit, die Mittagspause hat gerade angefangen. „Hunger? Es gibt Rübensuppe, Organic Sandwich und Salat. Komm rein in unsere kleine Welt!“ Earthworks ist ein selbstfinanzierter Verein, der 1997 gegründet wurde und mittlerweile sieben Farmen in ganz Detroit umfasst. Er kümmert sich um Anbau von Obst und Gemüse, er bietet Kochkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, vor allem aber verarbeitet er Tag für Tag seine eigene Ernte und bittet Hungrige zu Tisch. „Soup Kitchen“, öffentliche Suppenküche für alle, nennt sich das Ganze. Das Essen ist umsonst.
„Viele von uns kennen Essen nur in Form von Fastfood und eingeschweißtem, vakuumverpacktem Processed Food von der Tankstelle“, sagt Daryl. „Und das ist eine Katastrophe. Erstens wird man davon nicht satt, zweitens führt das über kurz oder lang zu Krankheiten, die keiner haben will.“ Viele Detroiter, die im Black Bottom zu Hause sind, leiden an Diabetes. Die Lage ist dramatisch. „Unser größtes Problem sind in Wahrheit nicht die leeren Häuser und nicht die fehlenden Jobs, über die jeder klagt, sondern die alltägliche Lebensmittelversorgung.“
Detroit ist heute eine sogenannte „Food Desert“. Das bedeutet: Mehr als 75 Prozent aller Einwohner müssen mehr als eine Meile zurücklegen, um an frische, gesunde Nahrungsmittel zu gelangen. Weit und breit kein Supermarkt. Zumindest nicht hier, am schwarzen Boden, wie alle sagen. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Drittel aller Detroiter kein Auto besitzt. Zu teuer. Auf den öffentlichen Bus kann man sich auch nicht mehr verlassen. Einmal pro Stunde fährt er von nirgendwo nach nirgendwo. Wenn er denn überhaupt kommt. Und so haben die Menschen keine andere Wahl als zu Exxon, Texaco, Citgo, Shell oder Mobil zu wandern. Die gibt's an jeder Ecke. Immer noch. Erstaunlich.
Oder sie spazieren zur nächsten Urban Farm. „Ja, ich weiß, bei euch in Europa, in London, Paris und Berlin, gibt's diesen Trend auch“, sagt Daryl. „Doch hier in Detroit ist Urban Farming weder chic, noch legen wir besonders Wert darauf, dass alles bio ist. Wir wollen einfach nur satt werden.“ Mit Erfolg, wie sich unter dem Jeanslatz erkennen lässt. „Ohne die vielen leerstehenden Grundstücke und die Möglichkeit, selbst Obst und Gemüse anzubauen, wären wir hier wahrscheinlich längst verhungert.“ Neben Earthworks gibt es im Stadtgebiet Detroit heute einige hundert Gemüsefarmen. Zusammen produzieren sie rund 170 Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr. Das entspricht einem Marktwert von einer halben Million US-Dollar, rund 375.000 Euro.
Zwei, die schon seit einigen Jahren Urban Farming betreiben, sind Heather und Barry Nelson. Sie ist 58 und ehemalige Spanischlehrerin. Er ist 70 und war früher in der Kommunikationsbranche tätig. Mehr will er nicht verraten. Sie leben in einem Two-Bedroom-Apartment, nicht weit von hier. Regelmäßig stecken sie ihre Hände in die Erde und sind ehrenamtlich für diejenigen tätig, denen es nicht so gut geht. „Wir bauen Tomaten, Kürbis, Kohl, Kraut, Spinat und diverse Salate an, doch am liebsten haben wir Okraschoten. Unglaublich, was man daraus alles machen kann!“
In den letzten 20, 30 Jahren, sagen Heather und Barry, hätten sich die Städte im Rust Belt massiv verändert. Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo, Toledo, Erie und wie sie nicht alle heißen mögen. Allein in den Nullerjahren sind im Rust Belt mehr als 320.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. Aber einen Vorteil hat die postindustrielle Transformation, die über die einstigen Stahlhochburgen wie ein rostiger Gewitterhimmel herzieht: „Ich kann mich nicht erinnern, wann man in einer amerikanischen Großstadt zuletzt so unmittelbar in und mit der Natur gelebt hat. You know what I mean?“
Ungewollterweise ist Detroit heute wahrscheinlich die grünste Metropole der Welt. Von den 360 Quadratkilometern Stadtfläche - das entspricht der Fläche von Boston, San Francisco und ganz Manhattan - sind heute mehr als 100 Quadratkilometer leer. Da, wo einst glückliche Vorstadthäuser mit glücklichen Fords und Chevrolets in der Auffahrt standen, ist heute dichtes, dickes Grün. Großstadtdschungel - was für eine verbale Ironie des Schicksals! Die Straßen, die wie eine karierte Matrix durch den grünen Teppich führen, wirken befremdlich. Noch befremdlicher jedoch als die Asphaltschneisen sind die Gehsteige mit ihren abgesenkten Rollstuhlrampen im Kreuzungsbereich und den erdbeerroten, einbetonierten Noppenbelägen für Blinde. Das Bild ist skurril.
„Ach, die Gehsteige in den Suburbs“, stöhnt John Baran, Executive Manager im Department für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Detroit. „Eine absurde Story, erinnern Sie mich nicht daran!“ Nach einer Klage, die der Behindertenverband gegen die Stadt Detroit eingebracht hatte, musste diese sämtliche Kreuzungen im Stadtgebiet barrierefrei umbauen, also rollstuhlbefahrbar ausführen und blindentauglich mit einem Tastleitsystem ausstatten. Und zwar überall. Die Umbaumaßnahmen haben sich über Jahre gezogen und haben einige Dollarmillionen verschlungen.
Straßennamen: deleted
„Die Stadt schrumpft in einem rasanten Tempo und verändert sich von Tag zu Tag, man kann dabei förmlich zusehen“, sagt Baran. „Wir kommen mit den Plankorrekturen kaum noch nach.“ Der aktuelle Detroiter Stadtentwicklungsplan stammt aus dem Jahr 1992, als die Stadt noch mehr als eine Million Einwohner hatte. Für einen neuen Masterplan fehlt das Geld. Doch man weiß sich zu helfen: Alle sechs Monate steigen die Mitarbeiter ins Auto und kurven durch die aussterbenden Quartiere, um die leeren Straßenblocks zu scannen. Wo der Verlust verkraftbar ist, werden die Straßennamen einfach aus der Datenbank gelöscht.
„Eigentlich gäbe es für uns so viel zu tun, aber uns fehlt einfach das Geld“, meint Baran. „Das war auch vor der Pleite schon so.“ Nachdem diejenigen, die es sich leisten können, die Stadt verlassen und stattdessen in die Suburbs oder in irgendeine andere Stadt ziehen, wird Detroit nach und nach um seine Steuereinnahmen gebracht. In den letzten zehn Jahren, rechnet Baran vor, seien die Einnahmen in einigen Vierteln um bis zu 78 Prozent zurückgegangen. Früher, als noch ausreichend Geld in der Stadtkasse war, wurden die verlassenen Häuser, die meist einsturzgefährdet sind und somit eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen, noch auf eigene Kosten abgerissen. 7000 Dollar kostet die Abrissbirne samt Entsorgung. Das ist nun Geschichte.
„Wir haben keine Wahl“, erklärt Baran. „Einen Teil der Stadt müssen wir sich selbst überlassen und an die Natur zurückgeben.“ Resizing, Rückdimensionierung, heißt das im Amtsjargon. Dazu gehört auch, dass einige Quartiere, in denen nur noch ein paar vereinzelte Seelen leben, sogenannte Ganglands, von der Stadtverwaltung aufgegeben werden. Buslinien werden gekappt, Schulen werden geschlossen, Straßenlaternen werden ausgeschaltet.
Außerdem werden die urbanen Löcher nicht mehr versorgt, werden weder von der Müllabfuhr noch von der Feuerwehr und Polizei angefahren. Auch dann nicht, wenn Schüsse und Schreie zu hören sind und ganze Häuserreihen in Flammen stehen. 58 Minuten, ist dieser Tage zu lesen, brauchte die Detroiter Polizei heuer im Durchschnitt, um auf einen Notruf zu reagieren. Die schockierende Zahl ist leicht erklärt: In wohlhabenden Stadtvierteln wie Indian Village, Dearborn Heights, Palmer Park und Oakland County war sie schnell wie eh und je. Den Black Bottom aber, den fährt sie gar nicht mehr an.
Viele Detroiter, allen voran junge Kreative, machen sich diese anarchischen Zustände zunutze. Überall hört man: Berlin, Berlin, Berlin, das große Vorbild. „Say nice things about Detroit“, mit einem Herzchen als i-Punkt, ist an eine weiße Hausmauer gesprayt. Und das tun sie, das tun sie alle. Jaclyn Strez, 27 Jahre alt und noch voller Optimismus, leitet den kleinen Non-Profit-Kunstverein Detroit Contemporary. Sie ist Schauspielerin, Künstlerin und lebt seit gut 15 Jahren in Michigan. Das Haus selbst, früher mal ein Supermarkt, wird von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Garten wird Gemüse angebaut, das Erdgeschoß wird für diverse Veranstaltungen genutzt, und oben im ersten Stock pennen ein paar Artists in Residence. Alles hier ist ein bisschen abgefuckt. „Nein, rosig ist es in Detroit nicht“, sagt Jaclyn. „Aber als Künstlerin habe ich genug Fantasie, um mir eine positive Zukunft dieser Stadt auszumalen. Und das Gute ist: So wie ich denken viele hier.“ Auch diverse Privatinvestoren nehmen sich Detroits an. In erster Linie investieren sie dort, wo die Stadt einspart: in Schulen.
Ein paar Blocks weiter liegt die Heidelberg Street, eine bunt bepinselte Straße, die als Outdoor-Galerie genutzt wird. Die Häuser sind gepunktet und gestreift, in einem der Gärten steht ein ausrangierter Saab mit Santa Claus am Steuer (ein schwedisches Auto in Detroit, tatsächlich), an die Bäume sind Teddybären geknebelt, und überall Kunstinstallationen und halb vergrabene Artefakte. Heidelberg Project, so der offizielle Name der 1986 gegründeten Initiative, sieht aus wie die Manifestation eines LSD-Trips.
Notlage: Phönix aus der Asche
„Dafür liebe ich diese Stadt“, sagt Noah Resnick, Designerbrille, Vintage-Sakko, der Typ Young Creative Industrial mit viel Kritik in den Augen und viel Intellekt auf der Stirn. „Natürlich identifiziert sich Detroit offiziell immer noch als Motor City. Das muss sie wohl. Aber hinter diesem abgewrackten, verrosteten Image wächst langsam eine Stadt in der Stadt heran, die in den USA ihresgleichen sucht.“ Das mit dem Motor, so Resnick, ist Geschichte. Das neue Detroit kehrt den Pferdestärken den Rücken und tritt in die Pedale.
Einige Radfabrikanten wie etwa Detroit Bikes, die den kaum ausgelasteten Werken billigen Stahl abkaufen, sind in den letzten Jahren entstanden. Und Wheelhouse, ein 2010 gegründeter Verein, der geführte Radtouren zu den Themen Architektur, Graffitikunst und Urban Farming organisiert, zählt mittlerweile 5000 Mitglieder, Tendenz steigend. „All diese Impulse bringen der Stadt einen Aufschwung“, sagt Noah. „So etwas lässt sich nicht top-down planen. So etwas kann nur bottom-up aus der Not heraus entstehen.“
Mitte 2011 hat das Hostel Detroit aufgesperrt, eine Jugendherberge mit neun Zimmern und psychedelisch bemalter Ziegelfassade. Das kunstsinnige Etablissement liegt im Nordwesten, rund einen Kilometer von der Wayne State University entfernt. Das billigste Bett kostet 27 Dollar pro Nacht. „Wäre Detroit eine bequeme Stadt ohne Probleme, so wie jede andere Stadt in den USA, dann würden wir stagnieren, dann wäre es niemals zu dieser Aufbruchstimmung gekommen“, sagt die 29-jährige Managerin Taylor Kozak. „Doch nun müssen wir kreativ sein, müssen ein Leben nach dem Do-it-yourself-Prinzip führen.“ Die Insolvenz, die vor wenigen Wochen angemeldet wurde, so Taylor, habe diese DIY-Bewegung lediglich beschleunigt. Die Milliardenpleite, man hört es aus ihrer Stimme heraus, hat etwas Großartiges.
Katja Kullmann, eine Hamburger Autorin, die letztes Jahr ein paar Wochen in Detroit verbrachte, schlägt vor, indem sie einen Immobilieninvestor aus New York zitiert: Man solle Detroit einfach mit 100.000 Künstlern aus aller Welt fluten. Kreativität und Bildungsboheme, so lauten die Zauberworte für den Neubeginn. „Die kreative Klasse ist längst im Operation-Mode“, schreibt sie in ihrem 2012 erschienenen Detroit-Buch Rasende Ruinen. „Mit ihren Geistesressourcen und ihrer (potenziellen) Kaufkraft bildet sie die gesellschaftliche Schlüsselmacht der Zukunft.“ Und der amerikanische Sachbuchautor John Gallagher meint: „Keine andere Stadt in den USA bietet eine so große Leinwand für neues Denken wie Detroit.“
Auf dem amtlichen Siegel der City of Detroit sieht man zwei stoische Damen, die im Garten stehen und sich (man möchte meinen: verzweifelt) an den Kopf greifen. Rund um die Zeichnung sind die lateinischen Worte zu lesen: „Speramus meliora. Resurget cineribus.“ Wir erhoffen Besseres. Möge es aus der Asche auferstehen.
Der Standard, Sa., 2013.08.17