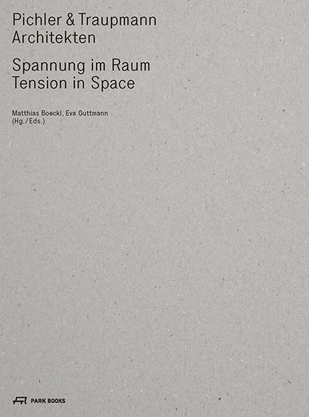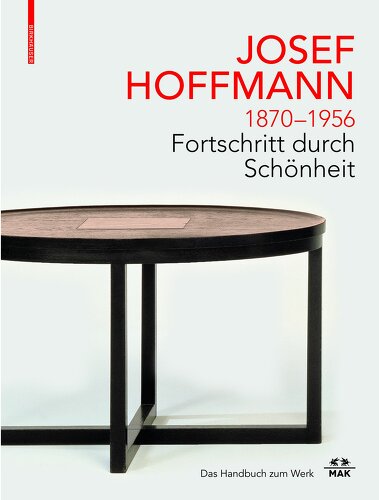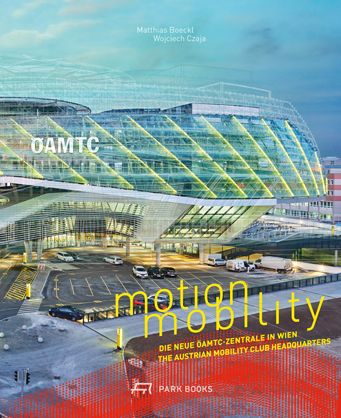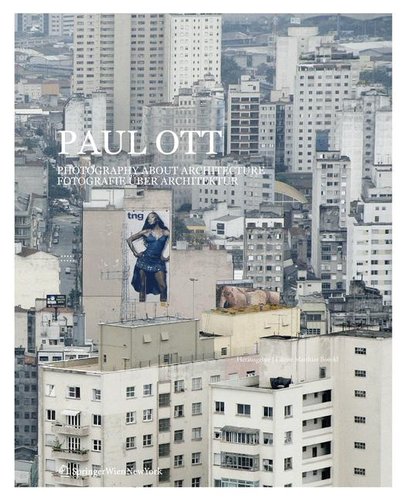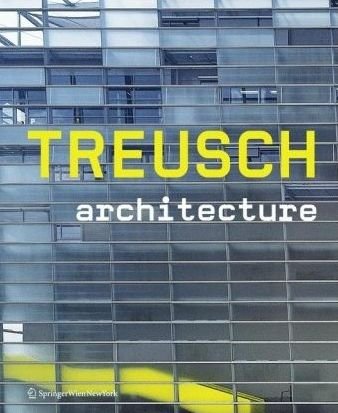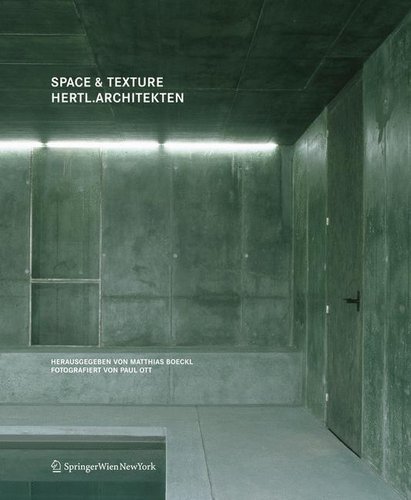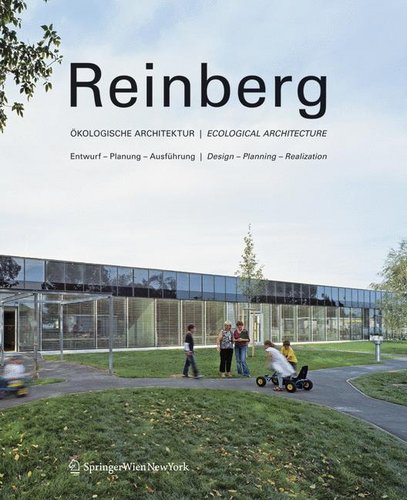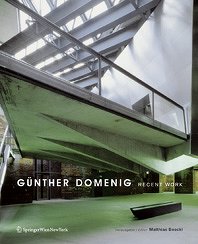Städtebau als Kommunikations-Kunst
Ist es noch Illusion oder schon Realität des postindustriellen Medienzeitalters, dass ein grundlegender und nachhaltiger Stadtumbau eher durch „weiche“ Kulturfunktionen als durch traditionelle „harte“ Jobfaktoren wie Industrie und Gewerbe gelingen kann?
Ist es noch Illusion oder schon Realität des postindustriellen Medienzeitalters, dass ein grundlegender und nachhaltiger Stadtumbau eher durch „weiche“ Kulturfunktionen als durch traditionelle „harte“ Jobfaktoren wie Industrie und Gewerbe gelingen kann?
Die „europäische Kulturhauptstadt Graz 2003“ bietet viele Antworten auf brennende Fragen der aktuellen Stadtdebatte wie diese. Sie versteht sich, worauf Wolfgang Lorenz, Fernsehmacher und Programmintendant der Hauptstadt-Veranstaltungen, insistiert, eben nicht als „Festival“, sondern als eine Art Bewegung zur Formulierung einer neuen Stadtidentität, eines neuen Selbstverständnisses der Grazer.
Die Probleme einer Kulturhauptstadt
Der Anlass für die zahlreichen Maßnahmen im Bereich Architektur und öffentlicher Raum war die Ernennung zur (einzigen) „Kulturhauptstadt“ Europas für das Jahr 2003. Was das bedeutet, weiß niemand, denn mit der Ernennung ist keine feste Programmplanung verbunden. Jede Stadt muss ihre Inhalte selbst definieren.
Jede Stadt hat aber auch andere Problemlagen, manche Städte haben intakte urbane Strukturen, funktionierende öffentliche Institutionen und Infrastruktur, ausreichend Arbeitsplätze, Wohnungen und Freizeiteinrichtungen, viele jedoch nicht.
Zwischen bürgerlicher Idylle und Avantgarde
Was waren die „Probleme“ von Graz vor der „2003“-Bewegung? Die Landeshauptstadt der Steiermark hatte unter den europäischen Städten mittlerer Größe (226.244 Einwohner) schon bisher eine eigenartig ambivalente Positionierung. Graz, das stand lange Zeit für eine gewisse Isolierung in der südöstlichen Ecke des „freien“ Europa.
Graz lebte stets aus ziemlich eindeutigen Gegensätzen. Hier die beeindruckende Altstadt und die konservative Bourgeoisie nebst untergründigen NS-Nostalgien, da die „Avantgarde“, die es leicht hatte, mit Realismus und Aktionismus jede bürgerliche Idylle zu verstören.
Stagnation in den 80er Jahren
Wirtschaftlich stand die Stadt stets unter dem starken Einfluss ihrer großen Industriebetriebe und ihrer natürlichen Funktion als administratives Regionalzentrum. Beides wirkte sich eher konservierend aus, bis in die 1980er Jahre waren hier kaum Faktoren wirksam, die zu einer regelrechten Stadttransformation hätten führen können.
Kultur als urbaner Kick-Off?
Mit den Projekten zu „Graz 2003“ könnte der Kick-Off zu einer wirklich zeitrichtigen Stadtentwicklung entstanden sein. Und hier hat man die Chance, bereits aus den Gefahren des „New Economy“-Hype zu lernen.
Keine Kultur ausschließlicher Virtualität künstlich hochzufahren, sondern das Kunststück zustande zu bringen, physisch greifbare Stadtinterventionen in Form von Bauten und Infrastruktur mit der „virtuellen“ Stadt einerseits und dem gewachsenen Bestand andererseits derart zu verweben, dass (etwa durch Kulturtourismus) sowohl rasche Aufwertungseffekte entstehen als auch Keime für nachhaltige Entwicklungen und die Möglichkeit der Änderung und Anpassung der nun entworfenen Strukturen.
Quadratur der Kreises
Das klingt nach der Quadratur des Kreises, in der Praxis zeigt sich aber, dass Stadtumbau durch Kulturfunktionen tatsächlich die eminente Gefahr der Reduktion einer historischen Kernstadt auf eine nur saisonal genutzte und von langjährigen Einwohnern klinisch gesäuberte Kulisse für den Tagesausflug der kulturinteressierten A-Schicht oder den einfachen Bummel anderer Besucher wird. Diese Gefahr ist in Innsbruck und Salzburg bereits zur Realität der Verödung der historischen Kernstadt geworden.
Wende durch Termindruck
„Graz 2003“ brachte weniger durch einen langjährig von Stadtplanern erarbeiteten Masterplan die (hoffentlich funktionierende) Wende zustande, sondern eher durch den Termindruck, der die Stadtverwaltung förmlich zwang, den Ideen von Programmintendant Lorenz zu folgen, um nicht zum Eröffnungszeitpunkt ohne spektakuläre Events und Institutionen dazustehen.
Neues Bauen in Graz
An Bauten entstanden sowohl Projekte, die direkt auf Initiative der Programmplanung zurückgehen als auch solche, die gleichsam parallel dazu mit Rückenwind des zunehmend dynamischen Planungsgeschehens von unabhängigen Bauträgern errichtet wurden.
Das Bauspektrum umfasst das Literaturhaus von Riegler Riewe, die Stadthalle von Klaus Kada, die „Listhalle“ von Markus Pernthaler, das Kindermuseum von fasch & fuchs, das Kunsthaus von Cook & Fournier (ein Joint Venture von Bund, Stadt und Land, ohne Beteiligung des Programmbudgets für Graz 2003), die von der Bundesbahn vorgezogene Bahnhofsrenovierung von Zechner & Zechner mit der Kunstintervention von Peter Kogler, die Murinsel von Vito Acconci, die Gestaltung der Stadteinfahrten durch mehrere junge Architektengruppen, die Umbauten am Flughafen von Markus Pernthaler, der ironische „Uhrturmschatten“ von Markus Wilfing, zahlreiche Großplastiken im öffentlichen Raum unter dem Titel „Concrete Art“, das Café „Graz 2003“ von Hans Gangoly und der „Marienlift“ bei einer barocken Mariensäule von Richard Kriesche. Und nun wurde auch das Volkskundemuseum der jungen Architektengruppe BEHF eröffnet.
Identifikationsfaktor Kultur
Diesmal sollte das Kulturprofil der Stadt nicht unabsichtlich entstehen, wie das in jenen seligen Avantgardejahren der Fall war, als Graz seine Kunstschaffenden eher als Plage empfand, die nur noch mehr ähnliche Plagegeister anzog. Sondern es wurde bewusst auf eine hochwertige kulturelle Infrastruktur gesetzt, mit der sich alle Grazer identifizieren sollten und die zumindest eine Chance auf zukünftige Plattform weiterer Entwicklungen bot.
Vito Acconcis Event-Arena
Das Motto „für jeden etwas“ scheint der Schlüssel für eine breite Identifikation der Bevölkerung mit dem Gebotenen zu sein, das dadurch zu einem Erarbeiteten wird. Und in dieser Unbekümmertheit entstanden fast beiläufig oder zufällig die städtebaulich interessanten Kunst-Verdichtungen. Eher intuitiv scheint im Intendanten die Erkenntnis gereift zu sein, dass die Mur, jener Fluss, der die Stadt in zwei ungleichwertige Hälften teilt, das Gelenk und der Brennpunkt einer integrierenden Neudefinition sein muss.
Das Angebot des New Yorker Universalkünstlers Vito Acconci, eine künstliche Insel im Fluss zu errichten, lag bereits längere Zeit vor, als Lorenz plötzlich sein Potenzial erkannte. Mit dieser räumlichen Verbindung zwischen den traditionellen Kulturstätten der Innenstadt und der eher gewerblich-industriell orientierten „anderen“ Flussseite konnten - neben der gelungenen Stadtstimulation - gleich mehrere Effekte erzielt werden.
Neues Kunsthaus
Das neue Kunsthaus, ein regionales Museum moderner Kunst, das auf eine lange und traumatische Planungszeit in mehreren Wettbewerben an immer wieder verworfenen Standorten zurückblickt, war bereits unter dem Erfolgs- und Termindruck des Hauptstadtjahrs auf dieser „anderen“ Seite angesiedelt worden. Gleich daneben befindet sich schon seit langem ein weiteres Kunstzentrum: Die Veranstaltungsräume der Minoriten, die hier seit Jahrzehnten einen gut eingeführten Kunstplatz betreiben.
Diese beiden Häuser ließen sich nun durch die Insel nicht nur gut mit der am anderen Flussufer liegenden Altstadt verbinden. Das muschelförmig-bizarre Stahlobjekt von Acconci, das halb eingeschlossener Raum, halb ausgehöhlte Event-Arena ist, definiert auch seinen eigenen Raum, besetzt den bislang als Niemandsland und als Zäsur fungierenden Fluss, und es generiert in seinem Umfeld neue Wege, eine Aufwertung des Umfeldes und neue Sichtachsen. „Es ist heute unvorstellbar für alle, dass diese Insel wieder demontiert wird“, sagt Lorenz, „es ist ein Herzstück von Graz 2003, das kräftig schlägt, wir haben hunderttausende Besucher auf dieser Insel gehabt, es ist immer voll.“
[Graz 2003 als Bewegung zur Formulierung einer neuen Stadtidentität? Den Originalbeitrag von Matthias Boeckl finden Sie in architektur aktuell.]
ORF.at, Mo., 2003.06.23