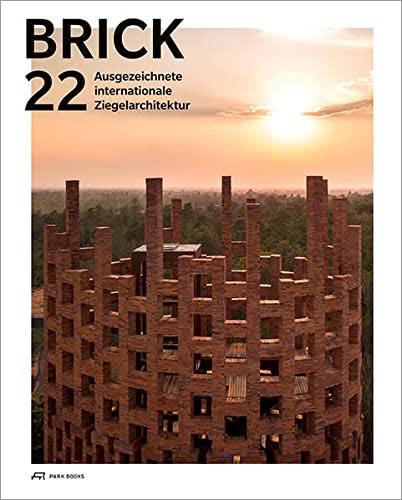Die Peripherie Roms litt in den letzten Jahrzehnten unter der Vernachlässigung durch die Stadtverwaltung, die sich auf das Zentrum konzentrierte. Der neue Piano Regolatore Generale (PRG), der 2008 in Kraft trat, revidiert das Bild der Stadt vom Zentristischen zum Polyzentristischen: Die Metropole birgt 200 Microcittà. Die peripheren Quartiere sollen nicht mehr ausfransende, wuchernde Auswüchse der Stadt, sondern identifizierbare Ortschaften sein.
Die Peripherie Roms litt in den letzten Jahrzehnten unter der Vernachlässigung durch die Stadtverwaltung, die sich auf das Zentrum konzentrierte. Der neue Piano Regolatore Generale (PRG), der 2008 in Kraft trat, revidiert das Bild der Stadt vom Zentristischen zum Polyzentristischen: Die Metropole birgt 200 Microcittà. Die peripheren Quartiere sollen nicht mehr ausfransende, wuchernde Auswüchse der Stadt, sondern identifizierbare Ortschaften sein.
Fünf Piani Regolatori Generali (PRG)[1] hat die Stadt Rom bisher gehabt: Diejenigen von 1873 und 1883 fielen in die Regierungszeit König Umbertos I. Der Plan von 1909 war der erste, der nicht mehr unter aristokratischer Führung, sondern unter der Leitung einer von demokratischen, republikanischen und sozialistischen Kräften getragenen Administration entwickelt wurde, an deren Spitze der Bürgermeister Ernesto Nathan stand. Nach seinem Urheber Edmondo Sanjust als «Piano Sanjust» bezeichnet, wurde der Plan für eine Bevölkerung von einer Million dimensioniert (1908 hatte Rom knapp 600 000 Einwohner). 1931 – die Stadt war nunmehr auf über eine Million Einwohner angewachsen – wurde der Perimeter ausgedehnt und eine Einwohnerzahl von zwei Millionen anvisiert. Roms Gouverneur Boncompagni Ludovisi präsidierte die Kommission, die den Plan ausarbeitete. «[…] die hehren Versicherungen, das historische Zentrum nicht anzutasten, [wurden] den Bedürfnissen des Strassennetzes geopfert», schrieb dazu der Architekt Piero Ostilio Rossi.[2] In der Folge setzten die Faschisten zu den grössten«sventramenti» (Ausweidungen) der Geschichte der Stadt an – unter anderem um die Schneise der Via dei Fori Imperiali zu legen.
1962 schlug die Geburtsstunde der «asse attrezzato» – eine Schnellstrasse, die in Nord- Süd-Richtung die Autostrada del Sole mit dem EUR (Esposizione Universale di Roma) verbinden sollte.[3] An diese Achse sollte das Sistema Direzionale Orientale (SDO) andocken, ein gigantisches Überbauungsprojekt in der östlichen Suburbia der Stadt, in dem die Funktionen der öffentlichen Hand – Ministerien, Verwaltung etc. – hätten konzentriert werden sollen, um das historische Zentrum zu entlasten und durch den frei werdenden potenziellen Wohnraum seiner Verwaisung Einhalt zu gebieten. Man bot Kenzo Tange auf, um das Projekt zu planen, Urheber des Ende der 1980er-Jahre errichteten Centro Direzionale in Neapel. Gegliedert wurde das SDO in vier Zonen: Pietralata, Tiburtina, Casilino, Centocelle. Doch diese Planung bleib in den Anfängen stecken und kam nicht über eine Rumpfbebauung im EUR und auf dem ehemaligen Flughafen von Centocelle hinaus. Daher wurde auch vier Jahrzehnte später und obwohl nun, ab 1993, ein neuer PRG in Arbeit war, noch über die «asse attrezzato» gestritten. Das SDO blieb der Papiertiger einer technokratischen und fortschrittsgläubigen Epoche. Mit dem neuen PRG, über dem nun, da Francesco Rutelli das Bürgermeisteramt antrat, die «grüne» Flagge wehte, wurde das SDO auf eine «centralità urbana» im Quartier Pietralata reduziert, verbunden mit dem Ausbau des Bahnhofs Tiburtina für Hochgeschwindigkeitszüge (Alta Velocità). Gleichzeitig wurde die Nord-Süd- Achse ad acta gelegt und durch ein tangentiales Erschliessungssystem ersetzt, das vor allem auch auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs basieren sollte.
«19 Städte, eine einzige Metropole»
Motor dieses Richtungswechsels ist die radikale Revision der Idee von Stadt, die nun rund 6 Millionen Einwohner umfasst – mehr als die Hälfte davon in der Peripherie: Ging die Planung im Gefolge des Piano Regolatore der 1960er-Jahre von der Erweiterung nach aussen aus, vom Wachstum durch Neubau und Neuerschliessung, steht hinter dem neuen Planungsinstrument die Devise der Aufwertung nach innen, innerhalb des Stadtgewebes. Und die zentralistische Auffassung von einer Kapitale weicht der Vision eines polizentristischen Stadtgebildes, in dem nun auch die Peripherie stärkeres Gewicht hat. In Anlehnung an die verwaltungstechnische Gliederung in 19 Municipi will die Stadt ihr Image von der Metropole zur «19 città una sola metropoli» («19 Städte, eine einzige Metropole ») wandeln.[4] Die reale Bebauungsstruktur der Stadt findet ihren Niederschlag in dem Bild eines Haufens von «microcittà», deren 200 identifiziert werden (Abb. 2 und 3).
Es werden 18 «urbane Zentren» definiert, nahezu eines pro Municipio (Stadtbezirk), und 60 Ortszentren («Centralità locali») destilliert und im neuen Piano Regolatore festgelegt.[5] Sie bilden die Knotenpunkte der lokalen Identität, der Prozesse der Modernisierung und der Qualitätssicherung der Perpherie – mittels öffentlicher Einrichtungen, Anbindung an den ÖV, Bau von Kulturzentren und Verbesserung der Qualität der Grünzonen. Der neue PRG brachte aber noch eine weitere Einsicht: dass nicht nur das Planungsinstrument von der zentralistischen Doktrin abrücken muss, sondern auch der Planungsprozess kein zentralistisch geführter sein und nicht Top-down verlaufen darf, sondern der Einbindung der Planungsinstanzen der Region und der Municipi sowie der Bewohner bedarf.
Identität und Katalysator
In diesem Kontext sind die verschiedenen Programme des Dipartimento XIX – Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie zu sehen[6]: territoriale Laboratorien, Quartiervereinbarungen, Plätze und öffentlicher Raum, Zonen mit einst widerrechtlicher Bebauung, Programme zur städtebaulichen Aufwertung, ökologische Entwicklung, Kulturzentren in der Peripherie sowie Landschaft und Identität der Peripherien. Leitmotiv des Programms «Paesaggi e identità delle periferie» (Landschaft und Identität der Peripherien) ist der Gedanke, den traditionellen Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie aufzubrechen. Es verfolgt zwei Intentionen: Zum einen soll die Identität der Ortszentren, der Microcittà, gestärkt, zum andern ihre Integration in die Stadt gefördert und der Segregation vorgebeugt werden. Auf der einen Seite soll also der Charakter der urbanen Inseln im Meer des Grünraums, von dem die Peripherie nach wie vor durchzogen ist, betont, auf der andern sollen sie ans Zentrum der Stadt angedockt werden. Die ausgeworfenen Anker beschränken sich nicht auf die Anbindung an den öV und das Strassennetz. Vielmehr soll durch die Verbesserung der städtebaulichen Qualitäten und die Förderung der wirtschaftlichen Kapazität die Grundlage gelegt werden, um stabile Nachbarschaften zu bilden – Gemeinschaften, die ebenso selbst- wie des Gefühls bewusst sind, Teil eines grösseren Ganzen, der Stadt Rom, zu sein. Die Viertel der Peripherie sollen nicht mehr als auf das Zentrum bezogene Entlastungsstandorte, sondern als eigene «Ortschaften» begriffen werden. Daher wird versucht, auf den Ort einzugehen, sowohl inhaltlich als auch in der Wahl der Mittel. Inhaltlich wird nach Eigenheiten geforscht, die den Orten wieder eine Identität geben können: Landschaftliche Qualitäten wie die Weinberge im Prato Fiorito (vgl. «Blumenwiese», S. 48 ff.), bauhistorische oder archäologische Zeugnisse wie das Aquädukt im Quartier Alessandrino (vgl. «Aquädukt », S. 51 ff.), ein kulturelles Ereignis wie die Friedensdemonstration in den 1960er-Jahren in Colline della Pace oder ein einst prägendes, aber mit den Jahren verwässertes städtebauliches Konzept wie die Brücken im Laurentino 38 (vgl. «Inseln und Brücken», S. 40 ff.). «Paesaggi e identità delle periferie» hat ausserdem eine Katalysatorfunktion für die anderen Programme des Dipartimento XIX. So engagierte sich in Prato Fiorito auch das Programm für Zonen mit einst widerrechtlicher Bebauung und in Laurentino das Programm zur städtebaulichen Aufwertung. Eingebunden ist es ausserdem in die Errichtung von 20 Kulturzentren, die mit je eigenem inhaltlichen Schwerpunkt (Sport, Kultur, Ökologie) als Kristallisationspunkte der Quartiersentwicklung helfen sollen.[7]
PS: Ob und inwiefern die Peripherie nach dem Regierungswechsel einen Spitzenplatz auf der politischen Agenda halten kann? Den Verdacht, dass sich der Brennpunkt verschieben könnte, nährte Bürgermeister Gianni Alemanno mit der Ankündigung, das Kolosseum renovieren und «Fahrende» in Randgebiete umsiedeln zu wollen. Bis zu den Wahlen von Ende März bildete die mitte-links regierte Region Latium, die manche Projekte mitfinanziert, immerhin noch ein politisches Gegengewicht zu Gianni Alemannos Partito delle Libertà (PdL). Nun ist auch sie in der Hand einer Berlusconi-Anhängerin, Renata Polverini, und nur die Provinz Rom ist mit Nicola Zingaretti noch vom Partito Democratico (PD) besetzt.
Anmerkungen:
[01] Der Piano Regolatore Generale (PRG) ist einem Richtplan vergleichbar. Der PRG formuliert das Planungsleitbild und die Entwicklungsschwerpunkte der Stadt. Die Revision, die 2008 in Kraft trat, wurde 1993 an die Hand genommen
[02] P. O. Rossi: Roma – Guida all’architettura moderna 1909–2000. Editori Laterza, 2000, S. 65
[03] EUR (Esposizione Universale di Roma) wird heute ein Stadtviertel im Süden Roms bezeichnet, das nach dem Willen Mussolinis die Weltausstellung 1942 beherbergen sollte. Die ursprüngliche Bezeichnung lautete E42 (Esposizione Universale 1942). Städtebaulich verbindet es das historische Zentrum Roms mit dem Meer bei Ostia. Die Planung wurde Marcello Piacentini übertragen, der 1938 sein definitives Projekt vorlegte. E42 ist geprägt vom Spannungsfeld zwischen der Architektur des Razionalismo und neoklassischen Tendenzen, die auf die römische Baukunst der Antike zurückgreifen, aber auch Elemente der Pittura metafisica aufweisen. Vgl. Anm. 2, S. 248–249
[04] Bis 1992 war Rom in 20 Municipi (Stadtteile) gegliedert. Damals spaltete sich das XIV. ab und bildete die Comune di Fiumicino. Die Nummerierung aber wurde beibehalten und die 14 einfach übersprungen. Es sind nun also 19 Municipi, gezählt wird aber trotzdem bis 20.
[05] Die 18 metropolitanen und urbanen Zentren sind: Alitalia Magliana, Bufalotta, Eur Sud Castellaccio, Fiera di Roma, Ostiense, Pietralata, Polo Tecnologico, Ponte di Nona Lunghezza, Tor Vergata, Acilia, Madonnetta, Anagnina Romanina, La Storta, Massimina, Torre Spaccata, Cesano, Ponte Mammolo, Santa Maria della Pietà, Saxa Rubra. Die 60 centralità locali sind: Piazza Vittorio Emanuele II (Municipio I), Flaminio (II), Città Universitaria (III), Settebagni, Fidene, Conca d’Oro, Talenti, Castel Giubileo (IV), Pietralata, San Basilio, Casal Monastero, Casal Bruciato (V), Pigneto, Teano, Serenissima, Piazza Marranella (VI), Tor Sapienza, Alessandrino, Mirti, La Rustica Centro, Tor Tre Teste, Quarticciolo (VII), Finocchio, Torre Gaia, Torre Angela, Lunghezza (VIII), Assisi/Mandrione (IX), Cinecittà, Casal Morena (X), Giustiniano Imperatore, Grotta Perfetta (XI), Laurentina, Mostacciano, Trigoria (XII), Ostia Antica, Acilia Sud, Acilia/Piazza Capelvenere,Ostia Lido, Axa/ Malafede, Infernetto (XIII), Villa Bonelli, Corviale, Trullo, Magliana, Largo La Loggia, Ponte Galeria (XV), Monteverde, Bravetta, Pisana, Colli Portuensi (XVI), Piazza Mazzini (XVII), Casalotti, Montespaccato, Cornelia (XVIII), Selva Candida, Torrevecchia/ Primavalle (XIX), Labaro, Cassia/Tomba di Nerone, La Storta, Vigna Stelluti, Collina Fleming (XX)
[06] Die Stadtverwaltung ist in 19 Departemente gegliedert. Dipartimento XIX befasst sich mit der Aufwertung und Entwicklung der Peripherie
[07] Die 20 Kulturzentren sind: Fidene, Monte Sacro Talenti, San Basilio, Casal dei Pazzi, Pigneto Biblioteca del Cinema, La Rustica, Torre Maura, Villaggio Prenestino, Appio Latino, Cinecittà Est, Cinecittà Tuscolano, Laurentino Piazzale Elsa Morante, Centro Giano/Acilia, Infernetto, Bravetta, Quartaccio, Volusia, Labaro Prima Porta, Pigneto Nuovo Cinema Aquila, Borgata Finocchio Collina della Pace
TEC21, Fr., 2010.04.23
verknüpfte ZeitschriftenTEC21 2010|16-17 Roma aeterna
![]()