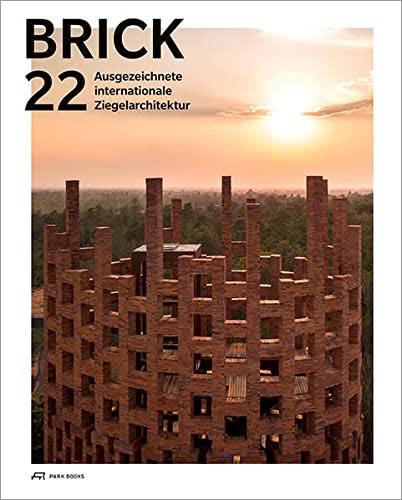Miniapartment »The Cabanon« in Rotterdam
In einem nicht ganz 7 m² großen Raum auf dem Dach eines Wohnblocks hat das Architektenpaar Beatriz Ramo und Bernd Upmeyer ein komplettes Miniapartment samt Spabereich untergebracht. Damit erfüllten sie sich einen persönlichen Wunsch, wollen aber auch Denkanstöße für den Wohnungsbau liefern.
In einem nicht ganz 7 m² großen Raum auf dem Dach eines Wohnblocks hat das Architektenpaar Beatriz Ramo und Bernd Upmeyer ein komplettes Miniapartment samt Spabereich untergebracht. Damit erfüllten sie sich einen persönlichen Wunsch, wollen aber auch Denkanstöße für den Wohnungsbau liefern.
Wieder einmal so ein Werbegag für die internationalen Architekturblogs, mag man beim Anblick des Cabanon zunächst denken. Und tatsächlich wurde das fotogene Kleinstprojekt von den Medien sofort aufgegriffen, vielfach publiziert und mit modischen Etiketten versehen. Bei unserer Besichtigung stellen Beatriz Ramo und Bernd Upmeyer deshalb zunächst einmal klar, was ihr Miniprojekt nicht sein will: kein Prototyp für ein Tiny House, kein Pamphlet für Minimalismus und sicher keine Lösung für die Wohnungskrise.
Gestapelte Funktionen
Die Spanierin und der Deutsche leiten seit fast 20 Jahren ihre Studios STAR und BOARD, teilen sich einen Büroraum und sind auch privat ein Paar. Sie wohnen im zweiten Stock eines Wohnblocks aus den 1950er Jahren im Zentrum von Rotterdam. Vor etwa zehn Jahren fiel ihnen ein Zettel im Aufzug ins Auge: Ein Nachbar bot einen etwa 7 m² großen Abstellraum auf dem Dach für 11 000 Euro zum Kauf an. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Raum ein 6 m² großes Fenster hat und an Strom, Heizung und Kanalisation angeschlossen ist, denn dieser und zwei weitere Aufbauten hatten in der Nachkriegszeit zeitweise als Wohnraum für Krankenschwestern gedient.
Das Architektenpaar fackelte nicht lange und kaufte den Dachaufbau. Upmeyer wollte den Raum zunächst nur als Wäschekammer nutzen, aber angesichts der vorhandenen Anschlüsse und der Aussicht kamen die beiden ins Grübeln. »In unserer Wohnung fehlte immer schon ein Gästezimmer, und im Badezimmer gab es nur eine Dusche«, sagt Bernd Upmeyer. Er träumte von einem Whirlpool, Beatriz Ramo gar von einer Sauna. Aber wie sollte man all das in einem nur 1,97 x 3,60 m großen Raum unterbringen? Es begann ein Entwurfsprozess, der fast zehn Jahre dauern sollte. Der Schlüssel war letztlich die Einsicht, dass nicht alle Funktionen dieselbe Raumhöhe brauchen. Da der Raum zwar keine große Grundfläche, aber 3 m Deckenhöhe hatte, konnten die verschiedenen Funktionen nicht nur neben-, sondern auch übereinander angeordnet werden. So gelang es, den kleinen Aufbau in vier separate Bereiche zu unterteilen.
Auf die Körpergröße zugeschnitten
Man erreicht das »Cabanon«, indem man mit dem Aufzug ins 6. Geschoss fährt und dann noch eine Treppe hinaufgeht. Dort stößt man auf eine unauffällige Tür, die sich (praktischerweise) nach außen öffnet. Dahinter betritt man einen rundum terrakottafarben gestalteten Raum, der zwar klein ist, aber dank des Panoramafensters mit Sitzbank zur Linken nicht klaustrophobisch wirkt. Geradeaus fällt der Blick auf eine geflieste Wand mit geometrischem All-over-Muster; rechts verstecken sich hinter einer Vielzahl von Fronten eine kleine Küchenzeile mit Waschbecken, Mikrowelle, Mülleimer und Minikühlschrank sowie ein Kleiderschrank mit ausfaltbarem Tisch. Die zwei dazugehörigen Klappstühle hängen zusammengefaltet an der Wand neben der Eingangstür.
Neben dem Tisch führt eine Tür in das Badezimmer. Etwas respektloser könnte man bei dem schlauchartigen, rundum mit hellblauen Mosaikkacheln verkleideten Raum auch von einem Duschklo sprechen, denn in seiner Decke befindet sich eine Regendusche, dahinter die Toilette. Mit 62 cm ist er gerade schulterbreit, während seine Höhe von 2,13 m genau auf die Körpergrößen von Ramo und Upmeyer zugeschnitten ist. In der rechten Wand liegt eine Schiebetür, durch die man in eine mit schwarzen Marmorplatten ausgekleidete Kammer gelangt. Zwei Holzsitze mit Infrarotstrahlern flankieren die Tür, daneben steht eine Badewanne mit Sprudeldüsen: Wir befinden uns im Spa mit »Sauna und Whirlpool«.
An der Innenseite der Duschtür hängt eine schwere Metallleiter. Man braucht sie, um ins Bett zu gelangen, das sich in einem 1,35 m breiten und 1,14 m hohen Alkoven über dem Spa befindet. Schiebetüren neben dem Bett bieten Zugriff auf einen Stauraum über der Dusche. »Dort können Gäste ihre Koffer verstauen, denn im Wohnbereich liegen sie nur im Weg«, sagt Ramo. Die Schlafnische ist rundum resedagrün – inklusive einer zotteligen Tagesdecke, die einem Sesamstraßenmonster gut stehen würde.
Ramo und Upmeyer haben ihre Kombination aus Gästezimmer und Spa nach Le Corbusiers legendärem Cabanon an der Côte d‘Azur benannt. Die Hütte am Mittelmeer ist jedoch mit 15 m² doppelt so groß und viel asketischer als ihre Namensgenossin in Rotterdam. Da Le Corbusier im benachbarten Restaurant aß und im Meer schwamm, enthielt sie weder Küche noch Bad, und das Bett war nur eine schmale Liege. Dagegen bezeichnet Upmeyer sein Cabanon als »epikuräisches Exempel im Kleinstformat«. Das zeigt sich nicht nur in den Funktionen, sondern auch in Farbgestaltung und Materialwahl: Der schwarze Marmor erinnert mehr an Mies van der Rohe als an Le Corbusier.
Optimierung des Raums
Wie die meisten Materialien und Objekte im Cabanon war der Marmor ein Zufallsfund. Ursprünglich wollte das Architektenpaar das Bad grün kacheln, stieß aber auf einen günstige Restposten schwarzer Fliesen. Die Wanne war ein Secondhand-Fundstück, das sogar zum maßgeblichen Element wurde: Ihre Abmessungen gaben die Größe des Spabereichs vor, ebenso wie der Kühlschrank die Tiefe der Küchenzeile und die handelsübliche Matratze die Breite des Betts bestimmte. Um diese Objekte herum zimmerte ein Schreiner aus Rotterdam, der eigentlich auf Schiffsinterieurs und Bühnenbilder spezialisiert ist, die Raumkonstruktion.
Wichtigste Hommage an Le Corbusier ist sicherlich die Anpassung des Interieurs an die Körpermaße der Nutzer, die damit quasi als Modulore dienten. In dieser Hinsicht gibt es auch Parallelen zum Rietveld-Schröder-Haus, das auf die Maße seiner nur 1,57 m großen Bauherrin zugeschnitten und ebenfalls ein räumliches Experiment war. Upmeyer und Ramo verstehen ihr Cabanon v. a. als Denkanstoß, um über einen flexibleren Umgang mit dem Bauvolumen nachzudenken. Es geht um eine Optimierung des Raums – wobei sie keinesfalls eine Reduktion, sondern eher eine Maximalisierung anstreben. Sie sind überzeugt, »dass sich unendliche Möglichkeiten eröffnen, wenn man Vorschriften lockert und nicht immer nur in Standardlösungen denkt«, so Upmeyer. Sie sehen das Cabanon auch als Plädoyer dafür, dass Architekt:innen wieder mehr Einfluss auf die Gestaltung von Wohnungen bekommen. Und ehe man anmerken kann, dass das aber große Ambitionen für ein kleines Projekt sind, wirft Ramo ein: »Eigentlich haben wir das Cabanon aber v. a. als Gästezimmer und Spa gebaut. Wir stehen jetzt mehrmals pro Monat im Bademantel im Aufzug und freuen uns auf ein heißes Bad.«
db, Fr., 2025.01.03
verknüpfte Zeitschriften
db 2025|01-02 Anders Bauen