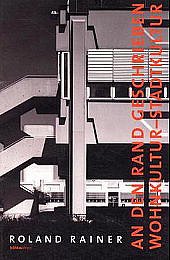Übersicht
Publikationen
Bauwerke
Artikel 12
Ein Architekt und Gentleman
Er war Humanist, ein Lehrer für mehrere Generationen von Architekten. Ein Allrounder mit einem umfassenden Gesellschafts- und Kulturbewusstsein. Und laut Wikipedia Mitglied der NSDAP. Roland Rainer zum 100. Geburtstag.
Er war Humanist, ein Lehrer für mehrere Generationen von Architekten. Ein Allrounder mit einem umfassenden Gesellschafts- und Kulturbewusstsein. Und laut Wikipedia Mitglied der NSDAP. Roland Rainer zum 100. Geburtstag.
Meine Lieblingsanekdote zur Person Roland Rainers ist parasitärer Natur. Ich habe sie nicht selbst erlebt, sie wurde mir erzählt. Einer seiner Studenten legt Roland Rainer eine Projektskizze vor. Der betrachtet sie kritisch und sagt: „Also, Herr Kollege, das müssen Sie noch einmal zeichnen. Dieses Schwarzweiß . . . Wieso machen Sie es nicht bunt? Machen Sie es doch grau!“
Er war ein Architekt und Gentleman, einer der Letzten dieser inzwischen ausgestorbenen Spezies. Im persönlichen (gesellschaftlichen) Kontakt stets perfekte, ungemein kultivierte Umgangsformen, die nicht nur Oberfläche waren. Sie waren Ausdruck eines umfassenden Gesellschafts- und Kulturbewusstseins, dem eine völlig andere Vorstellung des „Künstlerseins“ zugrunde liegt, als wir sie heute haben. Er war ein Allrounder, einer jener wenigen, die von der Stadtentwicklung bis zum Städtebau und der Verkehrsplanung, vom öffentlichen Bau über die Wohnsiedlung bis zum einzelnen Haus, vom Denkmal- und Landschaftsschutz über Grünraum- und Gartenplanung bis zu Möbelentwürfen und künstlerischen Designs alles beherrschte; er schrieb, er fotografierte und vor allem: Er konnte noch zeichnen, was in Zeiten der Computerarbeit eine längst vernachlässigte Fähigkeit ist. Und all das war eingebettet in ein komplexes Welt-, Gesellschafts-, Kulturbild, das keinesfalls nur funktionalistisch begründet war – wie man ihm gelegentlich unterstellt hat –, sondern durchaus historische Wurzeln hatte, vor allem auch im außereuropäischen Kontext. Schließlich hat er als bedeutender Lehrer mehrere Generationen von Architekten geprägt – von den Vorarlberger Baukünstlern bis zu Henke∣Schreieck.
Geboren vor 100 Jahren. Das bedeutet, er hat den Krieg als erwachsener Mensch erlebt. Bei Wikipedia kann man nachlesen, dass er ab 1936 illegales Mitglied der in Österreich verbotenen NSDAP gewesen ist – und später an diese Zeit nicht erinnert werden wollte. Er zählte aber auch zu den Ersten, die sich gleich nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend mit der Frage und den Folgen der Zerstörung der europäischen Städte auseinandersetzten. Er erhob seine Stimme gegen die Zerstörungen des Wiederaufbaus und erkannte die Dringlichkeit der „Behausungsfrage“ in all ihrer Komplexität. (Sein Buch „Städtebauliche Prosa“ von 1947 wurde zum Standardwerk.)
Gewiss, Rainer hatte die Chance und das Glück (natürlich auch die Fähigkeit), sowohl in Österreich als auch in Deutschland große öffentliche Bauten zu realisieren, die bis heute beispielhaft dastehen. Aber sein Beitrag zur Wohnbaudiskussion ist sicher der bedeutendste Teilbereich in seinem Werk. Da hat sich der große Humanist in Rainer zu Wort gemeldet, der die Frage, was es zu einemmenschengerechten Wohnen braucht, auf den Punkt brachte. Sein verdichteter Flachbau, wie er in der Siedlung Puchenau in mehreren Etappen (1965–1967 Puchenau 1, 1973 Puchenau Ost, 1975–1976 Kirche Puchenau, 1978–1992 Puchenau 2) und daher in großem Stil, als wirkliche „Gartenstadt“ realisiert wurde, ist bis heute einzigartig in Österreich. Kein anderer Architekt hatte die Möglichkeit, eine Wohnvision in diesem Maßstab und mit dieser Konsequenz und Klarheit umzusetzen – wenn wir von Harry Glücks Wohntürmen in Alt Erlaa absehen, die ungefähr das Gegenteil von dem verkörpern, wofür Rainer stand.
Puchenau wurde anfangs als „Rainer-KZ“ verunglimpft, davon ist längst nicht mehr die Rede. Dem Konzept der sehr dichten Hofhaussiedlung waren Versuche vorangegangen, bei denen Rainer seine Vorstellungen eines maßstäblich menschengerechten Wohnens, ökologische Überlegungen, aber auch Versuche industriellen Bauens umsetzte – etwa bei der kleinen Werksiedlung Mannersdorf (1951) oder bei der Fertighaussiedlung in der Wiener Veitingergasse (mit Carl Auböck, 1953), gewissermaßen einem Prototyp, der von der Bauwirtschaft allerdings nicht einmal ignoriert wurde; schließlich bei der Siedlung in der Wiener Mauerberggasse (1962–1963), wo Rainer mit passiver Sonnenenergie-Nutzung und einer Kombination aus Luft- und Zentralheizung experimentiert.
Trotzdem muss man sagen, dass Rainer gerade den Wiener Wohnbau nicht geprägt hat, in der Bundeshauptstadt hatte man längst auf andere Typologien gesetzt, die viel weniger Boden verbrauchen und viel mehr in die Höhe wachsen.
Rainer hat wunderschöne Einfamilienhäuser gebaut. Das letzte – für Franz Morak – hat er nicht akzeptiert, weil Morak zu viel an Rainers Konzept verändert hat. Dafür ist ihm sein eigenes Haus im Burgenland, in St. Margarethen, zur Ikone geraten. Er hat es 1958 gebaut und dabei mit beeindruckender Konsequenz demonstriert, wie man – auch ganz „ohne Dach“ – in der Landschaft baut, ohne jemanden „zu stören und selbst gestört zu werden“ (Rainer).
Die Größe eines Architekten wird in der Regel, allen anders lautenden Gerüchten zum Trotz, auch an seinen Großbauten gemessen. Rainer mag schon zu einer frühen Zeit wegweisende Gedanken zur Umwelt, zur Entwicklung der Städte, zur Landschaft, zum Bauen, zur Architektur formuliert haben. Er mag in Schulen, Kirchen und anderen öffentlich genutzten Einrichtungen der grundlegenden Humanität seiner Architekturauffassung Geltung verschafft haben. Aber was wäre sein Werk ohne die Großbauten. Ohne die großen Hallen.
Allen voran die Wiener Stadthalle, als Siegerprojekt hervorgegangen aus einem nicht unumstrittenen internationalen Wettbewerb, denn es gab zwei erste Preise – neben Roland Rainer immerhin Alvar Aalto. Schließlich hat Rainer sein Projekt realisiert (1952–1958) und daraus den „Schlüsselbau“ (Friedrich Achleitner) der Wiener Nachkriegszeit gemacht. Die Wiener Stadthalle entstand in einer Zeit, als flexibel nutzbare Mehrzweckhallen überall gefragt, aber dennoch ein relativ neues Thema waren. Tatsächlich wurde an Nutzung dafür angedacht, was überhaupt nur vorstellbar ist – von Sportveranstaltungen jeglicher Art über kulturelle Events in aller Bandbreite bis hin zu Messen und was sonst noch Menschenmassen bis zu einer Größenordnung von 15.000 mobilisieren konnte.
Rainer hat das enorme Programm in eine Haupthalle mit einer Abmessung von 100 mal 100 Metern und kleinere Hallenbauten (Eislaufhalle, Ballspielhalle, Gymnastikhalle), teils in Verbindung mit Verwaltungseinrichtungen, Terrassencafé und Restaurant, gegliedert. Das Hallenbad kam dann 1962–1974dazu und war gerade kürzlich Gegenstand öffentlicher Kontroversen. Glücklicherweise wurde unter Mitwirkung des Denkmalschutzes ein Verfahren ausgelobt, aus dem ein Rainer-Schüler, Georg Driendl, siegreich hervorging. Man darf also erwarten, dass diesensible Reparatur des Bestands den Vorrang vor massiven Neuerungen haben wird.
Das Ensemble steht heute leider nicht mehr unverändert da. Das liegt weniger an der architektonisch nicht anfechtbaren Intervention der Vorarlberger Architekten Dietrich∣Untertrifaller, es liegt an den schleichenden Eingriffen, die sich eine Betriebsgesellschaft mit wenig Sinn für Authentizität und Atmosphäre erlaubt hat. Auch das kann man im Internet nachlesen: Das achtlos ausrangierte Stadthallen-Inventar wird heute zu Spitzenpreisen gehandelt.
Konstruktiv könnte man der Wiener Stadthalle eine gewisse Konventionalität nachsagen. Bei seinen deutschen Hallenbauten, etwa in Bremen (mit Säume und Hafemann, 1961–1964) wählte er eine interessantere Konstruktion. Er sagt selbst, er habe das Haus als „Zelt unter Zelten“ aufgefasst, weil es auf einem Ausstellungs- und Volksfestgelände steht. Die Tribünenkonstruktion ist hier durch Stahlbeton-Zugglieder so miteinander verbunden, „dass das Gewicht der Tribünen die Zugglieder spannt“ (Rainer) – was sich nach außen in Form spitz auskragender Konstruktionselemente ausdrückt.
Rainers Häusern war nicht immer ein glückliches Schicksal beschieden. Legendär ist sein Franz-Domes-Lehrlingsheim auf denWiener Arbeiterkammergründen. Er hat es 1952–1953 gebaut und als eine Art Gegenstatement zum benachbarten Theresianum, dieser Eliteschule par excellence, konzipiert. Es war das Statement schlechthin, das einer neuen sozialen Gesinnung sichtbaren Ausdruck verlieh. Aber diese sozialdemokratischeGesinnung hat nicht einmal 30 Jahre überdauert. 1983 wurde es abgerissen und wich einem Kulturbau, den die einen als „Schönbrunner-Stil“ (Dietmar Steiner), Rainer selbst als „Funktionärsbarock“ bezeichnen.
Es gibt in der Biografie Rainers einen Abschnitt, über den es nicht leicht ist, sich zu äußern. Von 1958–1963 war er Stadtplaner von Wien. Manches hat er früh erkannt: Dass man den Donauraum entwickeln muss – was mit der Donauinsel tatsächlich und zum Gewinn aller Bürger von Wien geschehen ist. Seine Entwicklungsvorschläge für die Wiener Peripherie wurden hingegen nicht angenommen. Und vor allem war seine radikale Ablehnung des U-Bahn-Baus eine krasse Fehleinschätzung der Verkehrsentwicklung in einer Großstadt.
Ein Waterloo, dem in diesen Tagen das nächste folgt: das ORF-Zentrum auf dem Küniglberg. Es war immer irgendwie ungeliebt, niemand hat es als einen großen architektonischen Wurf empfunden. Vielleicht kam es zu spät? Es ist in einer Architektursprache formuliert, die sich gerade bei solchen „Sonderbauten“ überholt hat. Heute verlangt der Sonderbau nach der architektonisch „designten“ Besonderheit, für Rainer ein Gräuel.
Ich mag aber nicht daran glauben, dass ein so flexibel konzipiertes Bauwerk wie das ORF-Zentrum den rasanten Entwicklungen im medial-technologischen Bereich nicht standhält. Natürlich ist der Technologiebedarf, auch der Raumbedarf ins schier Unendliche angewachsen. Aber wenn mir jemand kommt und mit „bautechnologischen Mängeln“ argumentiert – dann versagt mein Verständnis. Ja, wo waren Sie denn, die Herren von der Küniglberg-Leitung? Haben Sie nicht gewusst, dass man auch Gebäude warten, pflegen, laufend sanieren muss? Man kann alles verfallen lassen und dann sagen, jetzt geht es nicht mehr. Man kann es aber auch liebevoll pflegen – und das Potenzial an Flexibilität nutzen, das der Architekt einmal angedacht hat. Dann sieht die Sache ganz anders aus.
Lebensräume
Am 1. Mai dieses Jahres wäre der Wiener Architekt Roland Rainer 95 Jahre alt geworden. Vor einem Jahr ist er gestorben. Er wird vermisst, der alte Mann....
Am 1. Mai dieses Jahres wäre der Wiener Architekt Roland Rainer 95 Jahre alt geworden. Vor einem Jahr ist er gestorben. Er wird vermisst, der alte Mann....
Am 1. Mai dieses Jahres wäre der Wiener Architekt Roland Rainer 95 Jahre alt geworden. Vor einem Jahr ist er gestorben. Er wird vermisst, der alte Mann. Irgendwie war er eine Art architektonischen Gewissens in einer Zeit, in der das Grelle, Dekorative gelegentlich zu wichtig genommen, die Fassade zur bedeutendsten Visitkarte des Hauses wird. Rainers Grundsätze - vor allem den Wohnbau betreffend - waren streng, kosmopolitisch und richteten sich stets strikt nach den Bedürfnissen der Nutzer. Seine durchgrünten Siedlungen haben zwar bis heute Vorbildwirkung, doch seine Lehre muss aktiv weitergetragen, verbreitet und an die zeitgenössischen Lebenswelten angepasst werden.
Zum 90er bekam der Ehrenbürger der Bundeshauptstadt denn auch von Stadtplanung und Kammer ein Geburtstagsgeschenk in Form des Rainer-Stipendiums. Die diesjährige Neuauflage anlässlich seines 95ers stellt eine Ausweitung der Idee dar und ist ein „Internationaler Roland-Rainer-Ideenwettbewerb“, der weltweit ausgeschrieben und mit einem Preisgeld von insgesamt 27.000 Euro dotiert ist.
Rainers Lebensthema bleibt im Zentrum: Architekten und Absolventen sind aufgerufen, neue Stadtquartiere anzudenken, neue Wohn-, Lebens, Arbeitsformen im städtischen Raum in Architektur zu gießen. Es handelt sich also um einen Theorie-Wettbewerb auf der Suche nach dem Ideal. Doch laut noch nicht veröffentlichtem Ausschreibungstext „strebt das Verfahren die Auszeichnung von realisierungsfähigen Vorentwürfen für ein Stadtquartier an“. Und: „Auch wenn das Verfahren zuerst auf Ideen zielt, verstehen sich die Auslober dazu, das Projekt des Gewinners nach Abschluss so aufzubereiten und zu veröffentlichen, dass eine bauliche Umsetzung erleichtert wird.“ Der STANDARD wird über den Wettbewerbsstart, Ausschreibung und Termine demnächst ausführlicher berichten.
Parallel dazu ruft das Roland-Rainer-Komitee „die Notwendigkeit der Errichtung eines Roland-Rainer-Lehrstuhls, eines Roland-Rainer-Archivs und eines Roland-Rainer-Platzes in Erinnerung. Rainers einzigartige Architekturgesinnung muss als Herausforderung für das Baugeschehen für heute lebendig bleiben.“
Roland-Rainer-Platz in Wien zum Geburtstag
Vor vier Monaten verstarb Roland Rainer, einer der wichtigsten Architekten Österreichs. Kommenden Mai wäre der Wiener 95 Jahre alt geworden. Bis dahin...
Vor vier Monaten verstarb Roland Rainer, einer der wichtigsten Architekten Österreichs. Kommenden Mai wäre der Wiener 95 Jahre alt geworden. Bis dahin...
Vor vier Monaten verstarb Roland Rainer, einer der wichtigsten Architekten Österreichs. Kommenden Mai wäre der Wiener 95 Jahre alt geworden. Bis dahin will ein Roland-Rainer-Komitee, dem unter anderem die ETH-Professoren Herbert Kramel und Gregor Eichinger sowie MAK-Chef Peter Noever angehören, nicht nur Rainers Nachlass sichern, sondern sich auch für die Umbenennung eines Platzes neben dem Hauptgebäude der Akademie der bildenden Künste in Wien zum Roland-Rainer-Platz einsetzen.
In einer Resolution, die etwa an Bundeskanzler Schüssel, Bundespräsident Fischer und Wiens Bürgermeister Häupl ging, heißt es: Die „Verankerung seiner Architekturgesinnung in der Gegenwart“ sei ebenso verpflichtend, wie „sein Erbe wahrzunehmen“.
Rainer selbst war von 1960 bis 1962 Rektor der Akademie am Schillerplatz, ein derzeit vakanter Lehrstuhl zur Thematik anonymer Bau- und Wohnformen - eines der wichtigsten Themen in Rainers Lebenswerk - geht auf seine Initiative zurück. Das Komitee will sich nun für eine bessere Dotierung der Lehrkanzel sowie für eine Umbenennung in „Roland Rainer-Chair for Habitat, Environment & Conservation“ einsetzen. Dies wäre ein internationaler Profilierungsschritt für die Akademie.
Das Komitee verlangt auch die Reaktivierung des zum 90. Geburtstag Rainers von der Stadt Wien und der Architektenkammer gestifteten Rainer-Stipendiums. Es ist mit 10.000 Euro dotiert, wurde allerdings erst einmal vergeben, da es Unstimmigkeiten mit der Stadt über die von Rainer definierte Ausschreibung gab. Darin heißt es: „Weniger die äußere Form beziehungsweise die ,Architektur' sind das Ziel dieser Arbeit als vielmehr die restlose Brauchbarkeit für das Leben von heute und morgen.“
Kardinal und König
Vergangene Woche starb der österreichische Jahrhundertarchitekt. Ihm verdankt Wien es, eine der lebenswertesten Städte Europas geworden zu sein.
Vergangene Woche starb der österreichische Jahrhundertarchitekt. Ihm verdankt Wien es, eine der lebenswertesten Städte Europas geworden zu sein.
Roland Rainer war Kardinal und König der österreichischen Architektur. Er dachte, sprach und baute, als würde er predigen. Er mahnte die Tugendhaftigkeit der Architektur ein. Sie müsse wahrhaftig, aufrichtig, einfach, bescheiden und uneitel sein.
Einer der schönsten Innenräume, die ich in Wien kenne, ist sein Büro im Hinterhof eines mehrgeschoßigen Wohnhauses in Wien-Hietzing. Es ist ein kahler, fensterloser, knapp möblierter Raum: ein Ort zwischen der Sakristei einer einfachen Landkirche und der Eremitage eines taoistischen Denkers. In der Mitte steht ein langer Tisch, der stets leer war, wenn ich bei ihm zum Besuch weilte. Auffallend abgeräumt, Tabula rasa. Der Raum wird durch einen Okulus, ein rundes Fenster in der Decke, beleuchtet - ähnlich wie die Altäre in den von Rainer erbauten Kirchen. Ein Ort höchster Konzentration. Den Blick in den begrünten Hof, die von ihm vehement geforderte Verbindung der Innenräume mit dem Außen, gönnte er seinen Mitarbeitern im Zeichensaal.
Aus Gesprächen mit ihm schließe ich, dass Roland Rainer Atheist war. Sein Zugang zur Architektur hingegen war ausgesprochen religiös. Er sprach wie ein Missionar und dachte wie ein Demiurg. „Es ist Aufgabe des Architekten, den Menschen ein vollständiges, menschliches, humanes Weltbild zu vermitteln. Wir müssen daran denken, dass wir nicht nur Häuser bauen. Wir müssen wissen, dass wir eine Welt bauen.“ Mit diesen Worten schließt Roland Rainer sein letztes Buch, die exzellent gestaltete Monografie „Roland Rainer: Das Werk des Architekten 1927-2003“ (Springer Verlag), die er selbst, nicht ganz uneitel, herausgegeben und gestaltet hat.
Bücher zu schreiben und zu gestalten war seine Leidenschaft. Insgesamt 26 Bücher hat er veröffentlicht. Der 1961 von ihm selbst gestaltete und herausgegebene Bildband „Anonymes Bauen im Nordburgenland“ ist für mich das schönste Architekturbuch, das in Österreich je veröffentlicht wurde. Sein letztes Buch, die Monografie, die nur wenige Wochen vor seinem Ableben am 10. April 2004 erschienen ist, wurde offensichtlich als Vermächtnis konzipiert. Sie trägt den apodiktischen Untertitel „Vom Sessel zum Stadtraum: geplant errichtet verändert vernichtet“ und eine dramatisch wirkende Nachtaufnahme der Stadthalle von Bremen auf dem Umschlag.
Die Lage in Bremen ist tatsächlich dramatisch. Der 1964 fertig gestellten Stadthalle droht die rücksichtslose Erweiterung für Zwecke des zeitgenössischen Events, wodurch die eindrucksvolle Außenerscheinung der auf sechs schräge Pfeiler gehängten Halle mit mehr als hundert Metern Spannweite völlig ruiniert wäre. Als kürzlich die brutalen Umbaupläne bekannt wurden, klagte Rainer, der nie konsultiert worden war, seine Urheberrechte ein. Der Gerichtstermin wurde erst Monate nach dem Beginn der Umbauarbeiten festgelegt. Ob der Prozess nun nach dem Tod des Architekten fortgesetzt wird, ist unklar. Hoffnungsvoll stimmt allerdings, dass die Proteste namhafter Kulturmenschen in Deutschland immer stärker werden.
Auch die Wiener Stadthalle wurde umgebaut. Dabei ist man zwar nicht zerstörerisch, aber leider auch nicht zimperlich vorgegangen. Vernichtet wurde die erste Bauwerk-Predigt von Rainer: das 1952 für die und neben der Wiener Arbeiterkammer errichtete Franz Domes Lehrlingsheim. Trotz Protesten wurde es 1983 abgerissen und durch ein Bürohaus und ein Theater in scheußlichem Funktionärsbarock ersetzt.
Im Wien der Fünfzigerjahre war die moderne Architektur ein attraktives Wahlthema. „Damit Wien wieder Weltstadt wird, wählt SPÖ“, hieß es auf einem Plakat für die Kommunalwahlen 1954. Die auf dem Plakat abgebildete moderne Weltstadt existierte noch nicht. Der Ringturm befand sich noch im Rohbau und die Stadthalle gar noch am Planpapier als Entwurf für einen internationalen Wettbewerb im Sommer 1954. Der erste Preis wurde zwischen Alvar Aalto und Roland Rainer aufgeteilt, Rainer - wir sind in Wien - bekam den Bauauftrag. Dennoch ist diese Mehrzweckhalle ein Spitzenbauwerk der Architekturgeschichte.
Zwei deutsche Städte, Bremen und Ludwigshafen, beschlossen daraufhin, ähnliche Stadthallen errichten zu lassen. Von Roland Rainer. Nach den von ihm gewonnenen Wettbewerben. Die Stadthallen wurden zu den jeweiligen Wahrzeichen aller drei Städte und zu Zeichen der Zeit, des wunderbaren Aufstiegs des kriegszerstörten Deutschland und Österreichs zu vorbildlich modernen, demokratischen und wirtschaftlich prosperierenden Staaten.
Was die neue Baukultur betrifft, hat Roland Rainer viel dazu beigetragen. In Österreich war er jahrzehntelang die bestimmende Majestät des Bauens. Er war einer, der die Zeit prägte, in der er tätig war, und zu deren Zeichen er letztlich selbst werden sollte. Er war eine Autorität - und das wusste er, das setzte er ein, das nutzte er aus. Was nicht seinen Vorstellungen entsprach, lehnte er ab. Wann und wo er konnte, versuchte er nach seinen Maßstäben und Dogmen zu wirken.
Konnte er nicht, zog er sich erzürnt zurück. So 1963 nach fünfjähriger Amtszeit als Stadtplaner von Wien. 1957 hatte Rainer vor dem Wiener Senat einen Vortrag gehalten, in dem er seine Auffassung von der Arbeit des Stadtplaners darlegte. Er sprach, als würde er aus dem Koran zitieren, und verglich seine Arbeit mit der eines Teppichwebers: „Andere haben vor ihm gewebt, und andere werden nach ihm weiter weben. Der Wiener Stadtplaner webt an einem sehr kostbaren Teppich, der in der Geschichte aus der Landschaft und den Werken der Menschen entstanden ist.“
Den Stadtratsabgeordneten gefiel der Vortrag sehr, und sie ernannten Rainer zum Wiener Stadtplaner. Gott sei Dank. Die Basis dafür, dass Wien eine der lebenswertesten Städte in Nachkriegseuropa geworden ist, ist der Autorität des Roland Rainer, dem Jahrhundertarchitekten der zweiten Hälfte des österreichischen 20. Jahrhunderts, zu verdanken.
Atriumhaus und Stadthalle
Zum Tod des österreichischen Architekten Roland Rainer
Zum Tod des österreichischen Architekten Roland Rainer
Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Neue Zürcher Zeitung“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()
Ein Schöpfer des Lebensraumes
Am Karsamstag starb der Doyen der österreichischen Architektur, Roland Rainer, kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres.
Am Karsamstag starb der Doyen der österreichischen Architektur, Roland Rainer, kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres.
Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Die Presse“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()
„Du sollst deinem Nachbarn nicht die Sonne nehmen“
Marta Schreieck, Österreich-Kommissärin der Architektur-Biennale Venedig 2004, erinnert sich an ihren Lehrer Roland Rainer.
Marta Schreieck, Österreich-Kommissärin der Architektur-Biennale Venedig 2004, erinnert sich an ihren Lehrer Roland Rainer.
Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Die Presse“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()
Roland Rainer (1910-2004)
Der unbequeme Architekt, Stadtplaner und Theoretiker Roland Rainer starb am Samstag, wenige Tage vor seinem 94 Geburtstag
Der unbequeme Architekt, Stadtplaner und Theoretiker Roland Rainer starb am Samstag, wenige Tage vor seinem 94 Geburtstag
Rainer plädierte für „direkte“ Architektur, die der Funktion dient, und einen menschengerechten Wohnbau: Das Hochhaus war ihm verhasst.
Wien - Vor knapp vier Jahren, am 27. April 2000, feierte die Architektenschaft ihren Doyen: Man pries Roland Rainer, der vier Tage später, am 1. Mai, 90 Jahre alt wurde, mit unendlich vielen Worten in der Halle E der Wiener Stadthalle, die er 1954 bis 1958 erbaut hatte. Und der alte Herr, dem Eitelkeit zuwider war, schien glücklich. Nicht der Standing Ovations wegen: Seine Lieblingshalle war restauriert worden. Und in seiner Rede, denkbar knapp, sagte er gerührt, sie sei noch nie so schön gewesen: „Man hat mich verstanden. Kein Klimbim. Keine Späße. Schönheit.“
Doch das sollte nicht generell für die Stadthalle gelten, deren klare Form das Logo bildet: Die Betreiber modernisierten den Bau, tauschten die schlichten Sessel gegen samtgepolsterte Stühle in Pink und Altgold aus; die Garderobeständer landeten beim Sperrmüll, wo sie von einigen, die den Wert erkannten, herausgefischt wurden - im Herbst 2003 zahlte jemand bei Sotheby's in London 5600 Euro dafür. „Ich wollte mit meinen Möbeln nicht repräsentieren“, klagte Rainer gegenüber dem STANDARD. Seine Intentionen wurden zerstört: „Mich hat keiner je kontaktiert.“
Vielleicht hat man Rainer doch nicht verstanden. Oder wollte es nicht. Denn immer trat er für ein menschengerechtes Wohnen ein. In anderen Bereichen (Büro, Hotel, Krankenhaus) sei das Stapeln von Stockwerken durchaus zweckmäßig, aber „zum Wohnen braucht der Mensch Ruhe, Geborgenheit, Intimität, einen Garten“, sagte er. „Es ist eine Tatsache, dass die Mehrzahl im Einfamilienhaus die gewünschte Wohnform sieht.“ Doch dies werde nicht respektiert, nur Hochhäuser brächten Renommee: „Damit steht man groß da. Jeder will den Knalleffekt - aber lauter Knalleffekte haben keine Wirkung.“
Sich anbiedern, Kompromisse eingehen, nach Effekten schielen, modisch sein: Das war nie sein Weg. 1935 dissertierte Rainer, 1910 in Klagenfurt geboren, an der Technischen Hochschule in Wien über den Karlsplatz, dessen problematische Gestaltung ihn jahrzehntelang beschäftigte. 1937 ging er nach Berlin zur Deutschen Akademie für Städtebau. Nach dem Kriegsdienst übersiedelte er 1945 zurück nach Österreich. Seine an der TU eingereichte Habilitationsschrift Die Behausungsfrage wurde 1946 mit der Begründung abgelehnt, es handle sich um eine „sozialpolitische Propagandaschrift“.
Planung mit Weitsicht
1956, nach drei Jahren als Ordinarius an der TU von Hannover, übernahm er an der Akademie der bildenden Künste eine Meisterklasse für Architektur, die er bis 1980 leitete. Und 1958 wurde er zum Stadtplaner von Wien berufen - er legte einen Entwicklungsplan vor, der zu den fortschrittlichsten in Europa zählte und in Grundzügen (Schaffung der Donauinsel und neuer Stadtzentren) verwirklicht werden sollte. Aber aus Protest gegen politische Verhinderungen trat er 1963 zurück. Das bedeutete auch das Ende der Architektentätigkeit im Auftrag der Stadt Wien.
Doch er baute das ORF-Zentrum. Und von 1963 an entstand bei Linz die Gartenstadt Puchenau: Rainer erbrachte den Nachweis, dass mit dem verdichteten Flachbau - niedrige Verbauung in Terrassen, abgeschlossene, intime Gartenbereiche - „grüne“ Gesinnung kostengünstig und Flächen sparend umgesetzt werden kann. Sowohl das ORF-Zentrum als auch die Gartenstadt, der weitere folgten (z. B. 1990-92 in der Tamariskengasse in Wien), begleiteten ihn sein weiteres Leben: Puchenau wuchs in Etappen auf eine autofreie Stadt mit zwei Kilometer Länge und 1000 Wohnungen an; und vor drei Jahren entstand am Küniglberg ein Zubau, ein dreigeschoßiger Bürotrakt aus Stahl und Glas mit einer Dachterrasse.
Bei anderen Gebäuden war ihm hingegen nicht dasselbe Glück beschieden: Das Domes-Lehrlingsheim in Wien wurde abgerissen und durch ein Kulturheim im „Funktionärsbarock“, so ein Lieblingsausdruck von Rainer, ersetzt. In Kötschach-Mauthen steht eine Kirche, die er als „kein Werk von mir“ bezeichnet, weil sie kurz vor der Fertigstellung stark verändert wurde. Und auch das Haus, das er für Franz Morak plante, sei keines: Der Staatssekretär soll zu massiv eingegriffen haben. Doch zumindest das 1958 fertig gestellte Böhler-Bürohaus gegenüber der Akademie am Schillerplatz mit seiner Glas-Aluminium-Fassade, das jahrelang leer stand, wurde gerettet: Komplett saniert, dient es heute als Nobelhotel.
Im Jahr 2000 antwortete Rainer auf die Frage, ob er jemals zu arbeiten aufhören werde: „Zur Ruhe legen werde ich mich wohl eines Tages müssen, zur Ruhe setzen nie.“ Am vergangen Samstag legte sich Rainer zur Ruhe.
Advokat einer humanistischen Moderne
Der Architekt Roland Rainer ist am Samstag kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres in Wien gestorben. Eine entsprechende Mitteilung der Evangelischen...
Der Architekt Roland Rainer ist am Samstag kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres in Wien gestorben. Eine entsprechende Mitteilung der Evangelischen...
Der Architekt Roland Rainer ist am Samstag kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres in Wien gestorben. Eine entsprechende Mitteilung der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien Simmering bestätigte die Familie des Verstorbenen.
Rainer galt als Advokat einer humanistischen Moderne, dessen Planungen stets Hand in Hand mit gesellschaftlichen Analysen gingen.
„Nach den Aufgaben fragen“
„Der Architekt darf nicht damit anfangen, Kunst zu wollen, sondern er muss nach den Aufgaben fragen, die zu lösen sind“, formulierte Roland Rainer sein Credo.
Und: „Ich will nichts Neues, sondern das Richtige. Das Neue wird morgen sowieso schon alt sein - unsere Häuser aber halten unter Umständen bis übermorgen.“
Von der Stadthalle bis zur Gartenstadt
In über 50 Jahren bewältigte er Bauaufgaben verschiedenster Art und Größe: Bürogebäude, Schulen, Kindergärten, Bäder, Kirchen, Mehrzweckhallen, Fabriksgebäude, Hotels, Wohn- und Siedlungsbauten. Zu seinen Hauptwerken zählen die Wiener Stadthalle und das ORF-Zentrum auf dem Küniglberg.
Mit der Gartenstadt Puchenau realisierte Rainer modellhaft seine Idee eines humanen Wohnens im verdichteten Flachbau, die Erkenntnisse vorindustriellen Bauens mit zeitgenössischem ökologischen Bewusstsein verbindet.
Seit Jahrzehnten äußerte er sich gegen das Hochhaus als Wohnort, der zur Folge habe, dass die Bewohner am Wochenende in die Zweitwohnungen auf dem Land flüchten.
Professor für Hochbau
Geboren wurde Rainer am 1. Mai 1910 in Klagenfurt. Nach dem Studium an der Technischen Hochschule Wien, wo er über die Gestaltung des Wiener Karlsplatzes dissertierte, wurde er Mitarbeiter der Deutschen Akademie für Städtebau in Berlin.
1945 übersiedelte Rainer zurück nach Österreich, 1953 folgte er einem Ruf an die Technische Hochschule Hannover. Weitere Stationen waren eine Professur für Hochbau und Entwerfen an der Technischen Hochschule Graz und bis 1980 die Leitung einer Meisterklasse für Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Von 1958 bis 1963 war Rainer Stadtplaner der Bundeshauptstadt.
Architekt und Autor
1947 veröffentlichte Rainer sein erstes Buch über „Die Behausungsfrage“, dem ein Jahr später die „Städtbauliche Prosa - praktische Grundlagen für den Aufbau der Städte“ folgte. In einer Zeit allgemeiner geistiger Ratlosigkeit knüpfte Rainer in diesen wegweisenden Schriften an jene gestalterischen und sozialen Kräfte an, welche die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts entscheidend geformt hatten.
Beide Bücher befassen sich mit Fragen des Wohnungswesens und Städtebaus in historischen, wirtschaftlichen, räumlichen, gestalterischen, biologischen und technischen Zusammenhängen.
Zahlreiche Publikationen
Weitere Publikationen sind u.a. „Lebensgerechte Außenräume“ (1972), „Die Welt als Garten: China“ (1976), „Anonymes Bauen im Iran“ (1977), „Wienerwald in Gefahr“ (1986), „Dekorationen ersetzen Konzepte nicht“ (1990) und „Vitale Urbanität“ (1995).
Zuletzt erschien heuer der Sammelband „An den Rand geschrieben. Wohnkultur - Stadtkultur“. Rainers Konzepte wurden außerdem in zahlreichen Ausstellungen präsentiert, so 1995 im Museum für angewandte Kunst Wien (MAK) und 1997 im MAK-Center Los Angeles.
Hohe Auszeichnungen
Rainers Arbeit ist im In- und Ausland durch Preise, darunter den Großen Österreichischen Staatspreis für Architektur und den deutschen Fritz-Schumacher-Preis, durch Ehrenzeichen und Ehrenmitgliedschaften (so die des American Institute of Architecture, des Bundes Deutscher Architekten und der Akademie der bildenden Künste in Wien) gewürdigt worden.
Der Wiener Gemeinderat ehrte ihn mit der Ernennung zum Bürger der Stadt Wien. Von 1980 bis 1999 war Rainer außerdem Präsident - dann Ehrenpräsident - des österreichischen Kunstsenates. Von 1980 bis 1986 war er Vorsitzender des Denkmalbeirates beim Bundesdenkmalamts.
Unbestreitbar hat Roland Rainer - wie der Schriftsteller und Architekt Friedrich Achleitner schon 1965 feststellte - den größten Beitrag zum Wandel auf dem Gebiet des Bauens und der Architektur im Österreich der Zweiten Republik geleistet.
„Motor“ der Architektur
Achleitner über Rainer: „Hatte verbalisierbare, mitteilbare Lehrmeinung, an der sich seine Schüler reiben konnten.“
Achleitner über Rainer: „Hatte verbalisierbare, mitteilbare Lehrmeinung, an der sich seine Schüler reiben konnten.“
Als „Motor“ der österreichischen Architektur, der seine Vorstellungen immer wieder gepredigt habe, bezeichnete der Architekturkritiker und -theoretiker Friedrich Achleitner den am Samstag verstorbenen Roland Rainer.
Vom Wohn- bis zum Hallenbau
Rainer habe „unglaublich viel für die österreichische Architektur getan, vor allem im Bereich des Wohnbaus und mit seinen Siedlungen“, so Achleitner am Samstagabend gegenüber der APA.
Darüber hinaus habe Rainer bemerkenswerte Hallen gebaut, neben der Wiener Stadthalle vor allem auch in Deutschland.
Wirkung als Lehrer
Neben seiner praktischen Tätigkeit sei auch Rainers Leistung als Lehrer beachtlich gewesen: Er habe eine „verbalisierbare, mitteilbare Lehrmeinung gehabt, an der sich seine Schüler reiben konnten“. Nicht umsonst wären aus seinen Klassen zahlreiche Talente hervorgegangen.
Arbeiten über den Flachbau
Im theoretischen Bereich habe Rainer ein Siedlungskonzept entwickelt, das am prominentesten mit der Gartenstadt Puchenau verwirklicht worden sei, so Achleitner.
Forscherisch habe er sich ein Leben lang mit dem Flachbau auseinander gesetzt - so habe Rainer etwa bereits in den 50er Jahren eine frühe Arbeit über burgenländische Flachdörfer veröffentlicht.
„Erinnerung in Werk lebendig“
Betroffen zeigte sich am Samstagabend der Zweite Nationalrats-Präsident Heinz Fischer (SPÖ) über den Tod des Architekten und Stadtplaners Roland Rainer. „Ich habe Roland Rainer seit 45 Jahren persönlich gekannt und sowohl seine Arbeit als Stadtplaner als auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Architekt und nicht zuletzt den Menschen Roland Rainer als einen sozial engagierten und kritischen Demokraten in höchstem Maße geschätzt“, so Fischer.
„Der Schmerz des Abschieds von Roland Rainer wird durch die Gewissheit gemildert, dass die Erinnerung an seine Person in seinem architektonischen Werk lebendig bleiben wird.“
„Mit Roland Rainer ist einer der bedeutendsten Architekten der Nachkriegszeit in Österreich, sowohl was Lehre und Ausbildung betrifft, als auch mit seinen Werken und seiner Architekturphilosophie, gestorben. Mit dem Bau der Stadthalle, eines Gebäudes, welches auch nach über 40 Jahren voll funktionsfähig ist, setzte er ein bemerkenswertes, weit über die Grenzen Österreich ragendes Zeichen“, so er Wiener Planungsstadtrat Rudolf Schicker (SPÖ).
Der Sessel des Architekten
Die funktionalen Sessel-Kreationen von Roland Rainer sind mittlerweile moderne Klassiker.
Die funktionalen Sessel-Kreationen von Roland Rainer sind mittlerweile moderne Klassiker.
Sessel, das weiß man schon von Ludwig Mies van der Rohe, sind eine Herausforderung für Architekten.
Eigentlich, so Roland Rainer, seien Sessel das klassische Gegenteil von Architektur. „Sie sollen nicht monumental sein“, im Allgemeinen auch nicht repräsentativ.
Ruhe und Beweglichkeit
Und, so Rainer zur schwierigen Aufgabe des Sessel-Designs: Sie dienen zweierlei Funktionen, „der Ruhe ebenso wie der Beweglichkeit“.
Rainer hat eine Reihe von minimalistischen Sesseln entworfen, die mittlerweile moderne Klassiker sind. Etwa seine Stapelsessel mit den gelochten Sperrholzsitzen, landläufig bekannt als „Stadthallen-Sessel“.
Rainers Möbelentwürfe sind oft im Zusammenhang mit Aufträgen für öffentliche Bauten entstanden (zum Beispiel der Stadthalle, für die man eine Reihe von stapelbaren Stühlen benötigte).
Klare Handschrift
Die Sessel Rainers tragen letztlich die Handschrift seiner Architektur: klare, funktionale Formen. Klarheit und Einfachheit prägen das Design.
„Der Sessel hat“, so Rainer, „einige Qualitäten mehr (als Architektur). Der Sessel ist die Erholung von der Strenge der Architektur durch die Hingabe an das, was das Leben verlangt.“
Roland Rainer im 94.Lebensjahr verstorben
Der Architekt Roland Rainer ist am Samstag kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres in Wien gestorben. Der gebürtige Klagenfurter hat sich vor allem als Stadtplaner international einen Namen gemacht. Zu seinen Hauptwerken zählen die Wiener Stadthalle und das ORF-Zentrum auf dem Küniglberg.
Der Architekt Roland Rainer ist am Samstag kurz vor Vollendung seines 94. Lebensjahres in Wien gestorben. Der gebürtige Klagenfurter hat sich vor allem als Stadtplaner international einen Namen gemacht. Zu seinen Hauptwerken zählen die Wiener Stadthalle und das ORF-Zentrum auf dem Küniglberg.
Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Salzburger Nachrichten“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()
Vernunft und Leidenschaft
Stadthalle, Donauinsel, ORF-Zentrum: Als langjähriger Stadtplaner hat der Architekt Roland Rainer nicht nur das Erscheinungsbild Wiens geprägt. Am 1. Mai wird er 90.
Stadthalle, Donauinsel, ORF-Zentrum: Als langjähriger Stadtplaner hat der Architekt Roland Rainer nicht nur das Erscheinungsbild Wiens geprägt. Am 1. Mai wird er 90.
Vor den Mitgliedern des Wiener Stadtsenats hielt Roland Rainer im November 1957 einen Vortrag, in dem er seine Auffassungen über die künftige Entwicklung Wiens vorstellte. Rainer, damals Professor in Dortmund, war einer jener drei Kandidaten, die eingeladen worden waren, sich für die Stelle eines Stadtplaners zu bewerben. Einen nicht genannten „großen Stadt- und Landesplaner“ zitierend, verglich Rainer die Arbeit des Stadtplaners mit der eines Teppichwebers: „Andere haben vor ihm gewebt, und andere werden nach ihm weiter weben. Der Wiener Stadtplaner webt an einem sehr kostbaren Teppich, der in der Geschichte aus der Landschaft und den Werken der Menschen entstanden ist.“
Den Wiener Stadträten gefiel der Vortrag sehr, und sie ernannten Rainer zum Wiener Stadtplaner. Im Juni 1962 erschien im Verlag für Jugend & Volk unter der Verlagsnummer 2342/7210/2062 eine Publikation, die man längst „den Rainer-Plan“ nennt. Das leinengebundene, quadratische Buch (31 mal 31 Zentimeter) mit 201 Seiten und der schlichten Überschrift „Roland Rainer Planungskonzept“ ist in jeder Hinsicht ein außerordentliches Werk: zeitlos schöne Typografie, gediegenes Layout, in Farbe gedruckte Karten und Pläne in der Qualität einer Map Art, eine ausgewogene Mischung aus Wissenschaftlichkeit und Emotion, gut geschriebene Fachbeiträge und Essays. All das sollte der Wiener Stadtplanung das verleihen, was sie bis dahin nicht kannte: Rationalität und Leidenschaft.
Das Buch, mit bibliophiler Sorgfalt redigiert und hergestellt, ist eine antiquarische Rarität. Nicht antiquiert hingegen ist nicht nur das Layout, sondern auch der Inhalt. Schon beim Durchblättern und Einlesen fallen zwei Aspekte auf: wie wesentlich und wie vorteilhaft Roland Rainer die Entwicklung Wiens beeinflusst hat (so schlug Rainer etwa die Erschaffung der Donauinsel vor) und wie aktuell seine Ideen (selbstredend nicht alle) geblieben sind. Der Rainer-Plan ist jene Vorlage, nach der - unbewusst - am kostbaren Teppich Wien gewebt wird.
Die Bestellung Rainers zum Wiener Stadtplaner und sein Planungskonzept bedeuteten um 1960 die längst fällige Trennung von den NS-Architektur- und Städtebauvorstellungen, die in Wien nach 1945 weiter galten und gepflegt wurden. „Die ersten Jahre nach der Befreiung gehören zu den dunkelsten Epochen der österreichischen Architekturgeschichte“, schrieb 1965 Sokratis Dimitriou, Kunsthistoriker und damals einflussreicher Protege der Moderne, in der von Hans Hollein herausgegebenen Zeitschrift Bau. Über die besonders wichtige Rolle, die Roland Rainer bei der Überwindung der Stagnation gespielt hat, besteht kein Zweifel. „Der wohl einflussreichste Architekt der Nachkriegszeit ist Roland Rainer, der auch als Stadtplaner von Wien, als Pädagoge und Publizist gewirkt hat“, meinte Dimitriou.
In seinem ebenfalls 1965 veröffentlichten Aufsatz über die „Entwicklung und Situation der österreichischen Architektur seit 1945“ schreibt Friedrich Achleitner: „Die Situation von 1945 schien ausweglos: nicht nur die wirtschaftliche, die naturmäßig das Bauen stark bestimmt, sondern auch die politische und kulturelle ... Den größten Beitrag zu der Verwandlung der allgemeinen architektonischen Situation leistete in der Folge zweifellos Roland Rainer. Er ist der einzige Architekt, der von Anfang an ein klares Konzept erarbeitet hat, das zunächst in einigen Schriften, wie die ,Behausungsfrage', 1947, ,Städtebauliche Prosa' und ,Ebenerdige Wohnhäuser', beide 1948, den Niederschlag findet.“
Auf nächtlichem Himmel, hoch über der düsteren neugotischen Rathaussilhouette, schweben wie supermoderne Luftschlösser strahlende Glaspaläste, oben fliegt, von Westen kommend, ein Jumbo die kommende Weltstadt Wien an, unten braust der Großstadtverkehr, als handelte es sich um New York. In den Fünfzigerjahren war in Wien die moderne Architektur noch ein attraktives Wahlverprechen. „Damit Wien wieder Weltstadt werde, wählt SPÖ“, hieß es auf einem Wahlplakat für die Gemeindewahlen 1954.
Obwohl sie noch gar nicht existierten, ließen sich bereits zwei irdische Bauwerke dieser himmlischen Wien-Vision zweifelsfrei identifizieren: der erst 1955 fertig gestellte Ringturm von Erich Boltenstern und die Stadthalle von Roland Rainer, deren Bau erst 1956 begonnen werden sollte. Auf dem Plakat für die Kommunalwahlen im Herbst 1954 wurde als das Bauwerk der Zukunft Rainers Entwurf für den im Sommer 1954 abgehaltenen internationalen Wettbewerb für die Wiener Stadthalle verwendet. Der finnische Architekt Alvar Aalto, der damals neben Le Corbusier als der bedeutendste Proponent der internationalen Moderne galt, und der Wiener Architekt Roland Rainer, damals Professor an der Technischen Hochschule in Hannover und noch wenig bekannt, mussten sich den ersten Preis teilen. Ausgeführt wurde der Entwurf von Rainer.
So bedauerlich es auch ist, dass nicht der konstruktiv interessante Entwurf von Aalto ausgeführt wurde, so unbestreitbar ist doch die außerordentlich hohe architektonische Qualität der Stadthalle von Rainer. Die Mehrzweckhalle (die 1974 nach einem Entwurf von Rainer um eine große Schwimmhalle erweitert wurde) mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20.000 Zuschauern ist der größte Veranstaltungsraum in Österreich. Das räumliche und architektonische Konzept einer von der Konstruktion ausgehenden Plastizität sowie die sorgfältige Planung und Ausführung erweisen sich weiterhin als so solid und flexibel, dass die Stadthalle seit ihrer Fertigstellung 1958 bis heute tadellos funktioniert und auch ästhetisch nicht veraltet wirkt.
Aufgrund seiner Wettbewerbserfolge wurde Rainer beauftragt, auch die Stadthalle in Bremen (1964) und die Mehrzweckhalle in Ludwigshafen (1965) zu errichten. Die fantasiereiche, aber unaufdringliche Gestaltung, die die drei Stadthallen auszeichnet, sowie die Selbstverständlichkeit, mit der sie im jeweiligen Stadtgefüge - und in der mittlerweile langen Zeitspanne - bestehen, ist für viele Bauwerke von Rainer charakteristisch. Dies gilt für jedes Einzelne der Reihenhäuser in einer der vielen Siedlungen - die bekannteste ist die 1967 entstandene Gartenstadt Puchenau bei Linz - genauso wie für den riesigen, zwischen 1968 und 1985 entstandenen Komplex des ORF-Zentrums auf dem Küniglberg.
Anders als der Architekt der ORF-Landesstudios, Gustav Peichl, erlag Rainer nicht der Versuchung, der ORF-Zentrale ein technoides Aussehen zu verleihen, das die Modernität und Bedeutung bzw. Macht dieser öffentlichen Kommunikationsinstitution zu symbolisieren hätte. Mit dem ORF-Zentrum hat er ein Bauwerk errichtet, das durch die Bedeutung der Funktionalität für die Gestaltung und der Präfabrikation für die Konstruktion manifestartig herausragt. Das ORF-Zentrum ist ein mächtiges, weit sichtbares Bauwerk, das nicht Macht, sondern seinen Dienstcharakter demonstriert.
Gleichzeitig mit der Wiener Stadthalle wurde 1958 ein Bauwerk von Roland Rainer fertig gestellt, das beinahe Kultcharakter hatte und heute unter Denkmalschutz steht (aber, seit Jahren leer stehend, als Spekulationsobjekt bedroht ist): das Böhlerhaus. Dieses Bürogebäude in einer Baulücke auf dem Friedrich-Schiller-Platz gegenüber der Akademie der bildenden Künste war wegen seiner Glas-Aluminium-Fassade und dem Penthaus mit einem bepflanzten Dachgarten „damals als eines der ersten Lebenszeichen einer jungen österreichischen Architekturszene verstanden worden“, wie der 1997 erschienene „Wiener Architekturführer“ vermerkt. Damals, 1958, war Roland Rainer allerdings bereits 48 Jahre alt und seit zwei Jahren Professor an der Akademie (wo er 1980 emeritierte).
Roland Rainer ist ein Architekt, der unbedingt an die Verbesserung der Welt durch die sozial und kulturell verantwortlich agierende Architektur glaubt. Seine als Habilitationsarbeit an der Technischen Hochschule in Wien eingereichte theoretische Schrift „Behausungsfrage“ wurde mit der Begründung abgelehnt, es handle sich um eine „sozialpolitische Propagandaschrift“. 1958 unterbrach er für mehrere Jahre seine Entwurfsarbeit, um das öffentlich ausgeschriebene Amt des Wiener Stadtplaners zu übernehmen. Es war ein Entschluss, der für Rainer selbst nur durch seine „fast irrationale Leidenschaft für Stadtplanung erklärbar“ ist. 1961 legte Rainer sein „Planungskonzept“ für Wien vor, einen Stadtentwicklungsplan, der zu den genauesten und fortschrittlichsten in Europa zählte und der auch in wichtigen Grundzügen verwirklicht wurde - zum Beispiel mit den neuen Stadtzentren oder der Donauinsel. 1963 legte er sein Amt aus Protest gegen politische Verhinderungen der Stadtplanung zurück. Das bedeutete, wie Rainer 1990 schrieb, „auch das Ende jeder Architektentätigkeit im Auftrage der Stadt Wien für die nächsten 25 Jahre“.
Die wahre Leidenschaft Roland Rainers allerdings ist die so genannte anonyme Architektur und naturnahes Bauen. Im Burgenland oder in China, auf dem Balkan oder in der Türkei, in vielen Gegenden der Welt hat Rainer die volkstümlichen Bauweisen analysiert, fotografiert und beschrieben. Das 1976 erschienene Buch „Die Welt als Garten - China“ ist eines von den vielen Büchern, die Rainer zum Thema humanes und ökologisches Bauen veröffentlicht hat. Alle seine Bauten und städtebauliche Studien betrachtet er als Manifeste dieser seiner Auffassung: die Welt als Garten, die Stadt (des Wohnens) als Gartenstadt.
verknüpfte Publikationen
An den Rand geschrieben. Wohnkultur - Stadtkultur
Profil
Studierte 1928-33 an der Technischen Hochschule in Wien Architektur. Er wurde 1950 Mitglied von CIAM Austria und 1953 Vorstandsmitglied des österreichischen Werkbundes. 1953-54 war er Professor an der Technischen Hochschule in Hannover, 1955-56 an der Technischen Hochschule in Graz und 1956-80 Leiter der Meisterschule für Architektur an der Akademie des bildenden Künste in Wien (1960-62 auch Rektor).
Roland Rainer leistete 1958-63 als Stadtplaner von Wien einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung. Er wurde 1980 Präsident des österreichischen Kunstsenats. Er hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorate im In- und Ausland erhalten und gilt in der österreichischen Kulturlandschaft als bewunderte und unangefochtene Autorität.
Unter den zahlreichen Bauten, die Rainer realisieren konnte, kommt seinen Überlegungen zum Thema Wohnbau wahrscheinlich die allergrößte Bedeutung zu.
Publikationen
Roland Rainer & Maria Biljan-Bilger, Verein der Freunde der Maria Biljan-Bilger Ausstellungshalle Sommerein, Müry Salzmann Verlag
Roland Rainer. Das Werk des Architekten 1927-2003, , SpringerWienNewYork
Auszeichnungen
ZV-Bauherrenpreis 2006, Preisträger, Gartenstadt „Rainer-Siedlung“