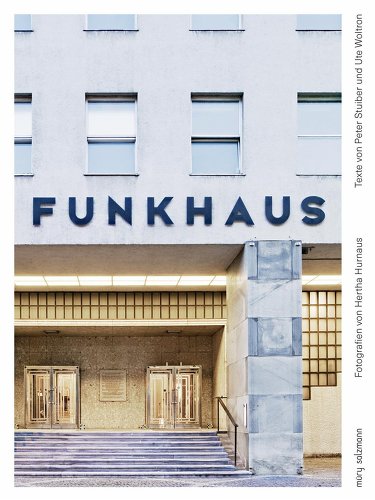Das „Leiner-Haus“ bekommt ein grünes Dach
Alle Jahre kehrt er wieder, der Sommer, und mit ihm steigt die Temperatur in der Stadt. Nun soll das Dach des ehemaligen Leiner-Hauses in der Mariahilfer Straße mit einem öffentlich zugänglichen Garten begrünt werden. Dieser wird Wiens Hitzeproblem nicht lösen – doch zeigt sich ein Weg in eine mögliche neue Richtung.
Alle Jahre kehrt er wieder, der Sommer, und mit ihm steigt die Temperatur in der Stadt. Nun soll das Dach des ehemaligen Leiner-Hauses in der Mariahilfer Straße mit einem öffentlich zugänglichen Garten begrünt werden. Dieser wird Wiens Hitzeproblem nicht lösen – doch zeigt sich ein Weg in eine mögliche neue Richtung.
Angesichts der derzeitigen Witterung kann man es sich zwar noch nicht vorstellen, doch ein nächster Sommer steht bevor und damit die Hitze, die sich über die Städte legen wird. Wo die Sonne auf Beton und Ziegel knallt, wird Wärme gespeichert, und die darunter schmachtende Bevölkerung dreht alle zur Verfügung stehenden Ventilatoren und Klimaanlagen auf. Neben anderen Maßnahmen soll dem eine Begrünung der Städte entgegenwirken, und in unterschiedlichen Ausformungen rückt das Thema Stadtgrün spätestens dann wieder ins Zentrum des Interesses, wenn sich die Stadtbewohner nächtens bei über 30 Grad schlaflos in ihren Betten wälzen.
Große Städte sind absolute Hitzepole, die sogar lokale Klimabedingungen spürbar verändern können. Die aus den Beton- und Glasschluchten aufsteigenden Massen erhitzter Luft entwickeln gelegentlich einen derart mächtigen Sog, dass die feuchten Luftschichten nahe gelegener Meere angesaugt werden, wie etwa im Fall von São Paulo. Die Stadt, könnte man sagen, ruft auf diese Weise Unwetter und Überschwemmungen herbei. Die Begrünung der Städte soll diesen Effekten entgegenwirken, und da man sich bereits seit einigen Jahrzehnten wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzt, darf man mittlerweile davon ausgehen, dass insbesondere die Entsiegelung zugepflasterter Flächen unten sowie die Begrünung von Dächern oben die nachhaltigsten Effekte aufweisen, wenn es um die Nachrüstung mit Grün geht.
Die Studienergebnisse divergieren, die pessimistischsten sprechen von einer Temperaturminderung von etwa sieben Grad Celsius, wenn – eine idealistische Annahme – die Hälfte der Dächer einer Stadt begrünt sind. Das Rathaus von Chicago hat bereits eine dieser Grünzonen unter dem Himmel, der Flughafen in Peking ebenso, und auf dem Dach der Technischen Universität von Singapur liegen die Studierenden im Grünen in der Sonne. Als man in der japanischen Stadt Fukuoka nach einem Baugrund für ein dringend erforderliches neues Verwaltungsgebäude suchte und lediglich der Stadtpark im Zentrum zur Verfügung stand, baute man eine Art Terrassengarten, der sich nun wie eine Hügellandschaft satt überwuchert durchwandeln lässt.
Dachgarten soll Mangel an Grünflächen kompensieren
Die Stadt Wien ist mit relativ vielen Park- und Grünflächen gesegnet, doch sind diese ungleich verteilt. Die Mariahilfer Straße hat zwar einen zauberhaften Alleebewuchs, doch die Gegend ist eine der dichtest verbauten der Hauptstadt, und für Grün ist kaum Platz. Nicht nur aus diesem Grund, aber doch auch als Pilotprojekt wird das soeben im Abriss befindliche ehemalige Leiner-Haus, eine Art Entrée an Österreichs meistfrequentierter Einkaufsstraße, einen öffentlich zugänglichen Dachgarten erhalten. Wie berichtet, wird dort bis Herbst 2024 ein Kaufhaus nach dem Vorbild des KaDeWe errichtet, sowie ein Hotel im anschließenden Baublock. Das Projekt ging aus einem internationalen, geladenen Wettbewerb hervor, beteiligt waren schwere Kaliber wie Snohetta aus Oslo, Hadi Teherani aus Hamburg und BIG Bjarke Ingels Group aus Kopenhagen. Den Zuschlag bekam das Projekt des renommierten holländischen Architekturbüros O.M.A., dessen Gründer und Galionsfigur Rem Koolhaas ist. Bauherrin und Wettbewerbsausloberin ist die Signa Gruppe, die 2018 die Kika-Leiner-Kette übernommen hat.
Ein Dachgarten über der Mariahilfer Straße wird Wiens Hitzeproblem nicht lösen, doch zeigt es den Weg in eine mögliche neue Richtung. Für die Betreiber soll die Parkanlage später Anziehungspunkt und Frequenzbringerin sein und als Alleinstellungsmerkmal wirken. Für die Landschaftsplanung über Dach zeichnet das Büro DnD, Anna Detzlhofer und Sabine Dessovic, verantwortlich. Worauf es wirklich ankommt, sagt Dessovic, seien die präzise Abstimmung und Zusammenarbeit aller Gewerke. Architektur, Statik, Haustechnik und Bauphysik müssen zusammenspielen, ohne „ein intensives Miteinander“ würde das nicht funktionieren. Hitze, Wind, Trockenheit würden den Pflanzen zu schaffen machen, wenn nicht für alle Eventualitäten vorgesorgt ist.
Tatsächlich stellt man sich das alles wesentlich einfacher vor, als es ist. Dessovic berichtet allgemein von steigender Begehrlichkeit, was begrünte Gebäude anlangt: „Doch dann legen die Auftraggeber Fotos von Projekten in Asien vor und müssen wieder in die Realität unserer Klimazone zurückgeholt werden.“ Auf dem Kaufhaus in der Mariahilfer Straße wird es jedenfalls eine sanfte Hügellandschaft geben, mit allem, was dazugehört: Wegen, Bäumen, mit Gräsern bepflanzte Zonen, dazwischen blühenden Stauden. Der Park ist etwa 1000 Quadratmeter groß. Er verfügt über einen eigenen Eingang, ist ohne Konsumzwang zu den üblichen Öffnungszeiten der Wiener Parks frei zugänglich und wird von einer fast doppelt so großen, ebenfalls begrünten, jedoch nicht betretbaren Dachfläche ergänzt.
Pflanzenvorhänge und echte Bäume
Die Landschaftsplanerinnen haben das gesamte Gebäude mit ihrem stimmigen Grünkonzept sozusagen durchzogen. So wird es im Galeriegarten im Bereich zwischen den Baublöcken Kaufhaus und Hotel einen Pflanzenvorhang geben, der Hotelinnenhof bekommt eine Seilkonstruktion für Kletterpflanzen, Hotel- und Restaurantterrassen werden ebenfalls begrünt. „Das alles allerdings in einer durchgängig gleichen Typologie“, sagt Dessovic, „also ruhig und ohne Firlefanz.“ Kurz noch zu den Bäumen: Flaumeichen, Rotkiefern, Tulpenmagnolien und die prachtvoll herbstgefärbten Persischen Eisenholzbäume geben das lichte Wäldchen über den Dächern von Wien.
Ein Dachgarten kostet Platz, erfordert hohe Aufbauhöhen, stellt hohe Anforderungen an Statik und Haustechnik. Plant man ihn von Beginn an als „Intensivbegrünung“ mit, wird die Sache realistisch. Will man jedoch ein Bestandsdach begrünen, wird man meist auf die „extensive Begrünung“ mit viel geringeren Flächenlasten und minimalem Pflegebedarf zurückgreifen. Die Begrünung von Fassaden hingegen bleibt eine fragwürdige Variante, denn dabei handelt es sich um einen hoch technischen Vorgang, der von Außenstehenden gewöhnlich krass unterschätzt wird.
Es reicht nicht, ein Klettergerüst an der Fassade zu montieren und ein paar Kletterpflanzen einzugraben. Dessovic: „Der Aufwand wird vielfach völlig unterschätzt, und es wird vieles falsch gemacht, bis hin zur ungeeigneten Maschenbreite der Klettergerüste und den verwendeten Pflanzen.“ Für die Landschaftsplanerinnen war somit neben den technischen Voraussetzungen die Wahl der richtigen Gewächse maßgeblich. Der Park auf dem Dach soll ein ausgeklügeltes Puzzle sein, in dem es je nach Jahreszeit unterschiedliche Blühstimmungen sowie Wind- und Lichtspiele in Gräsern und Bäumen geben soll. Nach seiner Eröffnung wird er von Fachpersonal zu betreuen sein – ein Aspekt, der auch gerne vergessen wird.
Spectrum, Sa., 2021.05.29