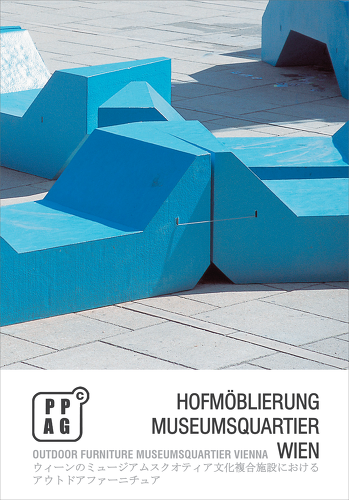In Bratislava liegt einer der größten Plätze Europas. Wie es dazu kam, dass er Freiheitsplatz heißt, welche Wiener Architekten dort Geld verdient haben, was er mit Godards Film „Le Mepris“ zu tun hat und woher sein italienisches Flair stammt, erzählen
In Bratislava liegt einer der größten Plätze Europas. Wie es dazu kam, dass er Freiheitsplatz heißt, welche Wiener Architekten dort Geld verdient haben, was er mit Godards Film „Le Mepris“ zu tun hat und woher sein italienisches Flair stammt, erzählen
Die Art, wie das nationalsozialistische Deutschland mit Kunst und Architektur des faschistischen Italien umging, war einer der besten Treppenwitze der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Man könnte sagen, die Nazis sind vor der italienischen Kultur verlegen geworden, aber eigentlich fühlten sie Abscheu. Außerdem fürchteten sie, die italienische Kunst könnte ihren nach der Machtergreifung im Jänner 1933 mit Brachialgewalt eingeleiteten „Gesundungsprozess“ der deutschen Kunst beeinträchtigen. Zu Beginn der Naziherrschaft hatten einflussreiche NS-Bonzen wie Propagandaminister Joseph Goebbels oder Luftwaffenmarschall Hermann Göring versucht, einige Künstler und Teile der deutschen Moderne, vor allem den Expressionismus und die Neue Sachlichkeit, doch irgendwie der mit ideologischem Kitsch vollgestopften NS-Kunstdoktrin einzupassen. Auch manche Vertreter der Architekturavantgarde, wie Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, hegten zunächst die Hoffnung, die revolutionären Auffassungen ihres Bauhaus-Stils könnten für die Zwecke des Nationalsozialismus adaptiert und dem Geschmack der Nazibonzen angepasst werden. Selig blickte man südwärts. Denn Mussolinis Italien nährte die Hoffnungen mancher Avantgarde-Narren, der Nationalsozialismus könnte auch so fesch sein wie der Faschismus.
In Italien hatte sich die radikale Moderne mit dem Faschismus verbündet - ja mehr noch, diese Moderne hatte den Faschismus miterfunden und so die Position einer groß geförderten und gehätschelten Staatskunst und -architektur errungen. Auch jene Künstler, die nicht zu den Bevorzugten des Regimes gehörten - schließlich gab es Radikale und Konservative der Moderne, die einander nicht mochten - konnten zumindest auf die Duldung durch die faschistischen Machthaber bauen. Davon waren die Modernen in Nazideutschland weit entfernt - und ihre Hoffnung auf italienische Verhältnisse blieb Illusion. Von seltenen Ausnahmen abgesehen, fand hier keine Rezeption der italienischen Kunst und Architektur statt. Es gab kaum Ausstellungen, und jene zwei, die veranstaltet werden durften, endeten mit einem politischen Eklat.
Zum ersten Skandal kam es im Frühjahr 1934. Am 28. Februar wurde im Hamburger Kunstverein eine Ausstellung des italienischen Futurismus, in seiner Spätphase Aeropittura (Flugmalerei) genannt, eröffnet. Im März kam die kleine Schau nach Berlin, in die ehemalige Avantgarde-Galerie Flechtheim am Lützowufer. Sie stand unter dem Ehrenschutz von Goebbels, Göring und Erziehungsminister Rust sowie Vittorio Cerruti, dem italienischen Botschafter in Berlin. Aus Italien war Fillippo Tommaso Marinetti angereist, der „Hersteller und Direktor des Futurismus“, wie der Dichter Gottfried Benn ihn nannte. Marinetti erschien in der Funktion des Präsidenten der italienischen Akademie der Wissenschaften. Nach der Eröffnung lud die „Union Nationaler Schriftsteller“ zum Empfang in den Festsaal des Hauses der Deutschen Presse. Diesem blieben allerdings, wie zuvor schon der Vernissage, alle wichtigen offiziellen Persönlichkeiten des NS-Regimes fern. Hingegen kamen einige Proponenten der deutschen Moderne, unter anderen der Dadaist Kurt Schwitters und der Bauhaus-Künstler Laszlo Moholy-Nagy mit Gattin Sibyl.
In der Festrede feierte Gottfried Benn Fillippo Tommaso Marinetti als den Vorboten einer der Moderne freundlichen NS-Kunstpolitik. Zum Entsetzen seiner Freunde gab er seine Zustimmung zur Nazipropaganda von „Form und Zucht“ als „Grundlage des imperialen Weltbildes“ im neuen Deutschland: „Form: in ihrem Namen wurde alles erkämpft, was Sie im neuen Deutschland um sich sehen; Form und Zucht: die beiden Symbole der neuen Reiche; Zucht und Stil im Staat und in der Kunst“. Zum Glück verstand Marinetti kein Deutsch. Statt sich Benns Rede zu Herzen zu nehmen, sprach er mit Kurt Schwitters dem süßen Rheinwein zu. Dann rezitierte er, um die trübe Stimmung zu heben, die „parole in liberta“ (Worte in Freiheit) aus seinem alten onomatopoetischen Text „Adrianopoli Assedio Orchestra“. Der bereits betrunkene Schwitters sprang auf und fiel in Marinettis Vortrag ein. Er deklamierte sein legendäres Dada-Gedicht „Anna Blume“. Hinterher stellte er sich, wie Sibyl Moholy-Nagy in ihren 1950 erschienenen Erinnerungen „Ein Totalexperiment“ schreibt, einem Kraft-durch-Freude-Funktionär als „arischer Künstler“ vor.
Der Völkische Beobachter, Hauptorgan der NSdAP, veröffentlichte einen polemischen Aufsatz gegen die Futuristen-Ausstellung, der sich gegen Marinetti richtete. Er hatte als italienischer Abgesandter die Stellung eines Staatsgasts, trotzdem wurde er als Anarchist bezeichnet. Die „avantgardistische Walpurgisnacht“, wie es der Germanist Peter Demetz in seinem Buch „Worte der Freiheit. Der italienische Futurismus und die deutsche literarische Avantgarde 1912-1934“ nennt, hatte Folgen. In seiner Rede am Nürnberger Reichsparteitag im September 1934 erklärte Hitler unmissverständlich: Der deutschen Kunst drohe Gefahr von „Kubisten, Futuristen, Dadaisten“; er wolle gesunde deutsche Kunst. Die zweite Ausstellung der italienischen Moderne fand im November 1937 in Berlin statt. Sie war nur kurze Zeit zu sehen. Berichte gab es ausschließlich in der ausländischen Presse, und dort wertete man sie als Sensation. Der christliche Ständestaat, das Organ des austrofaschistischen Regimes, spottete über die Inkonsequenz der Nazis, einerseits mit der Ausstellung „Entartete Kunst“ in München gegen die eigene „Verfallskunst“ zu kämpfen und andererseits die italienische Verfallskunst in einer anderen Ausstellung als akzeptabel zu präsentieren.
Die gleichgeschalteten deutschen Medien - einschließlich der Fachpresse - vermieden seit 1934 jegliche Berichterstattung über die italienische Kunst. Italien war der engste Verbündete Nazideutschlands, Benito Mussolini galt bis zur Machtergreifung der Nazis als nachahmenswertes Vorbild für Adolf Hitler. Daher konnte man nicht veröffentlichen, was man vom Großteil der faschistischen Kunst- und Architekturproduktion hielt (und auch gern geschrieben hätte): „entartet, krankhaft und judobolschewistisch“. Freilich war nicht die gesamte Kunst- und Architekturproduktion in Italien so avantgardistisch, dass sie den Augen der strengen deutschen Betrachter in ihrer Gesamtheit als entartet erscheinen musste. Dies stellte die nazideutschen Kunst- und Architekturbetrachter - Kritik war verboten - vor ein Problem: Sie konnten nicht eindeutig definieren, was entartet war und was nicht. Als weitere Schwierigkeit kam hinzu, dass viele bedeutende italienische Künstler Juden waren - in Mussolinis Reich anfangs kein großes Thema. So hatte etwa der jüdische Künstler Corregio Cagli den italienischen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung von 1937 mit monumentalen Bildern einer Apotheose des Faschismus ausgestattet. Alles in allem war es für die Zeitungen in Nazideutschland ratsamer, auf Berichte über italienische Kunst und Architektur völlig zu verzichten, als womöglich einen Fauxpas zu begehen.
1938 begann sich die Situation in Italien im Sinne Nazideutschlands zu klären. Die faschistische Regierung übernahm die Nürnberger Rassengesetze und begann Juden zu verfolgen. Marinetti fertigte eine Liste an, die auswies, wer von den italienischen Avantgardisten Jude war. Daraufhin musste Cagli aus Italien flüchten. Die rechte Fraktion der Faschisten um den Parteisekretär Roberto Farinacci eröffnete den Kampf gegen die Moderne und für die Durchsetzung der deutschen Stildoktrinen in Kunst und Architektur. Die Avantgarde wurde als „judobolschewistische Entartung“ diffamiert. Viele wollten nicht weiter mitmachen, auch viele Faschisten nicht. Das Regime begann zu zerfallen. Am 10. Juli 1943 begann die Invasion der Alliierten auf Sizilien. Fünfzehn Tage später setzte der Gran Consiglio del Fascismo (Großer Faschismusrat) Mussolini als Duce ab und arretierte ihn in einem Berghotel in Gran Sasso. Am 13. Oktober 1943 erklärte Italien Deutschland den Krieg.
Im Dezember 1943 erschien in Berlin eines der letzten Hefte der von Albert Speer herausgegebenen, luxuriös ausgestatteten Zeitschrift Die Kunst im Deutschen Reich. Nicht nur Druckpapier war knapp, auch an guten Nachrichten von der Kunst- und Baukunstfront mangelte es zunehmend. Das dürfte der Grund gewesen sein, weshalb in dieser ideologisch stets einwandfrei gehaltenen Zeitschrift ein Aufsatz stand, der noch wenige Monate zuvor als unpublizierbar erachtet worden wäre. Eine Reihe von Fotos zeigte bemerkenswerte Beispiele des tschechischen Funktionalismus und des italienischen Rationalismus. Sie wurden analytisch kommentiert und nur schwach mit Hohn überzogen. Der Artikel handelte von den Aufbauplänen in Bratislava, einer Provinzstadt, die sich anschickte, eine Hauptstadt zu werden. Bratislava wurde dabei von einer anderen Provinzstadt des Großdeutschen Reiches, nämlich Wien, im Interesse der nationalsozialistischen Politik schwesterlich betreut. So stand es freilich in Speers Zeitschrift nicht zu lesen.
Sondern so: „Es ist ein Vorrecht junger und lebenskräftiger Staaten, dass sie durch bauliche Monumente ihren Daseinswillen für die Zukunft verankern. Wie es eine der ersten Lebensregungen des neuen Deutschlands unter der Führung Adolf Hitlers gewesen ist, im Bild einer aus dem neuen Geist heraus umgestalteten Hauptstadt dem Volk für Gegenwart und Zukunft den sicheren Mittelpunkt des Reiches zu verkörpern, so hat nunmehr auch der verbündete slowakische Staat mitten im Kriege einen ähnlichen Weg beschritten. In einem Regierungsviertel, das die Zentralpunkte des politischen Lebens der Nation in einheitlicher Gestaltung symbolhaft zusammenfassen wird, und in einer Hochschulstadt als sichtbarem Ausdruck der geistigen Kräfte des Volkes sollen die Grundlagen des jungen Staates dargestellt werden.“ Der Autor des mit „Die Formung einer Hauptstadt“ überschriebenen Aufsatzes hieß Hans Stephan.
Was war das für ein junger Staat? Am 29. September 1938 hatten Hitler, Mussolini, der britische Ministerpräsident Chamberlain und sein französischer Kollege Daladier in München beschlossen, dass die mit Frankreich und Großbritannien durch Verträge verbundene Tschechoslowakei die sudetendeutschen Gebiete an Nazideutschland abtreten müsse. Am 21. November 1938 erließ Hitler den Geheimbefehl zur „Erledigung der Rest-Tschechei“; am 15. März 1939 besetzten die deutschen Truppen die Reste der Tschechoslowakei; am 16. März 1939 proklamierte Hitler in Prag die Errichtung des „Reichsprotektorats Böhmen und Mähren“. Doch zwei Tage zuvor schon war „der junge Staat“ geboren worden: Am 14. März 1939 hatte man den selbstständigen slowakischen Staat ausgerufen. Seine politische Form war die klerikalfaschistische und nationalistische Diktatur nach deutschem Vorbild - vor allem, was die Verfolgung von Juden und Zigeunern betraf. Es herrschte jedoch auch eine Vorliebe für das Italienische. Denn viele der Kleriker, die den Kern der slowakischen Elite bildeten und damit den Ton im ersten selbstständigen Staat in der Geschichte der Slowaken angaben, hatten sich in Rom als Seminaristen oder Pilgerreisende aufgehalten. In Berlin war kaum einer von ihnen je gewesen.
Die Architekturgeschichte besteht aus zwei Geschichten: aus einer Geschichte der gebauten und einer der ungebauten Architektur. Außerdem zerfällt sie, wie jede Geschichte - selbst die Weltgeschichte - in eine geschriebene (beachtete, erforschte) und ungeschriebene (unbeachtete). Der slowakische Staat, dieser bedeutungslose und machtlose Vasall am Rand des Großdeutschen Reiches, trug zur Weltgeschichte der gebauten Architektur nicht nennenswert bei. Doch lieferte er einen einzigartigen Beitrag zur Geschichte der ungebauten europäischen Architektur.
Ausgangspunkt waren zwei internationale Wettbewerbe, an denen Architekten aus Nazideutschland, der Ostmark, Italien, dem Protektorat Böhmen und Mähren sowie der Slowakei teilnahmen. Das Einzigartige daran war, dass es zu einer einmaligen direkten Konfrontation zweier entgegengesetzter Architekturauffassungen kam: NS-Klassizismus versus italienischer Rationalismus. Obwohl mittlerweile eine umfangreiche Literatur zum Thema totalitäre Architektur existiert, sind die beiden Wettbewerbe in Bratislava von den Architekturhistorikern bisher unbeachtet geblieben. Die Umstände, unter denen dieses Stück Architekturgeschichte stattfand, waren für das Dritte Reich der Anfang vom Ende. Am 18. November 1942 kam die deutsche Sommeroffensive in Russland zum Erliegen. Tags darauf eröffnete die Rote Armee ihre Wintergegenoffensive und schloss drei Tage später den Ring um Stalingrad. Hitler verbot der deutschen Armee den Ausbruch aus dem Kessel.
Im Dezember 1942 fasste die Regierung des slowakischen Staates den Beschluss, in der Hauptstadt Bratislava ein repräsentatives Regierungsviertel zu errichten. Das Ministerium für Verkehr und öffentliche Arbeiten schrieb einen „internationalen, nicht anonymen, engeren“ - heute würde man sagen „geladenen“ - Wettbewerb aus. Eingeladen wurden vier slowakische und drei ausländische Architekten- (gruppen). Die Aufgabe umfasste die Planung einer Reihe von Gebäuden: von vier Ministerien, einem Zentralpostamt, zwei weiteren Verwaltungsgebäuden, einem Haus der Hlinka-Partei und einem Haus der Deutschen Partei sowie einem Hlinka-Denkmal und einem Grabmal des unbekannten Soldaten. Die Bauten sollten um einen etwa fünf Hektar großen Platz gruppiert werden, der für Militäraufmärsche Massenkundgebungen und Veranstaltungen der Partei zu dienen hatte. Die beiden monumentalen Parteihäuser sollten dafür eine geeignete Kulisse bilden. Zu berücksichtigen war dabei das barocke erzbischöfliche Palais, jetzt Sitz des Außenministeriums.
Es stand ein wenig abseits, am Rand einer riesigen Brache, dem „Marsfeld“ von Bratislava. Hier fanden Jahrmärkte, Militärübungen und -paraden, Zirkusvorstellungen, Massenkundgebungen und dergleichen statt, und hier war Jan Bahyl 1897 als Erster mit einem von ihm konstruierten Hubschrauber aufgestiegen. Dieses Feld würde der Mittelpunkt des neuen Regierungsviertels bilden. Einst Fürstenplatz genannt, gab ihm der junge slowakische Staat den Namen „Freiheitsplatz“. Im Volksmund hieß er wegen des wüsten Zustandes Sahara. Fristgerecht zum 1. Mai 1943 wurden vier Projekte eingereicht. Den ersten Preis teilte die Jury Josef Gocar zu - eine überraschende Entscheidung. Es war ja schon erstaunlich, dass der Tscheche Gocar überhaupt eingeladen worden war. Die Slowaken mochten Tschechen nicht besonders. Sie hielten sie für gönnerhafte Besserwisser. Allerdings sagte man Gocar eine slowakische Großmutter nach.
Der Architekt aus Prag war durch originelle kubistische Bauten bekannt geworden. Er entwickelte sich zum führenden Architekten des tschechischen Funktionalismus, dem nicht deklarierten Staatsstil der demokratischen tschechoslowakischen Republik.
Für Bratislava wartete er mit einem Entwurf auf, der aussah, als hätte die demokratische Tschechoslowakei nie zu existieren aufgehört. Gocar verzichtete nicht nur auf die hierarchische Abstufung der Gebäude, sondern auch auf die repräsentative Gestaltung der Amtsbauten. Außerdem hielt er sich nicht an die Forderung nach einem großen Platz für Massenaufmärsche. Im Gegenteil: Er verkleinerte die Platzfläche erheblich und teilte sie auf zwei miteinander verbundene, doch selbstständige Plätze auf. Gocar war ein erfahrener Praktiker. Er kannte seine Pappenheimer und die Pappenheimer kannten ihn. Wahrscheinlich waren die meisten Architekten der rein slowakischen Jury Anhänger des Funktionalismus und ebenso wahrscheinlich auch Absolventen einer Prager Architekturschule. Sie erkannten die hohe städtebauliche Qualität und vor allem den Realismus in der Abwicklungstechnik in Gocars Entwurf.
Den zweiten Preis teilten sich zwei Arbeitsgemeinschaften: Adalberto Libera und Ernesto La Padula aus Rom sowie Siegfried Theiss, Hans Jaksch und Werner Theiss aus Wien. Dies war eine politische Entscheidung. Vor dem Krieg hatten Theiss/Jaksch zu den bedeutendsten gemäßigt modernen Architekten Österreichs gehört. In Wien errichteten sie unter anderem 1930 das Hochhaus in der Herrengasse und 1936 die Reichsbrücke - sie sollte 40 Jahre später einstürzen. Auch heute noch sind sie in der Stadt fast allgegenwärtig: Die Palmers-Lokale stammen von ihnen. Sie wurden in den Dreißigerjahren entworfen und weisen tatsächlich zeitlose Designqualität auf. Nach dem „Anschluss“ schlossen sie sich sofort begeistert und bedingungslos dem Nationalsozialismus und dessen Architekturdoktrin an. Diese war von Albert Speer und Hitler festgelegt worden und wurde in den von Speer herausgegebenen Publikationen allgemein bekannt gemacht. Der Entwurf von Theiss/Jaksch für Bratislava war kaum mehr als eine Variante der häufig geplanten Gauanlagen, mit denen die deutschen Städte bestückt werden sollten: ein riesiger, maßstabsloser Aufmarschplatz, umrahmt von gewaltigen neoklassizistischen Baumassen, hierarchisch geordnet, funktional gleichgültig und hauptsächlich eine übermächtige Kulisse. Dominierend war eine Monumentalsäule a la Trajan für den Säulenheiligen des slowakischen Faschismus, Pater Andrej Hlinka. Die Jury sprach ein leichtes Lob für die künstlerische Qualität der Gesamtanlage aus, kritisierte aber ungewöhnlich deutlich die Einzelteile des Entwurfes.
Die Einladung an das Büro Theiss/Jaksch - mit einem beachtlichen Teilnahmegeld - erfolgte wohl, weil Theiss in Bratislava geboren worden war. Trotzdem zeigte er sich ungemein stolz auf seinen Bratislava-Wurf. Er ließ sich mit dem Modell des Regierungsviertels in Hintergrund für das vom Wiener Gauleiter Baldur von Schirach geplante Walhalla für Wiener porträtieren. Von Schirach beabsichtigte, den Theseustempel aus dem Volksgarten auf den Heldenplatz zu versetzten und dort die Wiener Ruhmeshalle einzurichten. Dafür wurden bei Wiener NS-Malern zahlreiche Porträts bestellt, auch eines von Theiss. Das Gemälde befindet sich heute im Depot des Historischen Museums. Adalberto Libera hatte man vermutlich eingeladen, weil er 1941 Juror beim internationalen - ausdrücklich nur für „arische Fachleute“ offenen - Wettbewerb für den Aufbau der Universitätsstadt in Bratislava gewesen war. Damals wurden 24 Entwürfe eingereicht. 16 aus dem Deutschen Reich und der Ostmark, fünf aus der ehemaligen Tschechoslowakei und drei aus Italien. Keiner erfüllte die Erwartungen, es wurde kein erster Preis vergeben. Den zweiten Preis erhielten ex aequo Hans Wolfgang Draesel / Willi Kreuer aus Berlin für Doktrintreue und die Brüder Ernesto und Attilio La Padula aus Rom für einen rationalistischen Entwurf.
Kulturpolitisch bemerkenswert war die Teilnahme der Brüder Ernst und Wassili Luckhardt aus Berlin. Sie waren Mitglieder linker Künstlervereinigungen wie des „Arbeitsrates für Kunst“ und der „Novembergruppe“ und wurden später als besonders konsequente Vertreter der rationalistischen Architektur in Deutschland international geschätzt. Während der NS-Zeit hatte man sie mit Berufsverbot belegt, doch tauchten sie plötzlich beim Wettbewerb in Bratislava auf. Es wäre interessant herauszufinden, unter welchen Umständen sie daran teilnehmen durften - hatte sich ihre Auffassung inzwischen verändert? Schon 1933 war von ihnen ein bemerkenswerter Wettbewerbsentwurf für die medizinische Universität auf dem Burgberg in Bratislava abgegeben worden. Ernesto La Padula, mit dem Adalberto Libera zum Wettbewerb ums Regierungsviertel von Bratislava antrat, war der Architekt jenes monumentalen Palazzo della Civilta Italiana, der am Rand des neuen Stadtteils EUR 42 von Rom für die Weltausstellung 1942 errichtet wurde. Wegen seiner formalen Ausgefallenheit sollte er nach dem Krieg zu einem der am häufigsten abgebildeten Bauwerke des Faschismus werden. Die Römer nennen das Baumonument, das nur aus Arkaden zu bestehen scheint, ein „quadratisches Kolosseum“.
Libera selbst gilt als der erfolgreichste Architekt Italiens im 20. Jahrhundert. Seine Fähigkeit, die faschistische Ideologie in die Formen radikaler Avantgarde umzusetzen, war einzigartig - unter anderem errichtete er die italienischen Pavillons bei den Weltausstellungen in Brüssel 1935 und New York 1939. In Bratislava engagierte er sich mit einem Entwurf aus kriegsbedingter Unterbeschäftigung - zumindest steht das in seiner Monographie. Außerdem dürfte er von der Professionalität und Objektivität beeindruckt gewesen sein, mit dem die Slowaken den Universitätswettbewerb, bei dem er Juror gewesen war, vorbereitet und durchgeführt hatten. All die Avantgardisten, die am Wettbewerb für das Regierungsviertel in Bratislava beteiligt waren, waren brutale Opportunisten - Libera, La Padulas, Gocar und die Luckhardts. Sie wussten, dass jüdische Architekten ausgeschlossen waren, dass Juden deportiert wurden und billigten es oder nahmen es hin.
La Padula und Libera lieferten einen Entwurf in bester Qualität: eine italienische Synthese von faschistischer Monumentalität und internationaler Modernität. Sie beließen den Platz, der zu den größten Europas zählt, in seinen unbewältigbaren Maßen und umgaben ihn mit einem städtebaulichen Rahmen aus eher niedrigen Gebäuden. Dominiert wird er von einer schmalen, hohen Scheibe, dem Haus der Hlinka-Partei. Ein riesiges Vordach, das als Balkon und Tribüne dienen kann, vervollständigte diese eindrucksvolle Inszenierung faschistischer Macht. Die Inszenierung war das Metier von Libera. Das zeigt sich auch am Haus, das er für den Schriftsteller Curzio Malaparte 1939 auf Capri errichtet hat. Es ist eine der Ikonen der Moderne und durch den 1963 gedrehten Film „Die Verachtung“ von Jean-Luc Godard weltberühmt geworden. Neben dem Haus Malaparte spielen Brigitte Bardot, Michel Piccoli und Fritz Lang (als Fritz Lang) Hauptrollen.
Eine andere Inszenierung, sein Entwurf eines 100 Meter hohen dünnen Stahlbogens, der über der EUR 42 aufgespannt werden sollte, wurde zum Signet der baulich weit fortgeschrittenen, dann aber verschobenen Weltausstellung. Nach dem Krieg wurde der Libera-Bogen von dem finnisch-amerikanischen Architekten Eero Saarinen als „Denkmal für Thomas Jefferson und die Eroberung des Westens in St. Louis, Missouri“ errichtet. Begleitet wurde der Bau von langwierigen Prozessen, die Libera wegen Verletzung seiner Autorenrechte führte. Der Platz der Freiheit in Bratislava wurde nach der Befreiung und der Wiederherstellung der Tschechoslowakei erneut umbenannt. Nun trug er den Namen des ersten kommunistischen Staatspräsidenten Klement Gottwald und eine riesige Skulptur des Politikers. 1989 wurde sie abgetragen. Der Platz heißt nun wieder Freiheitsplatz.
1946 errichteten die slowakischen Architekten Eugen Kramar und Stefan Lukacovic an der Stelle, an der Libera das Haus der Hlinka-Partei geplant hatte, das Gebäude der Zentralpost. Es kann in vieler Hinsicht als die Verwirklichung des Libera-/La-Padula-Entwurfes gelten. Die beiden waren das einzige slowakische Architektenteam, das am Wettbewerb fürs Regierungsviertel 1943 teilgenommen hatte. Ihr Entwurf war - zu Recht - abgelehnt worden. Auf der anderen Seite des Platzes errichtete 1947 Emil Bellus das Gebäude der Architekturfakultät der TU. 1955 fand ein weiterer Wettbewerb statt. Diesmal war Monumentalität im Stil des sozialistischen Realismus verlangt. Doch noch im selben Jahr wurde die Doktrin des sozialistischen Realismus von Sergej N. Chruschtschow als unproduktiv abgesetzt - wieder musste die Vervollständigung vertagt werden. Erneut brach die Diskussion über den Libera-/La-Padula-Entwurf aus, von dem die Architektengemeinde in Bratislava nach wie vor fasziniert war. Im Sinn dieses Entwurfes wurde 1961 die untere Kante des Platzes mit einem mächtigen Komplex der Maschinenbaufakultät der TU abgeschlossen. Auch der Architekt M. Kusy' lehnte sich deutlich an den Libera-Entwurf an. Der Freiheitsplatz besitzt also durchaus einen Hauch des eleganten italienischen Rationalismo.
Auch die Wiener Theiss/Jaksch/ Theiss gingen bei der Geschichte des Platzes nicht leer aus. Die deutschstämmigen Nazis aus Pressburg fühlten sich durch den Sieg eines Tschechen beleidigt und beauftragten noch 1942 Theiss, den großen Sohn ihrer Stadt, mit dem Bau eines repräsentativen Parteihauses abseits des Freiheitsplatzes. Beendet wurde die Bauscheußlichkeit 1948, just in jenem Jahr, in dem die Kommunisten siegten, Klement Gottwald zum ersten „Arbeiterpräsidenten“ machten, und der wieder hergestellte gemeinsame Staat der Tschechen und Slowaken ein Vasall am Rande des Stalin-Reiches wurde. Mittlerweile ist der Freiheitsplatz ein schöner großer Park geworden.
Falter, Mi., 2001.06.13
![]()