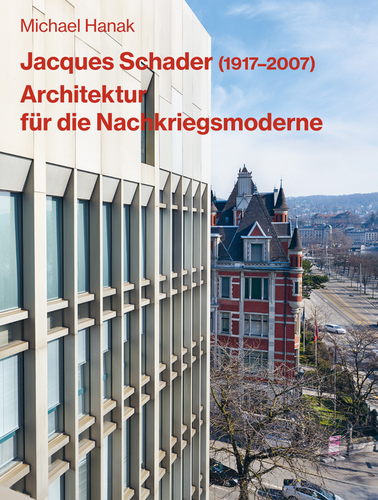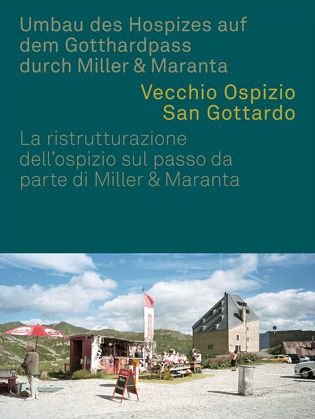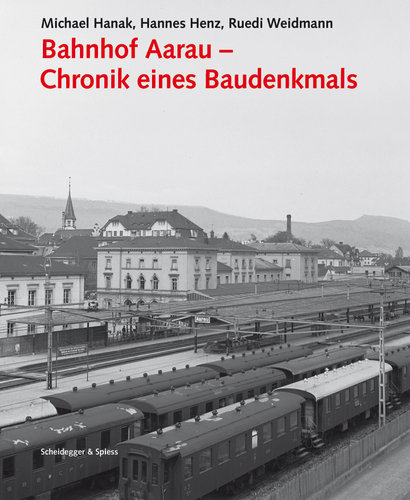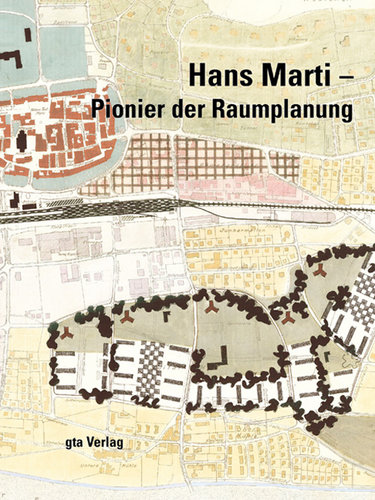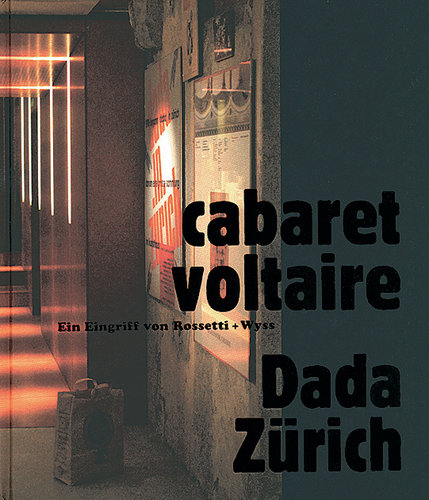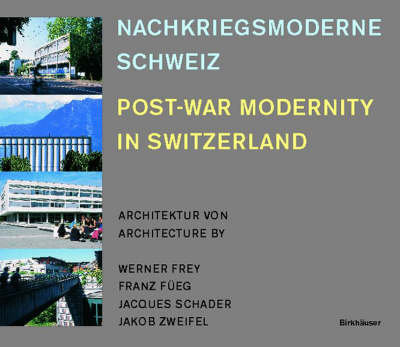Zurück in die Zukunft
Das Museum für Gestaltung und die daran anschliessende Gewerbeschule gelten als Ikonen des Neuen Bauens. Ruggero Tropeano Architekten haben den Museumstrakt in seine ursprüngliche Form zurückgeführt und ihn zugleich für die Zukunft ertüchtigt.
Das Museum für Gestaltung und die daran anschliessende Gewerbeschule gelten als Ikonen des Neuen Bauens. Ruggero Tropeano Architekten haben den Museumstrakt in seine ursprüngliche Form zurückgeführt und ihn zugleich für die Zukunft ertüchtigt.
Ansporn und Herausforderung zugleich waren die unverkennbaren Qualitäten des ursprünglichen Baus, die bei der aktuellen Instandsetzung unbedingt erhalten bleiben mussten: Er gilt als Zürichs erstes öffentliches Gebäude im Stil des Neuen Bauens. Projektiert hatten ihn Karl Egender und Adolf Steger. Sie waren als Sieger aus dem zwischen 1925 und 1927 in zwei Durchgängen ausgetragenen Wettbewerb hervorgegangen, den die Stadt Zürich nach langer Vorgeschichte und Vorbereitungszeit durchgeführt hatte.[1]
Angeregt durch die politischen und gesellschaftlichen Reformen wagten sich die Architekten während der Weiterbearbeitung des Projekts immer weiter in die Abstraktion.
Die zunehmend mutigere Umsetzung lässt sich an den drei Flügeln des Komplexes ablesen: Der zuerst geplante Schulbau, geprägt von einem weit gespannten Achsmass, das grosse Fensterflächen zulässt, erscheint noch relativ konventionell. Die Anlehnung an eine basilikale Form für die Ausstellungshalle im Mittelteil ist bereits als eine Provokation zu betrachten, während der expressive Kubus an der Ausstellungsstrasse mit seinen Fensterbändern und der sorgfältig gesetzten Beschriftung von den neuen Leitbildern zeugen.
Der Kunsthistoriker Sigfried Giedion nahm unterstützend Einfluss auf die Form: Er forderte einen zwanglosen, funktionalen Charakter, ohne Lichthöfe.[2] Als wegweisend hinsichtlich Modernität galt natürlich das Bauhaus in Dessau. Wie zur gleichen Zeit bei der Siedlung Neubühl und dem Geschäftsgebäude Zett-Haus suchte man für Kunstgewerbemuseum und Gewerbeschule nach einer zukunftsorientierten Form – ein Ansatz, der nicht unumstritten war. So war von «Architektur-Bolschewismus einiger exzentrisch veranlagter Künstler» die Rede; und der deutsche Heimatschützer Paul Schultze-Naumburg kritisierte, man könne den Bau nicht von einer Schuh- oder Fahrradfabrik, von Werkstätten für kosmetische Artikel oder einer Milchzentrale unterscheiden.[3]
Neue Technik und mehr Platz
Im Lauf der Jahre hat das 1930 bis 1933 errichtete Museumsgebäude einige Veränderungen erfahren (vgl. Chronologie, Kasten unten). Einschneidend war der Einzug eines Zwischenbodens im doppelgeschossigen Bereich der Ausstellungshalle 1958, auf der Höhe der rundum verlaufenden Galerie. In den 1990er-Jahren erfolgte, als es dringend notwendig geworden war, die Renovation der Fassaden und des Flachdachs. Zuvor war der Bau unter Denkmalschutz gestellt worden und von der Stadt an den Kanton übergegangen. Nach dem Umzug der Zürcher Hochschule der Künste ins Toni-Areal 2014, in dem das Museum für Gestaltung Zürich einen zweiten Ausstellungsort erhielt (vgl. TEC21 39/2014), konnten nun der Museums- und der Schultrakt instandgesetzt werden – notabene jeder für sich und durch verschiedene Architekten (für den Umbau der ehemaligen Kunstgewerbeschule zeichneten Silvio Schmed und Arthur Rüegg verantwortlich).
Den Anstoss zum jetzigen Umbau, der seit Jahren angedacht war[4], gab die Museumsleitung, die die Ausstellungskonditionen bezüglich Raumklima und Brandschutz für untragbar erklärte. Die konservatorischen Bedingungen entsprächen nicht mehr den internationalen Richtlinien. Ziel war es, den einzigartigen Charakter des Gebäudes zu erhalten und es gleichzeitig zeitgemässen Museumsstandards anzupassen.
Umgang mit einem Meisterwerk
Seit der Wiedereröffnung des führenden Schweizer Museums für Design und visuelle Kommunikation im März 2018 erleben die Besucher dessen eindrückliche Architektur aussen wie innen in ihrer ursprünglichen Intensität. Eindrücklich die Gesamterscheinung des kubischen Komplexes zwischen den riesigen Bäumen im Klingenpark, harmonisch die Komposition der unterschiedlich hohen Flachdachtrakte mit den gleichmässigen Reihen grossformatiger Fenster.
Am Museumstrakt an der Ausstellungsstrasse fallen zunächst Bandfenster und verglaste Flächen auf, die aussenbündig in die Putzfassaden eingefügt sind. Unter dem weit vorkragenden Baukörper des Vortragssaals – auf drei unregelmässig angeordneten Rundpfeilern ruhend – erstreckt sich eine grosszügige Vorhalle, von der man, mit Blick in den abgesenkten Architekturgarten, durch die völlig verglaste Eingangsfront in das von aussen gut sichtbare Foyer mit Cafeteria und Museumskasse gelangt.
Im weitläufigen Foyer führen zur rechten Seite hohe Glastüren in den Ausstellungssaal, geradeaus eine breite gegenläufige Treppe ins Obergeschoss mit dem Vortragssaal. Daneben gelangt man über eine weitere Treppe ins Untergeschoss, wo nun zusätzliche Ausstellungsräume eingerichtet worden sind, von denen einer wegen der dortigen charakteristischen Pilzstützen nun «Maillart-Halle» heisst – Robert Maillart war seinerzeit zuständig für die Tragkonstruktion des Museumstrakts.
Wie selbstverständlich bewegen sich die Besucher jetzt auf verschiedenen Etagen durch die Ausstellung. Mit der Gesamtinstandsetzung sollte der wertvolle Bauzeuge so weit als möglich in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden, wobei den heutigen Anforderungen bezüglich Brandschutz und Erdbebensicherheit sowie allgemein der Nachhaltigkeit Rechnung getragen werden musste. Im 1994 unter den Beteiligten vereinbarten Schutzvertrag sind teils materiell, teils konzeptionell geschützte Elemente festgehalten. Im Einzelnen suchten Ruggero Tropeano und die Kantonale Denkmalpflege, die das Instandsetzungs- und Umbauprojekt begleitete, gemeinsam nach verträglichen Lösungen (vgl. «Von Verlusten und Entdeckungen»).
Ausgebessert und ergänzt
Um die Ausstellungsräume auf den geforderten Stand zu bringen, wurden eine Lüftungs- und eine Klimaanlage installiert. Der Zugang zu den neuen Ausstellungsflächen im Untergeschoss wurde mit einer Glastürwand im Foyer und einer indirekten Beleuchtung im Treppenhaus, die sich in die Architektur einfügt, aufgewertet. Diese und viele weitere Veränderungen bemerkt man erst beim genauen Hinsehen. Ruggero Tropeano, der seit rund 25 Jahren die baulichen Massnahmen im Museumsgebäude vornimmt, spricht denn auch von einer Vorgehensweise, die dem «Kunststopfen» gleicht: ein stellenweises Ausbessern und unauffälliges Ergänzen – wie beim Flicken eines Pullovers.
Beispielhaft für diese Haltung ist die Erneuerung der Beleuchtung: An der Decke der Ausstellungshalle wurden richtbare Spots auf Schienen appliziert. Im Foyer kamen zum einen Neonröhren hinzu, die linear zum Treppenhaus hin verlaufen, und zum anderen bewegliche Bolich-Leuchten, ähnlich wie sie einstim Aktzeichensaal hingen. Für Treppenhaus und Vestibül hatte Tropeano schon in den 1990er-Jahren zusammen mit der Firma Neue Werkstatt zylinderförmige Pendelleuchten entwickelt. Stellenweise kamen die alten gerundeten Opalglasleuchten zur Wiederverwendung, so in der möglichst originalen Raumachse mit den Treppen zur Galerie der Ausstellungshalle. Auch die charakteristischen orange-beige-braunen Platten aus Lausener Klinker am Boden wurden geflickt und ergänzt. In den Seitenschiffen der Ausstellungshalle liegt da, wo Erneuerung nötig war, in Anlehnung an das ursprüngliche Linoleum ein schwarzer Gummigranulatbelag.
Die Holzrahmen der Fenster wurden instandgesetzt, zusätzliche Isoliergläser innen angebracht und fast alle Fensterbänke ersetzt. Alte Glasscheiben mit kleinen Rissen beliess man jedoch. Durch den Rückbau zwischenzeitlicher Modifikationen an den Metalltüren und -fenstern im zwischenzeitlichen Eingangsbereich ist die Transparenz wiederhergestellt.
Bewahrt und rekonstruiert
Der Umgang mit dem Denkmal umfasst Schritte vom Restaurieren über das teilweise Wiederherstellen bis zum Ergänzen. Die zum Ausstellungssaal hin neu eingefügte zweite Glaswand sowie die ebenfalls neue raumhohe Verglasung entlang der Galerie entsprechen den Forderungen zum Raumklima. Der Thekenkorpus für die Cafeteria ist wie die dazugehörige Küche völlig neu. Eine Besonderheit sind Bauteile, die keine Verwendung mehr finden, auf Wunsch der Denkmalpflege aber gleichwohl wieder zum Einbau kamen, wie Bauberater Lukas Knörr im Gespräch ausführt: Diese Relikte besitzen zwar keine unmittelbare Funktion mehr, aber eine denkmalpflegerische – quasi als archäologische Dokumente. Beispielsweise wurden auf der Galerie originale Teilstücke des Linoleumbodens, der getüpfelten Tapete und des Drahtglas-Geländers angebracht.
Sichtbares Zeichen der Neueröffnung ist die Gebäudebeschriftung an der Fassade: In grossen Lettern steht «Museum für Gestaltung» anstatt dem früheren «Kunstgewerbemuseum». Hierfür wurde die originale Typografie des Grafikers Ernst Keller eingesetzt, von dem auch die übrige Signaletik im Gebäude stammt; einzelne bisher nirgends verwendete Buchstaben mussten allerdings nachempfunden werden. Neu ist die abendliche Hinterleuchtung der Beschriftung.
Das wesentliche Resultat der Instandsetzung ist zweifellos die Demontage der eingangs erwähnten Zwischendecke im Ausstellungssaal und der Büroeinbauten auf der Galerie. Damit präsentiert sich das moderne Denkmal wieder mit dem basilikalen Querschnitt, dem es seine einzigartige räumliche Qualität verdankt. Das Museum für Gestaltung Zürich ist seiner ursprünglichen Architektur gemäss wieder hergestellt und für den weiteren Gebrauch aufgerüstet. Den Architekten gelang es aufgrund ihrer jahrelangen Beschäftigung mit dem Museum, adäquate Lösungen für die Integration aktueller technischer Anforderungen zu finden. Ihr respektvoller und einfühlsamer Umgang mit diesem komplexen Denkmal überzeugt.
Anmerkungen:
[01] Vgl. Gewerbeschule und Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich. Festschrift zur Eröffnung des Neubaus im Frühjahr 1933.
[02] Neue Zürcher Zeitung, 7. August 1927.
[03] Vgl. Heimatschutz 1930, Nr. 1, S. 16.
[04] Vgl. Reprofilierung der Architektur des Gebäudes der Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich von 1932 – Ein Auftrag, hg. von der Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich, Schule für Gestaltung, Zürich 1981. Darin wurde u. a. bereits die Wiederherstellung der Ausstellungshalle gefordert.
Einen Film zum Rückbau der Hallendecke und zusätzliches historisches Material finden Sie auf espazium.ch/mfg-zh
TEC21, Fr., 2018.08.31
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2018|35 Museum für Gestaltung Zürich