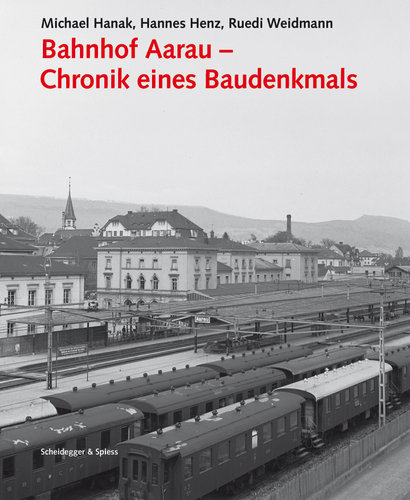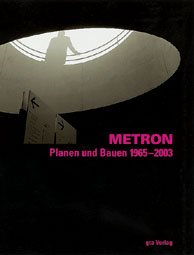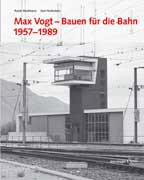Wo Gärten landen
«Landing» heisst das Motto von Lausanne Jardins 2014. Die urbane Gartenschau testet mobile Gärten, die im Asphaltdschungel landen, ihren Segen verbreiten und weiterziehen können. Das funktioniert zwar fast nirgends, doch gerade das macht den Besuch interessant.
«Landing» heisst das Motto von Lausanne Jardins 2014. Die urbane Gartenschau testet mobile Gärten, die im Asphaltdschungel landen, ihren Segen verbreiten und weiterziehen können. Das funktioniert zwar fast nirgends, doch gerade das macht den Besuch interessant.
Halt dich am Gras fest, der Boden rutscht!» Mit diesem Satz pflegte mich mein Grossvater wieder aufzurichten, wenn ich auf unseren Spaziergängen den Halt unter den Füssen verlor. Der Satz beschäftigt mich noch heute wegen der Abgründe, die sich hinter seiner jovialen Harmlosigkeit auftun. Als Lausanne Jardins 2014 mobile Gärten als Thema ankündigte, war mir deshalb sofort klar: Hier hatte jemand Lust, sich auf ein Paradox einzulassen. Denn zumindest in der abendländischen und orientalischen Kulturgeschichte ist der Garten der Ort der Ruhe par excellence, Metapher für Heimfinden, Wurzelnschlagen und Bleiben. Versprechen da Gärten in Bewegung nicht eine tiefsinnige Auseinandersetzung mit unserer hypermobilen Lebensweise – und ausserdem raffinierte Installationen?
Rundgang zu mobilen Gärten
Doch zunächst die Fakten: Bis zum 11. Oktober erwartet die fünfte Auflage von Lausanne Jardins Gartenfreundinnen und Stadtwanderer. Anders als gewöhnliche Gartenschauen findet diese in der gebauten Stadt, in Parks und Gärten, Strassen und Gassen, auf Plätzen, Treppen und Hausdächern statt. Zeitgemässe Formen für Stadtgärten zu finden ist ihr hehrer Zweck, Lausanne mit seinem reichen Erbe an Gärten und Parks bekannter zu machen der erhoffte und legitime Nebeneffekt. Die Stadt Lausanne und der Verein «Jardin urbain» schreiben dazu seit 1997 alle paar Jahre einen internationalen Wettbewerb aus, an dem sich Landschafts- und Gartenarchitekturbüros, Architektur- und Kunstschaffende beteiligen.
Ein Kuratorium ist für Konzept, Motto und Standortwahl verantwortlich, organisiert den Wettbewerb und überwacht die Ausführung der Projekte. Dieses Jahr teilen sich der Lausanner Designer Adrien Rovero und der französische Szenograf und Landschaftsplaner Christophe Ponceau die Verantwortung. Die von einer Jury ausgewählten Beiträge laden dann einen Sommer lang zum kontemplativen Besuch und zur Reflexion über das Verhältnis von Fauna und Urbanität ein. Für 2014 verzeichnete der Wettbewerb 133 Eingaben, 25 aus der Schweiz. Die Jury wählte 26 Projekte. Das städtische Gartenbauamt, das für das Ziehen der Pflanzen, den Aufbau und den Unterhalt von Lausanne Jardins verantwortlich ist, steuerte wie immer einige eigene Projekte bei, die in einem Wettbewerb unter seinen Mitarbeitenden ermittelt wurden.
Das realisierte Programm umfasst 29 Beiträge. Alle sind in der Innenstadt zu sehen und lassen sich an einem Tag besuchen; zwei davon sind allerdings so mobil, dass man sie nur mit Glück antrifft. Vor Ort erläutern Tafeln mit etwas knappen Informationen die Objekte. Eine recht brauchbare Karte schlägt einen Parcours vor. Sie ist unabdingbar, denn die ziemlich krude Signaletik weist den Weg nur ungenügend. Auf der Website finden sich nebst Karte und Rahmenprogramm auch Hinweise auf themenverwandte Anlässe in der Region.
Kreative Logistik im harten Millieu
Auslober und Jury wollten wissen, wie (in welcher Form, in welchen Gefässen, mit welchen Unterhaltsmassnahmen) die Pflanzenwelt anders als auf traditionelle Weise einen Platz an asphaltierten und betonierten Orten finden kann. Die Teams mussten transportierbare Gärten vorschlagen und dafür eine Logistik kreieren. Gesucht waren kreative Formen, aber bereits auch die Annäherung an Prototypen, die andere Gemeinden übernehmen könnten. Gefragt waren Teams mit verschiedenen disziplinären Ansätzen, die jedoch die Bedürfnisse der verwendeten Pflanzen respektieren und alle Phasen der Planung und des Wachstums des Gartens dem Publikum erklären mussten. Die Besucher sollten neue Wege und versteckte Winkel entdecken und einen frischen Blick auf die bauliche Vielfalt im historischen Stadtzentrum werfen.
Von Blümchen und Bierdosen
Letzteres erreicht der Rundgang zweifellos. Nur sagt das noch nichts aus über die Qualität der einzelnen Projekte. Was wäre ein geeigneter Massstab für deren Beurteilung? Vielleicht die bekannteste Form des mobilen Gartens, seine Urzelle sozusagen: der Blumentopf, der im Frühling auf dem Fensterbrett und im Herbst wieder im Keller landet? Tatsächlich trägt ein gutes halbes Dutzend der Projekte kaum zur Erweiterung dieses bewährten Prinzips bei. Eine grosse Geste wie den Eisenbahnzug, der für Lausanne Jardins 2000 mit 14 unterschiedlich bepflanzten Güterwagen durch die Schweiz fuhr, sucht man 2014 vergeblich. Es waren eher kleine Interventionen mit poetischer Wirkung gefragt.
In der Buntheit des Lausanner Stadtzentrums gehen allzu zarte Pflänzchen allerdings unter. Etliche Projekte überzeugen nicht, weil eine an sich schöne Idee zu kleinlich oder zu wenig konsequent umgesetzt wurde. Laut dem für das Fundraising zuständigen Cedric van der Poel ist dies teilweise dem Budget geschuldet, aber auch den Rahmenbedingungen im Stadtzentrum. Die Hochbeete mit Blumen zum Selberschneiden auf der Place de la Riponne (Abb. S. 25 unten) könnten durchaus dazu animieren, die Versorgung der Stadt mit Schnittblumen zu überdenken und den riesigen Marktplatz in neuem Licht zu sehen. Doch dazu müssten sie viel grösser sein. Jetzt wirken sie eher lächerlich. Wegen Bürgerprotesten gegen die temporäre Sperrung einer Parkhauszufahrt hat man das Projekt verkleinert.
Einige Blumen haben schlicht keine Chance, in der städtischen Realität zu bestehen, etwa die bemitleidenswerten Kosmeen, die auf der Place Chauderon auf Nutzer stossen, denen der Sinn mehr nach der nächsten Bierdose steht als nach poetischen Farbtupfern. Chancenlos auch die Eternittopf-Skulpturen in der Rue de la Tour (Abb. S. 5 oben). Ein paar Dutzend von ihnen könnten diese Hintergasse verzaubern, doch zu dritt kommen sie gegen deren Trostlosigkeit nicht an. Fairerweise sei eingestanden, dass einige Gärten ihre volle Wirkung erst im Lauf des Sommers entfalten werden.
Mehr Kraft entwickeln Interventionen, die die Nutzung und damit die soziale Dimension des Gartens thematisieren. Manon Briod, Julien Mercier, Pablo Gabbay und Pierre Ménetrey haben zwischen zwei Häusern im Flon Blumentöpfe an bewegliche Wäscheleinen gehängt, den mobilen Blumentopf also quasi hypermobilisiert. Die Bewohner können sich so Kräuter, Blumen und das Giessen teilen – ein starkes Bild, kommunikationsfördernd und lustig anzusehen (Abb. oben).
Gärten der Ungeduld
Einige Beiträge legen den Fokus auf ein genuines Thema der Gartengestaltung: den ewigen Zirkel von Werden und Vergehen. Das kollidiert aber mit der Vorgabe «13 Juni bis 11. Oktober». Die aus lebenden Weidenzweigen geflochtenen, mit Erde gefüllten und daher wachsenden Körbe in der Rue de la Mercerie (Abb. S. 26, unten rechts) haben immerhin bis im Oktober Zeit zu zeigen, was in ihnen steckt. Wie aber soll das Publikum erfahren, ob die Tannzapfen, die es im Parc de Montbenon in ein Wiesencarré werfen darf (Abb. S. 25, 2. von oben), je versamen werden? An der Promenade Schnetzler dringen aus einem Gefäss in der Mitte des Rasens Regenwürmer in den Boden vor und lockern ihn auf. In der Folge verändert sich die Zusammensetzung der Pflanzenarten. Weil das aber Jahre dauert, haben die Stadtgärtner die neuen Arten gleich schon gesetzt. Dadurch bleibt der Prozess beim Projekt «Unsichtbare Gärtner» (gemeint sind die Regenwürmer) leider ebenso unsichtbar wie die Regenwürmer selbst. Projekten, die auf das Beobachten langer Zyklen setzen, fehlt in diesem Rahmen schlicht die Zeit, um überzeugend zu wirken.
So schwankt Lausanne Jardins 2014 merkwürdig unentschieden zwischen temporären Installationen – die besten funktionieren als Ideengeber, sind aber eben Installationen, keine Gärten – und «Landungen» von Gärten, die missglücken, weil der Sommer zu kurz ist, um zu sehen, ob die Pflanzen versamen und Wurzeln schlagen, und damit unbeantwortet bleibt, ob die Idee funktioniert.
Schöne Gesten, kluge Eingriffe
Mehrere Projekte zielen auf rein ästhetische Wirkung, sind eher Kunstwerke als Gärten. Je nach Geschmack wird man sie schön oder kitschig finden. Dazu gehören Sukkulenten in Gläsern (Abb. S. 26 unten links) in einer Wiese im Parc de l’Hermitage, ein Alpinum auf Stelzen auf der Place du Tunnel und eine miniaturisierte Genferseelandschaft aus Marmor und Flechten, die Evelyne Darcy und Olivier Sévère in der Kathedrale aufgebaut haben (Abb. S. 26 unten Mitte).
Einige Projekte aber sind schöne Gesten und gleichzeitig kluge Beiträge. Sie allein schon lohnen den Besuch. Wie die Autoren von «Botanic Box» die Aufgabe mobiler Garten umsetzen, ist fast banal, funktioniert aber besser als manch konzeptlastigerer Zugang: Ein kurzer Frachtcontainer ist aussen rot bemalt, oben offen, darin wuchern subtropische Pflanzen (Abb. S. 22). Ein schmaler Pfad führt hinein, verspiegelte Wände vergrössern das in der gemässigten Zone gelandete Stück Dschungel. Der rote Container mit den grünen Palmen ist gewiss nicht sehr innovativ, aber ein starkes Zeichen – und im Unterschied zu den meisten anderen Projekten tatsächlich transportabel. Er liesse sich überall als Café, Pausenecke oder Gärtchen einsetzen.
Der Beitrag «Outbreak» (Abb. S. 26 oben) von FHV architectes und Adrien Zwingli bezieht wie kein anderer Architektur und Lage mit ein: Aus allen Öffnungen eines zierlichen klassizistischen Säulenportikus an der Rue Neuve quillt Rasen. Der fast gewalttätige Ausbruch von Fruchtbarkeit rückt den Brunnen davor, den die Gewohnheit längst zur Unsichtbarkeit verdammt hat, jäh ins Bewusstsein zurück. Die Brunnenfigur bietet Fische aus ihrem Korb an, doch die eiligen Passanten tragen volle Einkaufstaschen und haben keine Hand frei für die Gaben der Natur.
Überzeugend ist ein stiller, unprätentiöser Beitrag von Thilo Folkerts, Marie Alléaumet und Nathanaelle Baës-Cantillon. Ihre sanfte Intervention stärkt ein Kleinod, das auch viele Einheimische übersehen. Im Schatten einiger Bäume neben dem viel befahrenen Pont Chauderon liegt der sandige Spielplatz des Pétanque-Klubs Boule d’Or Lausannois. In Blumentöpfen kommen Spargel, Pfefferminze, Salbei, Anis und Wermut auf das Terrain, zarte Pflanzen, die charakteristische angenehme Gerüche verbreiten. Die Autoren haben Stahlrohre in den Grüntönen dieser fünf Pflanzenarten gestrichen und daraus einige schlichte Geländer und Zuschauerbänke gebaut. Das tönt simpel, wirkt aber sympathisch, macht den Ort bewusst, ohne ihn zu stören – und darf bleiben (Abb. S. 25, 3. von oben).
Brauchen wir mobile Gärten?
Der Parcours ist abwechslungsreich. Doch in seinem Verlauf drängt sich immer mehr die Frage auf: Sind mobile Gärten wirklich das, was Städte heute brauchen – vor allem, wenn unter Stadt nicht die Altstadt, sondern die suburbane Region als realer Lebensraum der Mehrheit verstanden wird? Mangelt es dort nicht gerade am Gegenteil, an Verwurzelung, stabiler Identität, an festen Orten – Ort verstanden als Gegenstück zum Weg, der mit räumlichen Qualitäten und Sinneseindrücken zum Bleiben verführt? Bleiben können, Zeit vergehen lassen, ist Voraussetzung dafür, dass Pflanzen gedeihen und soziale Beziehungen entstehen können. Die Strasse, als Transitraum, hält Begegnungen bereit, der Ort, als Lebensraum, lässt Bindungen wachsen. Menschen brauchen beides. Doch ist es nicht gerade die Stärke des Gartens, Ort sein zu können?
Eine kluge Antwort hält «Place de parcs» bereit. Das Projekt von Yves Fidalgo, Cédric Decroux, Catherine Cotting und Yann Mingard gibt sich zunächst sehr mobil: Auf vier Parkplätzen in der Avenue Vinet parken hintereinander vier Plattformen, darauf vier verschiedene Gärten. Der zweite Blick zeigt, dass es Ausschnitte aus Parks in Zürich, Basel, Bern und Genf sind. Auf Plakatwänden an der Stützmauer dahinter zeigen Fotografien die Ursprungsorte (vgl. Titelbild). Nicht mobile Gärten sind also hier gelandet, sondern Schollen aus dauerhaften Gärten wurden herausoperiert und in einem Transitraum platziert – als Gruss von festen Orten.
Immerhin könnten transportierbare und einfach zu installierende Gartenformen ja nützlich sein zur raschen Verbesserung der Lebensqualität in Gebieten mit Bedarf.
Die Beiträge sollten Prototypen sein, die irgendwo eingesetzt werden können, und tatsächlich würden einige anderswo sogar besser funktionieren. Denn das topografisch lebendige, gepflegte Lausanner Stadtzentrum ist dermassen reich an Architektur, aussergewöhnlichen stadträumlichen Situationen und eben auch an Gärten, dass manche «Landung» hier schlicht überflüssig wirkt.
Warum die Wahl auf den Stadtkern fiel, wird nirgends begründet. Man habe wieder zu den Ursprüngen von Lausanne Jardins zurückkehren wollen, geben die Kuratoren im Programmheft lediglich an. Warum, sagen sie nicht, und es erschliesst sich auch auf dem Rundgang nicht. Auf das Definieren eines spezifischen Effekts oder gar Nutzens der Ausgabe 2014 scheint generell nicht allzu viel Energie verwendet worden zu sein. Diesen Eindruck verstärken die Kuratoren noch, wenn sie erzählen, sie hätten die Standorte mittels Ausstreuen von Samen auf einem Stadtplan bestimmt – als poetische Geste. Natürlich, Poesie verweigert sich dem Nützlichkeitsdenken, aber Ziellosigkeit ist deswegen nicht automatisch auch poetisch. Etlichen Projekten fehlt es schlicht an Relevanz. Nach den früheren Auflagen, besonders denjenigen von 2004 den Bahngleisen entlang bis nach Renens und 2009 entlang der U-Bahnstrecke M2, wirkt diese Ortswahl deshalb als wenig inspirierender Rückschritt.
Bruchlandung vermeiden
Die Kuratoren schreiben im Konzept, es gehe um die Erfindung von neuen Arten der pflanzlichen Installation. Doch stünden heute nicht andere Fragen im Vordergrund? Neue Organisationsformen für das gemeinschaftliche Bewirtschaften öffentlicher Parks, wie es etwa die Stadt Paris fördert? Das integrative Potenzial von Gemeinschaftsgärten, die weltweit boomen (und laufend neue Arten von pflanzlichen Installationen hervorbringen und gleich auch einem realistischen Praxistest unterwerfen)? Die Frage, wie Erholung und Artenvielfalt in Grünräumen vereinbar sind (TEC21 19/2013, S. 16–20)? Möglichkeiten zur Relokalisierung der Lebensmittelproduktion und neue Formen urbaner Landwirtschaft (denen sich gerade die Architekturbiennale Rotterdam widmet)? Oder die Frage, wie sich im öffentlichen Raum von sub- und periurbanen Zonen lokale Identität und Interaktionen fördern lassen?
Lausanne Jardins ist eine wunderbare Erfindung. Der Ansatz, den ideologisch konstruierten Gegensatz zwischen Grau und Grün zu überwinden und neue Symbiosen von Stadt und Garten zu suchen, war 1997 pionierhaft und ist heute aktueller denn je. Die Stadt Lausanne sollte die Tradition unbedingt fortführen und künftig besser vermarkten, besonders auch im deutschen Sprachraum. Doch muss ihr neues Leben eingehaucht werden. Sonst wird sie von der spriessenden Buntheit der Urban-Gardening-Bewegung in den Schatten gestellt. Lausanne Jardins braucht die brennenden Fragen der Zeit und ein Einsatzgebiet, wo die Schau Wirkung entfalten kann, dann brauchen auch wir Lausanne Jardins. Im grandiosen suburbanen Chaos im Westen von Lausanne warten Tausende sinnlose Restflächen auf Ideen, was mit ihnen anzufangen wäre. Dort läge ein überaus dankbares Feld für die nächste Ausgabe.
Trotzdem lohnt sich der Besuch von Lausanne Jardins 2014, und dieses Jahr besonders, wenn man ihn mit einem Abstecher zur Ausstellung «Genève, villes et champs» verbindet (vgl. S. 27).
TEC21, Fr., 2014.08.08
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2014|32-33 Städte, Gärten und Felder