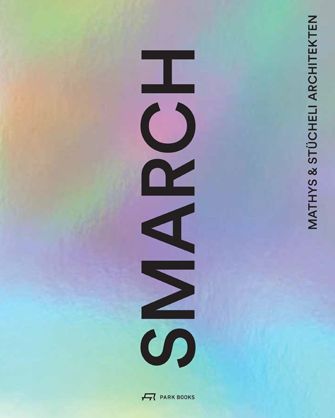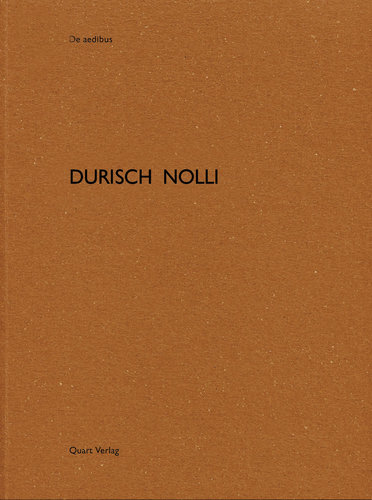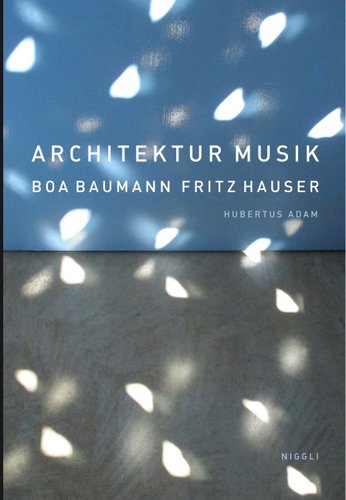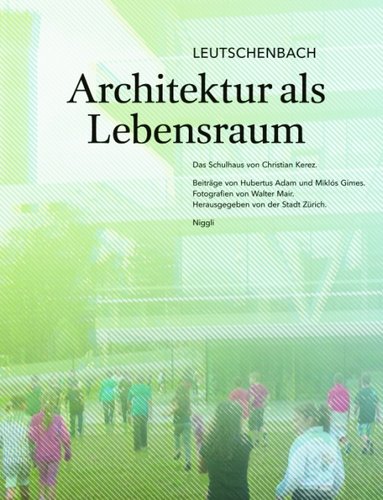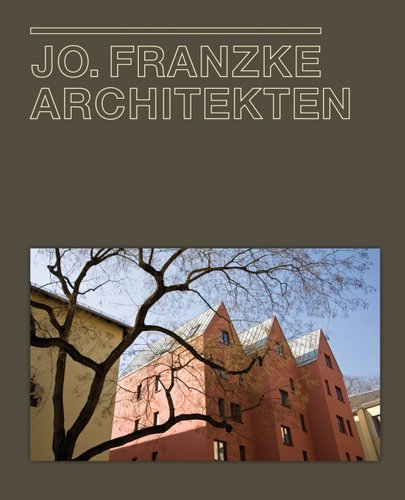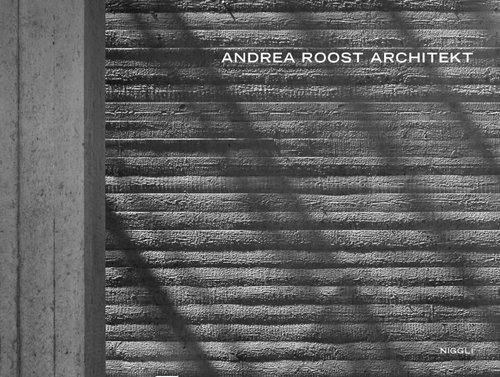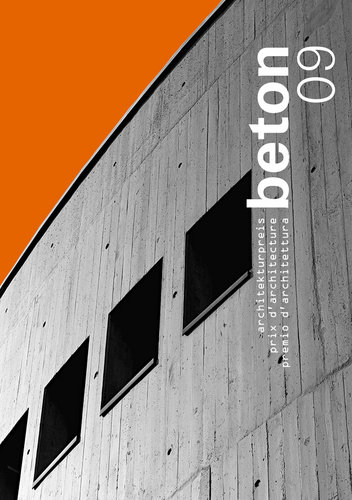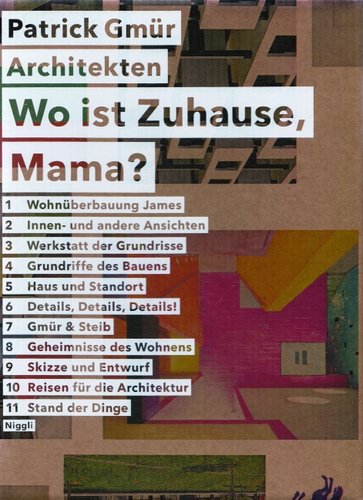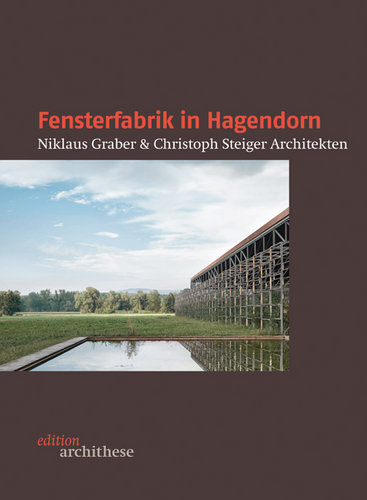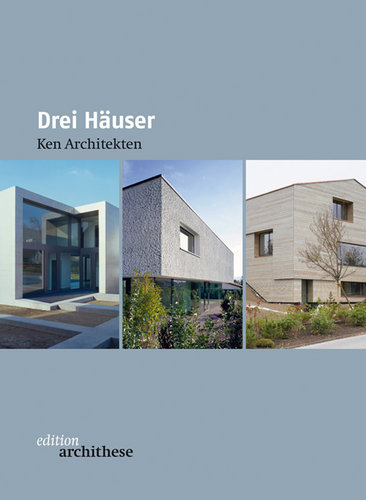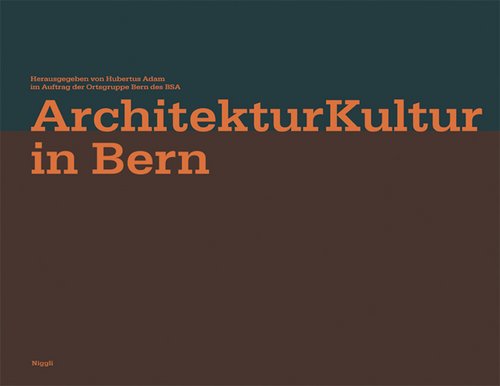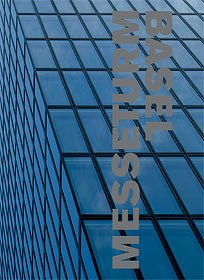Die zeitgenössische Architektur in Japan ist um einiges vielgestaltiger als es die Hochglanzbilder scheinbar entmaterialisierter Bauten suggerieren. Auch wenn kommerzielle Großprojekte das Baugeschehen prägen: Gerade kulturell und sozial ambitionierte Projekte in vielfach kleinerem und kleinstem Maßstab sind beachtenswert und überaus lohnend, betrachtet zu werden – ob in der Theorie, oder ganz konkret vor Ort bei einer Reise durchs Land.
Die zeitgenössische Architektur in Japan ist um einiges vielgestaltiger als es die Hochglanzbilder scheinbar entmaterialisierter Bauten suggerieren. Auch wenn kommerzielle Großprojekte das Baugeschehen prägen: Gerade kulturell und sozial ambitionierte Projekte in vielfach kleinerem und kleinstem Maßstab sind beachtenswert und überaus lohnend, betrachtet zu werden – ob in der Theorie, oder ganz konkret vor Ort bei einer Reise durchs Land.
Das »House NA« von Sou Fujimoto (2012) und das »Garden and House« von Ryue Nishizawa (2013) zählen zu den weltweit gefeierten Ikonen des zeitgenössischen Bauschaffens in Japan. Sie prägen das Bild, das man auch hierzulande von der japanischen Architektur hat: leicht, transparent, offen, entmaterialisiert, fast ätherisch. Ein Besuch lässt die Gebäude viel selbstverständlicher und alltäglicher aussehen als sie auf den bekannten Fotos erscheinen. House NA wirkt nicht wie ein gläserner Setzkasten, der seine Bewohner gleichsam auf einer dreidimensionalen Bühne exponiert. Viele der Scheiben sind mit Vorhängen versehen. Und »Garden & House«, bei dem man von Raum zu Raum, von Stockwerk zu Stockwerk durchs Freie geht, funktioniert nur, weil eine Batterie von Klimaboxen auf der üblicherweise nicht abgebildeten Rückseite angesichts des im Sommer extrem heißen und im Winter sehr kalten Klimas für Bewohnbarkeit sorgt. Dies Wissen tut der Wirkung vor Ort keinen Abbruch, im Gegenteil. Letztlich sind beide Bauten viel stärker vom Kontext geprägt als es die Fotos vermitteln: von den dichten, kleinteilig strukturierten Wohnvierteln Tokios. Die Gebäude von Fujimoto und Nishizawa fügen sich im Grunde gut in ihre Umgebung aus Fertighäusern und Allerweltsarchitektur ein; es gehe ihm darum, etwas zu bauen, das so wie Tokio sei, erklärt Sou Fujimoto dann auch folgerichtig im Gespräch.
Fujimoto ist durch Tokioter Kleinsthäuser, von denen House NA wohl das prominenteste ist, bekannt geworden. Er hat 2013 den Serpentine Pavilion in London errichtet und war auch anderenorts an Projekten im Grenzbereich zwischen Kunst und Architektur beteiligt. 2021 soll sein neues Kultur- und Bürgerzentrum in der stark vom Tsunami 2011 betroffenen Stadt Ishinomaki im Nordosten der japanischen Hauptinsel Honshu eröffnet werden. Daneben sind eine ganze Reihe weiterer großer Projekte in Planung: ein Konzerthaus für Budapest, ein Wohnhochhaus in Marseille, ein »Vertical Village« bei Paris, ein Learning Center auf dem Plateau de Saclay und ein weiteres für die Universität Sankt Gallen. Die meisten seiner Aufträge hat Fujimoto inzwischen in Europa. Das gilt auch für andere japanische Architekten, die zudem in China bauen, in Korea und in den USA. Oder zumindest, wie etwa Go Hasegawa, Gastprofessuren in Übersee annehmen und internationale Netzwerke knüpfen. Denn in Japan an Aufträge zu gelangen, ist schwierig. Hier und da ein Minihaus für private Auftraggeber, vielleicht einmal ein kulturelles Projekt, mehr steht selten zu erwarten. Die meisten Großprojekte werden von den marktbeherrschenden Architekturkonzernen wie Nikken Sekkei übernommen, Wettbewerbe gibt es nur selten. Im Glücksfall wünschen sich politisch Verantwortliche gute Architektur. Dies betrifft z. B. das Langzeitprojekt »Kumamoto Art Polis«, das 1988 von Arata Isozaki und dem damaligen Gouverneur der Präfektur angestoßen wurde und in diesem Mai mit einem Symposium zu seinem 30. Jahrestag geehrt wurde. Arrivierte, v. a. aber auch junge Architekten wurden über die Jahrzehnte mit öffentlichen Bauaufgaben in der ganzen Präfektur Kumamoto betraut: von Toilettenanlagen über Infrastrukturbauten bis hin zu Verwaltungsgebäuden und Museen. Doch Kumamoto Art Polis ist die Ausnahme. Verglichen mit anderen Ländern besitzt der Berufsstand des Architekten in Japan selbst ein eher geringes Renommee in der Bevölkerung.
Ambitionierte Kulturbauten
Wahrscheinlich sind auch Büros wie Shigeru Ban oder SANAA inzwischen im Ausland bekannter, doch können sie zumindest im eigenen Land auf ein Werk verweisen, das nicht nur Kleinstprojekte umfasst. Gerade Kulturbauten bieten immer noch ein Betätigungsfeld, in dem qualitätvolle Architektur gefragt ist. Jüngstes Projekt von SANAA: die City Culture Hall in der 500 km von Tokio entfernt an der Westküste von Honshu gelegenen Stadt Tsuruoka. Die Stadt ist durch Zusammenlegung verschiedener Gemeinden gewachsen und wirkt trotz ihrer knapp 130 000 Einwohner kleinstädtisch. So bestand die Herausforderung darin, das im Zentrum gelegene Kulturzentrum, dessen Kern ein Konzert- und Theatersaal bildet mit der städtischen Textur zu verzahnen. Die Architekten lösten die Aufgabe, indem sie den sechseckigen, nach dem Weinbergprinzip organisierten Saal samt rechteckigem Bühnenturm ringsum mit Foyer- und Korridorbereichen umgaben, an die sich die übrigen Nutzungsbereiche als eigenständige Volumina anlagern. Das erlaubt nicht nur eine hohe Nutzungsflexibilität, sondern auch eine räumliche und optische Differenzierung. Die verschiedenen Raumzonen greifen Zentrum aus in die Umgebung aus und öffnen sich zur Eingangsseite in einem langen gekurvten Glasfoyer. Dieses umarmt gewissermaßen das parkartige Areal des Chidokan, einer historischen Schule für Samuraikinder, die als Denkmal zu besichtigen ist. Die einzelnen Raumbereiche des Kulturzentrums sind mit jeweils eigenen Dächern überfangen, die sich von allen Seiten her zum Bühnenturm emporschwingen. Die konkave Form der Dachflächen ist eine Referenz an historische Architektur, SANAA selbst verweist auf ein traditionelles sayadou, ein Schutzdach über Schreinen.
Die Materialpalette beschränkt sich auf Beton, Stahl und Glas sowie in den Publikumsbereichen – wie dem Saal – auf Holz; je nach Witterung, aber auch je nach Perspektive verändert das Gebäude, das sich zu seiner Umgebung hin abtreppt, seine Erscheinung: Auf der Eingangsseite wirkt es offen und festlich, zur Rückseite hin, wo es an einen kleinen Flusslauf und eine heterogene Bebauungsstruktur stößt, verträgt es sich aufgrund seiner blechbekleideten Körper gut mit dem Bricolagecharakter der Nachbarschaft.
Schon ein Jahr zuvor eröffnete im Tokioter Stadtteil Sumida das Sumida Hokusai Museum, das Kazuyo Sejima mit ihrem eigenen Büro entwarf. Es ist dem in der Gegend des heutigen Sumida tätigen Künstler Katsushika Hokusai (1760-1849) gewidmet, der v. a. durch seine Farbholzschnitte bekannt wurde. Die Präsentation von Farbholzschnitten auf der Weltausstellung in Paris 1867 führte zu einer anhaltenden Faszination im Westen, welche sich im Japonismus des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts niederschlug. Aber auch ins japanische Bildgedächtnis haben sich die Werke Hokusais bis heute eingebrannt, besonders der Zyklus »36 Ansichten des Fuji« (1829-33) mit seinem berühmtesten Blatt »Die große Welle vor Kanagawa«.
Pläne für ein Museum, das vom Stadtbezirk Sumida getragen wird, bestanden schon seit 1989, wurden aber aus finanziellen Gründen zunächst zurückgestellt. Erst als die Entscheidung für die Errichtung des Tokio Skytree gefallen war, den 634 m hohen Fernsehturm mit Aussichtsterrasse, entschied sich die Bezirksverwaltung für eine zweite Touristenattraktion. Die Farbholzschnittkollektion eines japanischen Sammlers konnte erworben werden, inzwischen besitzt das Museum 1 800 Werke, die in Sonderausstellungen gezeigt werden. In der Dauerausstellung zu Leben und Werk Hokusais werden aufgrund der Lichtempfindlichkeit Kopien gezeigt. Da die Ausstellungsräume kein Tageslicht vertragen, ist das mit Stahlplatten bekleidete viergeschossige Museum nach außen weitgehend verschlossen. Aber Hokusais Schaffen war stark mit dem Ort verbunden und so wurden Kerben in das Volumen geschnitten, die im Bereich der Erschließungen und Ruheräume Ausblicke auf das heutige Sumida ermöglichen. Auf EG-Ebene führen Wege von allen Seiten in und durch das Gebäude, das sich hier in vier Teilräume gliedert, denn das Museum ist mit seinen vielfältigen Veranstaltungen auch ein Angebot an die Nachbarschaft, die nicht zuletzt vom vorgelagerten Park profitiert.
Die Bauten von SANAA oder Fujimoto werden außerhalb des Landes gerne als Inbegriff zeitgenössischer japanischer Architektur wahrgenommen. Dabei gerät aus dem Blick, dass parallel auch ganz andere Tendenzen existieren, das Spektrum also wesentlich vielfältiger ist. Eine wichtige Position nimmt der 1946 geborene Architekt Terunobu Fujimori ein, der erst seit dem Auftritt auf der Architekturbiennale Venedig 2006 und seiner Einzelausstellung in München 2012 in Europa wahrgenommen wurde. Fujimori untersuchte nach dem Studium mit einer Gruppe von Mitstreitern die alltäglichen Stadtlandschaften Japans, ein Vorhaben, das spätere Analysen von Atelier Bow-Wow beeinflusste. Daneben forschte er intensiv zur japanischen Architekturgeschichte; bedauerlich ist, dass seine fundamentalen Forschungen, gerade zur Entwicklung der Architektur im 20. Jahrhunderts, bislang nicht übersetzt worden sind. Erst seit 1991 tritt er als praktizierender Architekt in Erscheinung und überrascht mit bizarren Bauten, in denen Elemente der traditionellen Architektur aufgegriffen und in eine halb archaisch, halb organisch anmutende und mitunter märchenhafte Formenwelt übertragen werden. In Tajimi unweit von Nagoya eröffnete vor zwei Jahren das »Mosaic Tile Museum«, das die dortige Mosaikfliesenproduktion dokumentiert. Fujimori hat die lokale Initiativgruppe über Jahre begleitet und ein rätselhaftes Gebäude errichtet, welches das Bild eines Lehmhügels evoziert. In die Fassade sind Gruppen aus Mosaikfliesen eingelassen, Naturprodukt und Artefakt werden also kombiniert.
Bäume, die Dächer durchstoßen, bepflanzte Dachlandschaften, schindelbekleidete Türme: Ein ganzes Repertoire an typischer Fujimori-Architektur lässt sich in Omi-Hachiman nordöstlich von Kyoto besichtigen. 2015 eröffnete hier der Baumkuchenhersteller Club Harie ein Produktions- und Erlebniszentrum mit dem Namen »La Collina«, das in diesem Jahr durch ein zusätzliches Betriebsgebäude erweitert wurde. Club Harie arbeitet mit lokalen Anbietern zusammen und betreibt in Zusammenarbeit mit einer nahegelegenen Universität auch ökologischen Landbau.
Veränderung eines Landes
Die japanischen Großstädte sind Produkte einer radikalen Modernisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Nebeneinander von alt und neu, groß und klein ist faszinierend und führt jedem Besucher vor Augen, dass es auch andere lebenswerte Modelle von Urbanität gibt als jenes der »europäischen Stadt«. Aber Japan sieht sich mit Problemen konfrontiert. Da ist zum einen die Überalterung der Bevölkerung und zum anderen die Entvölkerung der ländlichen Regionen. Das führt zu verfallenen Dörfern, die einst die Kulturlandschaft Japans prägten. Aber selbst in Städten wie Kyoto mit seinem stadtbildprägenden Bestand an machiya, also den hölzernen Kaufmannshäusern, verändert sich das Stadtbild mit großer Geschwindigkeit. 2016 wurden in Kyoto 40 000 machiya gezählt, sieben Jahre zuvor waren es noch 5 600 mehr. Täglich werden im Durchschnitt 2,2 der historischen Häuser abgebrochen, auch wenn die Stadtverwaltung durch langfristige Meldefristen für Abrisse zu alternativen Lösungen ermutigen möchte. Aber der Denkmalschutz hat in Japan einen schwierigen Stand. Das lässt sich auch in Tokio sehen, wo in starkem Maße das Bauerbe des 20. Jahrhunderts betroffen ist. Jüngstes Beispiel ist die Kuwaitische Botschaft (1970) von Kenzo Tange, eines der absoluten Meisterwerke des Architekten, das kürzlich zum Abriss freigegeben wurde. Mal ist es die mögliche höhere Ausnutzung der astronomisch teuren Grundstücke, mal sind es die verschärften Standards für Erdbebensicherheit, die zur Eliminierung geschützter Bausubstanz führen.
Bemerkenswert ist dennoch, dass in den vergangenen Jahren doch mancherlei über das Land verteilter Projekte zu verzeichnen sind, die auf unterschiedliche Weise von Achtsamkeit zeugen. Von Achtsamkeit gegenüber der Geschichte, von Achtsamkeit gegenüber dem Ort, von Achtsamkeit gegenüber der Gesellschaft. Gewiss, es sind kleine Projekte, nicht staatlich gefördert, getragen von Menschen und Initiativen, die Verantwortung übernehmen und – wenn auch im Kleinen – zur Veränderung beitragen wollen.
Chiryu, südwestlich von Nagoya gelegen, war in der Edo-Zeit der Ort der 39. Post- und Raststation zwischen Edo (heute Tokio) und der damaligen Hauptstadt Kyoto – die 53 Stationen des Tokaido, also der die Zentren verbindenden Poststraße, waren ein beliebtes Sujet für Farbholzschnitte, z. B. von Hokusai. Dort, wo der Tokaido einst verlief, stehen auch heute noch eine Reihe von Schreinen und alten Häusern, auch wenn der Kontext durch rabiat in die urbane Textur einschneidende Verkehrsachsen und unproportionierte Neubauten stark beeinträchtigt ist. Mitten in diesem einstigen historischen Bereich der Stadt hat Mount Fuji Architects Studio aus Tokio die 2016 eröffnete »Chiryu Afterschool« errichtet, die, finanziert durch den ortsansässigen, im Bereich der Robotik aktiven Konzern Fuji Corporation Kinder mit spielerischen Experimenten an die Naturwissenschaften heranführen will. Da das auf Englisch stattfindet, fungiert das Gebäude gleichzeitig als Sprachschule – und überdies, mit einem kleinen Café, als Nachbarschaftstreff. Bei der Anordnung der Innenräume orientierten sich die Architekten an der räumlichen Disposition von Schreinanlagen: Zunächst betritt man den niedrigen Eingangsbereich neben dem Café (Haupttor), durchquert dann eine große Halle (Hof), die flexibel nutzbar ist, und erreicht schließlich die Unterrichtsräume mit einer Lernplattform im OG (Hauptgebäude). Vereint werden die Innenbereiche durch eine ingeniöse Dachstruktur, die aus Stäben von 1,50 m Länge und einem Querschnitt von 10,5 x 10,5 cm aus Brettschichtholz besteht. Die Stäbe sind versetzt angeordnet, perforiert und mithilfe von Stahlrohren zu einem Gewebe zusammengefügt, das durch zwei große Strahlrahmen gehalten wird und dazwischen rein auf Zug belastet in einer Kettenlinie die große Halle überspannt. Die verglaste Seitenfassade zeigt den Schnitt durch die Dachstruktur, die den Gesetzen der Schwerkraft folgt, und erinnert zugleich an die Dachformen der Kultbauten ringsherum. So entsteht ein intelligentes Spiel mit der Tradition, doch wichtiger noch ist die Tatsache, dass die Afterschool dazu beiträgt, das historische Stadtviertel wiederzubeleben und damit als urbaner Aktivator funktioniert.
Nach dem Desaster 2011
Das Tohoku-Erdbeben vom März 2011, der Tsuami und die Nuklearkatastrophe von Fukushima haben das Land gravierend verändert, physisch wie mental. Wer die Küstenregionen nördlich und südlich von Sendai besucht, sieht die Folgen: verwüstete Landstriche, Barackensiedlungen, Betondeiche, mit denen man zukünftige Überflutungen verhindern will. Gerade unter Architekten hat die Katastrophe eine Welle von Solidarität ausgelöst. So gründeten Toyo Ito, Riken Yamamoto, Hiroshi Naito, Kengo Kuma, Kazuyo Sejima die Initiative »Home for All«, der sich dann auch Akihisa Hirata und Sou Fujimoto anschlossen und die 2012 auf der Architekturbiennale in Venedig vorgestellt wurde. Da die Planung der Notunterkünfte vom Staat organisiert wurde, ein Eingreifen von Architekten weder gewünscht noch möglich war, konzentrierte man sich auf das, wofür staatlicherseits überhaupt nicht Sorge getragen wurde: Räume für die Gemeinschaft. So entstanden nach verschiedenen Entwürfen in den betroffenen Regionen kleine Gemeinschaftszentren zum Spielen, zum informellen Treffen, zum Beieinandersein.
In Kashima, 50 km nördlich vom Unglücksreaktor, haben Toyo Ito und Yun Yanagisawa 2016 einen Indoor-Spielplatz geschaffen. Das kleine Bauwerk mit seinem hölzernen Dach, das wie ein doppeltes Zirkuszelt wirkt, enthält im Innern eine große Sandkasten-Spielfläche, weil Kinder aufgrund der Strahlungsbelastung nicht im Freien spielen sollen.
Momonoura liegt etwa 60 km von Sendai entfernt in einer Bucht auf der Halbinsel Oshika. Das Fischerdorf wurde durch den Tsunami völlig ausgelöscht, die ohnehin bedrohte Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstört. Nur langsam kehrt Leben in die Region zurück. »Momonura Village« ist ein kleines Projekt, das gemeinsam von einer lokalen Initiativgruppe und Atelier Bow-Wow entwickelt wurde. Atelier Bow-Wow hat nach 2011 in den zerstörten Gebieten mehrere Projekte entwickelt: das Modell des »Core House« für Ishinomaki, eine Reihe von öffentlichen Wohnungsbauten im weiter nördlich gelegenen Kamaishi – und jetzt das »Momonoura Village«. Es besteht aus einem Haupthaus mit Speiseraum, Küche, zwei Schlafkammern im japanischen Stil für je fünf Personen und zwei »Tiny Houses« aus Holz für je vier Personen. Die Fläche davor kann als Zeltplatz genutzt werden. Momonura Village soll einen sanften Tourismus befördern und Gäste anlocken, die sich für die Geschichte und Problematik der Region interessieren. Verschiedene Programmbausteine können dazu gebucht werden: Vorträge über die Folgen des Erdbebens, Exkursionen mit den Fischern oder ein Besuch der Austernfarmen, die als neue Einkommensquelle dienen.
Die Gebäude sind schlicht gehalten und wurden in Freiwilligenarbeit unter Beteiligung lokaler Handwerker erstellt. Atelier Bow-Wow haben mit Shoji und Engawa Elemente japanischer Häuser aufgegriffen und kombinieren sie mit leichten modernen Materialien wie transparentem Wellplastik, das einige Räume erhellt.
Ein weiteres im sozialen Sektor angesiedeltes Projekt wurde unlängst von Atelier Bow-Wow in ländlicher Umgebung nahe dem Tokioter Flughafen Narita fertiggestellt. Schon 2012 eröffnete das von den Architekten entworfene Koisuru-Buta Laboratory. Von einer gemeinnützigen Einrichtung getragen, die auch Alterswohnungen in der Region unterhält, handelt es sich um einen Betrieb, der Schweinefleisch von Bauern der Umgebung verarbeitet. Behinderte und nichtbehinderte Menschen arbeiten hier zusammen. Die Fleischverarbeitung erfolgt im EG, darüber befinden sich, jeweils unter einem eigenen Satteldach, ein Restaurant mit Shop, die Verwaltung und eine große Halle, die auch als Marktplatz für regionale Produkte Verwendung findet. Nun ist als neuer Teil der Anlage »1K« hinzugekommen. Nahe dem Koisuru-Buta Laboratory steht ein zweigeschossiger turmartiger Pavillon. Unten kann man Süßkartoffel-Snacks kaufen, oben lädt ein kleiner Caféraum zum Blick über das Gelände ein. Der größere Baukomplex ist ein dreigliedriges, als Holzbau errichtetes Werkstattgebäude für die Holzverarbeitung. Hier wird Holz der Umgebung sortiert und zu Feuer- oder Bauholz weiterverarbeitet. Abermals überzeugt die Architektur von Atelier Bow-Wow durch Einfachheit und Schlichtheit, gepaart mit Reverenzen an die Tradition und der hohen Qualität der Materialverarbeitung. Vielleicht ist eine sozial verantwortungsbewusste Architektur wie diese die adäquate Antwort auf die Situation eines Landes, das nach März 2011 zum Umdenken gezwungen ist.
db, Di., 2018.06.05
verknüpfte Zeitschriftendb 2018|06 Japan