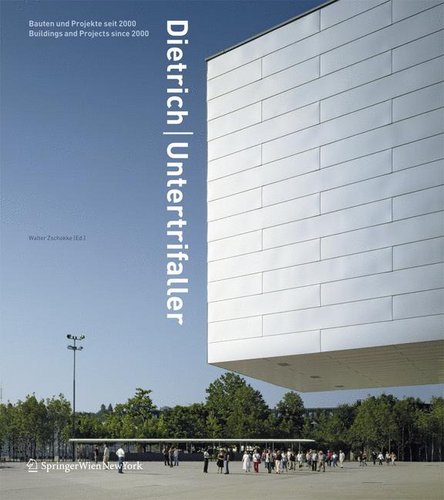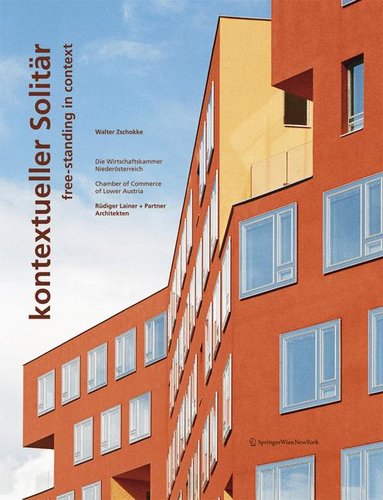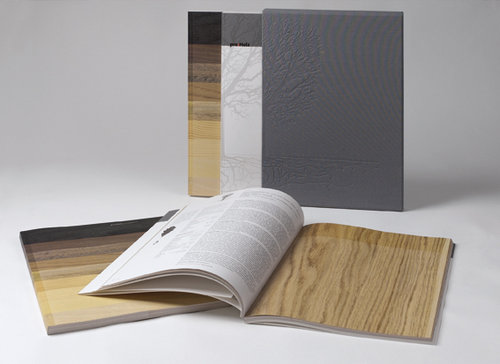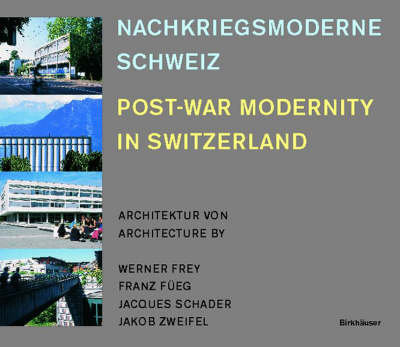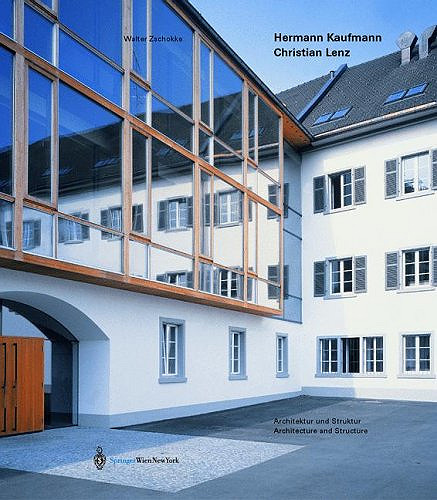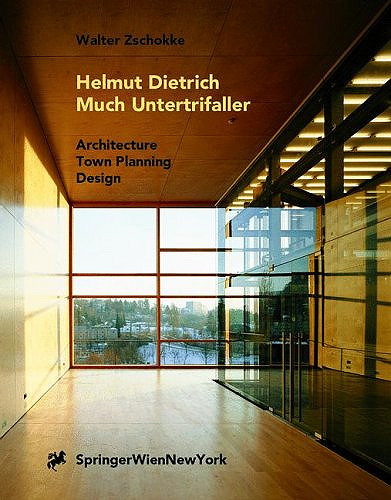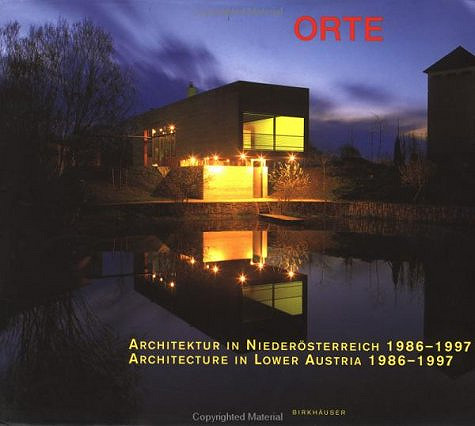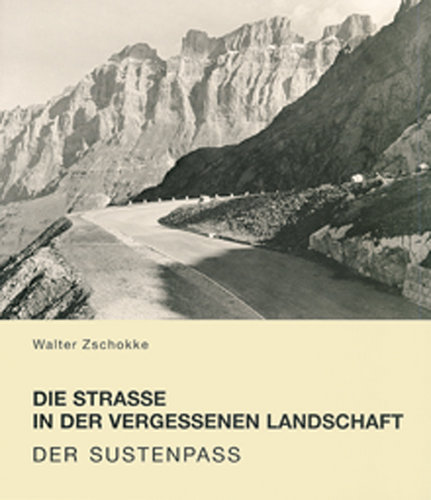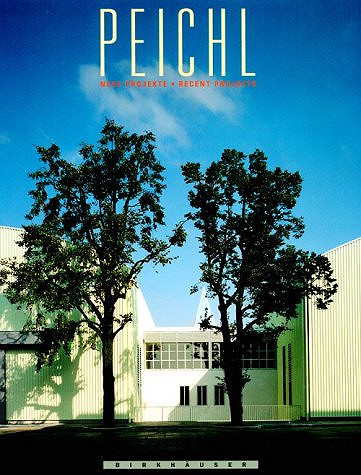Fast zwei Dutzend Jahre benötigte die Republik im heftigen Infight mit „Kronen Zeitung“ und Stadt Wien, um von der Idee eines zeitgenössischen Kulturbezirks zu dessen baulicher Realisierung zu gelangen. Noch stehen die meisten Neubauten stumm, aus Steinen ohne was herum und harren ihrer Bespielung. Zur Eröffnung des Museumsquartiers: ein kritischer Rundgang.
Fast zwei Dutzend Jahre benötigte die Republik im heftigen Infight mit „Kronen Zeitung“ und Stadt Wien, um von der Idee eines zeitgenössischen Kulturbezirks zu dessen baulicher Realisierung zu gelangen. Noch stehen die meisten Neubauten stumm, aus Steinen ohne was herum und harren ihrer Bespielung. Zur Eröffnung des Museumsquartiers: ein kritischer Rundgang.
Das meiste ist bekannt. Unendlich langes Gezerre im Vorfeld. Intrigenspiele, Schach- und Winkelzüge sowie Kompromisse gäben Stoff für mehrere Tragikomödien - doch wir sind in Wien, wo derlei Alltag ist. Die Architekten Ortner & Ortner, Gewinner des Wettbewerbs, planten jedenfalls mehr als einmal um. Doch seit 1995 stand das städtebauliche Konzept in großen Zügen fest - Präzisierungen im Detail wie immer vorbehalten -, und heute ziehen sich die Bautruppen unter Hinterlassung der üblichen Rückstände mehr oder weniger geordnet zurück.
Der Blick vom Burgtor offenbart einiges: Hinter dem pfirsichrosa leuchtenden Prospekt der ehemaligen Hofstallungen des Johann Bernhard Fischer von Erlach, wie sie halt nach Kriegszerstörungen im frühen 19. Jahrhundert und amtlicher Wiederherstellung nach Beschädigungen im Revolutionsjahr 1848 ins 20. Jahrhundert gedämmert sind, wächst rechter Hand eine dunkle Wölbung über den langen First, die sich vor der hohen Häuserzeile an der Breiten Gasse deutlich abhebt. Linker Hand schiebt sich, bloß schwach erkennbar, ein heller Baukörper unter die lagerhafte Attikabebauung über der Karl-Schweighofer-Gasse. Und seit über einem halben Jahrhundert darf der Flakturm in der Stiftskaserne die Blickachse dominieren.
Der schwache Kompromiß aus der Forderung der Neugläubigen, daß sich die Neubauten über den niederen Altbestand hinaus zeichenhaft manifestieren dürften und auch sollten, und der Reaktion der Altgläubigen, daß dies keinesfalls geschehen dürfe, hat ein eklatantes Ungleichgewicht hinterlassen. Kein Wunder in einem kulturpolitischen Klima, das von allen möglichen Seiten permanent und wider bessere Erkenntnis vergiftet wurde. Einem Klima, in dem sich Kontrahenten gegenseitig selbst die Eiterzähne neiden, wie man weiter westlich zu sagen pflegt. Allein die nüchterne Chronologie der Ereignisse mit den Schlagzeilen der Gehsteigpresse, zusammengestellt von Architekturzentrum und Museumsquartier, spricht Bände (siehe „hintergrund Nr. 11“, eine Publikation des Architekturzentrums Wien).
Nun, es hätte schlimmer kommen können. Einmal durch den Haupteingang spaziert, in den vorläufig Mittelhof genannten, zentralen Außenraum - es wird sich nächstens gewiß der Name eines verdienten (Kultur-)Politikers des Volkes finden, nach dem er dann benannt wird -, steht man also auf einem geräumigen Platz, erblickt zur Linken einen neuen weißen Baukörper, zur Rechten einen neuen dunkelgrau changierenden und in der Mitte einen brav neobarock erneuerten querstehenden Trakt mit einem dreibogigen Vorbau, dessen Attika weiterhin eine Uhr trägt, damit alle wissen, was es geschlagen hat und ob sie noch rechtzeitig zur angepeilten Veranstaltung kommen.
Von seiner Zeichenhaftigkeit sollte man sich aber nicht irritieren lassen. Hier geht es nicht hinein. Die seitlichen Treppen führen nur hinauf und wieder herunter. Aber die Eindeutigkeit der übrigen Disposition, große Baukörper, helle und dunkle Oberflächen, lassen solche Verwirrspielchen der alten Bausubstanz abblitzen, denn deutlich signalisieren die breiten, je beiden Neubauten angefügten Treppen, daß es hier weitergeht. Der Platzraum wird von den genannten vier Gebäudevolumen - dem ehemaligen Palais des Oberhofstallmeisters, der ehemaligen Winterreithalle, dem Leopold Museum und dem Museum Moderner Kunst - als Spannungsfeld von zwei sich kreuzenden Baukörperbeziehungen definiert, wobei die Relation der Neubauten etwas freier interpretiert ist als die axialsymmetrische Gegenüberstellung der zentralen Gebäude des Bestands. Er wirkt nicht so groß, wie er ist, da die beiden Neubauten ein Ablesen von Geschoßen zumindest erschweren. Aus Distanz erscheinen sie kleiner - also vermeintlich näher. Weder kann man daher übermäßige Monumentalität vorwerfen, noch daß sich ihre Proportionen außerhalb des vorhandenen städtebaulichen Maßstabs bewegten.
Das Vorstoßen der beiden neuen Baukörper in den weiten Freiraum hinter der bestehenden Randbebauung gliedert diesen in mehrere platzartige Zonen, die trotz des Kontinuums Eigenständigkeit erlangen. Sie versprechen abwechslungsreiches Flanieren und vielfache Bespielbarkeit. Dabei wird die Rückseite des Frontprospekts, die eben eine Rückseite ist, von zwei Reihen Ahornbäumen, die das Mittelpalais flankieren, abgeschirmt und neutralisiert. Begleitende Holzbänke geben dieser Platzkante eine unkomplizierte, urbane Wohnlichkeit. Im Kontext des Rahmens, der vom zu erhaltenden Bestand vorgegeben wurde, ist das Konzept, die beiden Neubauvolumen auf zwei Hauptbaukörper zu konzentrieren, diese aber aus dem Raster zu lösen und mit einer Drehung auf benachbarte städtebauliche Richtungen zu beziehen, durchaus geglückt. Hinter der von der Winterreithalle markierten Linie ist das Museumsquartier nicht zu Ende: Eine Art Hintergasse, die sich zwischen Bestand und den Rückseiten der Neubauten durchwindet, entwickelt ein spezifisches Flair derartiger Zonen, mit Müllcontainern, Servicefahrzeugen, Berufstätigen und verirrten Touristen.
Hier stößt man auf den dritten großen Neubaukörper, jenen der Kunsthalle Wien, der parallel zur ehemaligen Winterreithalle, der nun zwei Veranstaltungshallen eingeschrieben sind, unmittelbar an diese anschließt. Der knappe verbleibende Umraum wird vom sogenannten Ovaltrakt gefaßt, dem hintersten Teil des Altbestands. Der lange Gassenraum dazwischen ist in seiner Kontrastwirkung nicht unattraktiv. Etwas problematisch scheint jedoch die beziehungsneutrale Distanzlosigkeit von Reithalle und Kunsthalle in städtebaulicher Hinsicht. Obwohl sie über einen gemeinsamen Eingang verfügen, signalisiert von einem hohen gemauerten Torbogen, dessen ziegelrote Schmucklosigkeit der Symmetrie der Reithalle ein Schnippchen schlägt, bilden sich hier die Zwänge am deutlichsten ab; die Durchfahrt für die Anlieferung, die Unverrückbarkeit der Winterreithalle, der knappe Platz erschwerten ein Interagieren von Neu mit Alt. Die zwei langen Baukörper sind aneinandergequetscht, die eigenartig asymmetrische Dachform des neuen läßt den Betrachter ratlos. Die Zugänge halten sich im wesentlichen an das Angebot des Bestands, der das Museumsquartier umschließt. Man betritt die (Klein-)Stadt der Museen in der musealen Stadt durch Torbogen. Oft zieren deren Schlußsteine süßlich modellierte Pferdeköpfe, die eher aus dem verklemmten 19. Jahrhundert als aus der Barockzeit stammen. Nur von Westen, aus dem siebten Bezirk wurde von der Breiten Gasse her eine Bresche in die Häuserzeile geschlagen. Ein Steg führt auf den umlaufenden offenen Gang, der auf Höhe Dachgeschoß des Ovaltrakts verläuft. Die beiden Arme dieses Weges leiten nach links und nach rechts durch Durchlässe, über weitere Stege und Treppen - ja, auch Aufzüge - auf die Terrassen hinunter, welche die Reithalle flankieren und als Zugangsebenen der beiden großen Museen dienen.
Auf die reale Hinterhofatmosphäre der alten Feuermauern und des noch zu regenerierenden Glacis-Beisels reagierten die Architekten mit einem gleichsam synthetischen Backstage-Design, dessen von der Kunsthalle entlehnter Ziegelbodenbelag befremdlich wirkt. Überhaupt scheint man sich hier in der Wahl der Mittel vertan zu haben. Die überkandidelten Geländer sind eben nicht anspruchslos, die verzogene, angeschnittene Rückseite des Ovaltrakts ist zu kleinkrämerisch. Mag sein, daß die Zeit die schlimmsten Wunden heilt, doch die Selbstverständlichkeit eines Wiener Hinterhofzugangs wurde nicht erreicht, die selbstgestellten Ansprüche, sofern sie bestanden, wurden nicht eingelöst.
Auch der südliche Zugang, von der Mariahilfer Straße her, läßt Fragen offen. Wer hat bloß die unsäglichen eckigen Betonkisten für die zahlreichen Bäume im Klosterhof zu verantworten, die den kleinen Hofraum zerstören?
Der Städtebau ist also halbwegs zufriedenstellend, wenn auch nicht sensationell ausgefallen. Die Vitalität der Nutzungen, vor allem die der Besucher wird sich der Plätze, Höfe und Gassen bemächtigen, sie beleben und permanent umfunktionieren. Neben Straßencafés werden sich wohl zwar keine Schuhputzer ansiedeln, aber vielleicht fliegende Fußmasseure, die den brennenden Sohlen der Besucher nach den vielen durchwanderten Sälen Linderung verschaffen. Nach dem Städtebau soll nun der Blick auf die Architektur der einzelnen Neubauten gerichtet sein, die nach dem Prinzip der harten Schale - weiß, anthrazit, rotbraun; Kalkstein, Basalt, Ziegel - gestaltet und unterschieden sind. Der augenfälligste Neubau ist das Museum Moderner Kunst, dessen hochgewölbte Dachform Signifikanz verleiht und dessen allseitige Fassade in dunklen braungrauen bis anthrazitschwarzen Farbtönen changiert. Mauerwerkstruktur und Farbtextur erzeugen ein faszinierendes Spannungsverhältnis. Lichtwechsel und Lichtfarbe - etwa bei Dämmerung - werden den Ausdruck ständig verändern, Regen auch. Der klare Baukörper wird immer wieder anders erscheinen, neugierig machen auf das Innere und sich längerfristig zu behaupten wissen. Die nach oben strebende Großform wächst wie ein Pilz aus dem Platzbelag heraus. Eine kragenartige Scheide aus hellem Stein definiert dessen Rand. Die anfangs gerundeten, nach oben gleitend schärfer werdenden Gebäudekanten verstärken die aufstrebende Wirkung. Warum ist aber der Abstand des weißen Wulstes zum Baukörper vorne und seitlich ungleich? Will uns der Architekt hier etwas mitteilen, wenn ja, was? Jedenfalls wirkt dieses Detail unentschieden in einem sonst starken und schlüssigen Konzept. Der niedrige Eingang, der von der Terrasse auf halber Höhe erfolgt, muß nach der breiten Freitreppe, die als Signal für die Besucher wirkt, nicht noch gesondert betont werden. Die scheinbare Beiläufigkeit ist sympathisch und beeinträchtigt den zugleich als Freiluftcafé genutzten Zwischenbereich wenig. Ein pompöser Eingang hätte die geschlossene Einheit des Baukörpers zerstört. Das Kunsthaus Bregenz oder die Landesbibliothek und das Landesarchiv in St. Pölten legten für einen Gebäudezugang in zurückhaltender Art und Weise die Spur. Wenn die Lage des Zugangs wie hier städtebaulich bereits definiert ist, braucht es kein auffälliges Portal mehr.
Im Inneren empfängt den Besucher eine hohe, ebenfalls mit Basalt verkleidete Halle, dessen Porosität raumakustisch angenehm dämpfend wirkt. Ein verglaster Lift ist heute offenbar ein Muß, während die gußeisernen Treppenstufen zumindest originell wirken, aber zugleich etwas erzwungen. Unverständlich immer wieder die Glasbrüstungen, auf die man sich nicht bequem stützen kann, auch wenn der eindrückliche Tiefblick - oder ein müder Rücken - dies nahelegen möchten. Das mittlerweile erforderliche Verbundsicherheitsglas mit zwei Glasscheiben, also vier Spiegelungsebenen, weist wegen der Glasstärke einen leichten Farbton auf und hat nicht mehr die Durchsichtigkeit einer einzelnen Scheibe - oder eines einfachen Metallgeländers aus schlanken Stäben.
Die Säle sind flexibel unterteilbar, das System der Beleuchtung drängt sich allerdings vor Hängung oder Aufstellung der Kunstwerke noch relativ stark in den Vordergrund. Die Raumakustik weist wegen der harten, glatten Oberflächen einen langen Nachhall auf, was bei Führungen problematisch sein wird. Und Lautsprecherdurchsagen wird man kaum verstehen. Das Prinzip der neutralen, weißen Räume, ausschließlich mit Kunstlicht, war ein Nutzerwunsch. Doch hier gibt es rasch wechselnde Moden. Nur im obersten Geschoß durchbricht ein breites Fenster, das den Blick auf Dächer und Kuppeln der Innenstadt freigibt, die hermetische Schale. Hier oben folgt die Decke auch der äußeren Wölbung, eine Galerie gibt dem für Veranstaltungen und die Vernissagen gedachten Raum individuelles Flair. Insgesamt hinterläßt das Bauwerk für das Museum Moderner Kunst, trotz einiger diskussionswürdiger Teilaspekte in architektonischer Hinsicht, einen guten, ja den besten Eindruck. Der große Quader für das Museum Leopold bildet dazu das städtebauliche Gegenstück. Er ist weniger hermetisch, mit Fensteröffnungen in der blendend weißen Natursteinschale. Mit einer breiten Treppe zur Eingangsterrasse hinauf und dem bescheidenen Eingang ist es gleich erschlossen wie das dunkle Schwestergebäude. Der Grundriß ist nach dem Windradprinzip um eine hohe zentrale Halle organisiert, was außen mittels schmalhoher Fensterschlitze ablesbar gemacht ist. Eine eigenartige Stelle in der Fassade ist jedoch dort, wo die Steinbank, die den Übergang der Gebäudebasis zum Platz formuliert, unvermittelt abbricht und nur mehr als steinerne Leiste fortgesetzt wird. Und gerade an dieser Stelle endet irgendwie der hohe Fensterspalt. Die primäre strukturelle Ebene mischt sich in nicht nachvollziehbarer Weise mit tertiären Detailaspekten. Diese Unstetigkeit oder Störung wirkt unbeholfen, wie „passiert“ und läßt die sorgende Hand des Architekten vermissen. Sollte sie jedoch gewollt sein, fehlt ihr der nötige Kick. Wenig gelungen sind auch die flachen, feldweisen Kanneluren des Kalksteinmantels. Auch hier fehlt eine architektonische Beziehung dieser Applikation zum Ganzen oder zu den eingeschnittenen Fenstern. Für eine kontrastierende Maßnahme ist sie wiederum zu schwach.
Die Kalksteinverkleidung zieht sich auch in die allgemeinen Räume der Innenwelt des Leopold-Museums. Oft deckt sie alle sechs begrenzenden Flächen der Räume. Die glatten Oberflächen schaffen raumakustische Probleme, auch wenn Konzerttauglichkeit nicht im Pflichtenheft gestanden ist. Der alles deckende Naturstein wirkt in diesem Ausmaß eher verkrampft und bemüht, was gewiß auch mit der nicht übermäßig sorgfältigen handwerklichen Bearbeitung zusammenhängt. Insgesamt verläßt der Betrachter das leere Haus nicht sonderlich befriedigt. - Der Entscheid, die Kunsthalle mit Ziegeln zu verfliesen, erscheint im Gesamtzusammenhang nicht sorgfältig genug durchgearbeitet. Immerhin ist die Gestaltung der langen Mauer zum Ovaltrakt gelungen. Der Gassenraum ist angenehm unprätentiös und ruhig, gewinnt sogar als der schönste der Hintergassenzüge eigenständige Qualität. Aber das Gebäude verliert seine Objekthaftigkeit im Vergleich mit den anderen beiden Museen, weil die Ziegel über alles und jedes und sogar noch bis zur Breiten Gasse hinauf gezogen sind. Das Innere einer Kunsthalle wird gewöhnlich einem permanenten Wandel unterworfen, doch auch hier tritt das Beleuchtungssystem stark in Erscheinung.
Die Erneuerung des ursprünglich von Fischer von Erlach geplanten langen Hauptprospekts durch Manfred Wehdorn ist noch nicht abgeschlossen. Die Chance, das Bauwerk im Sinne des Entwurfs Fischers in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht mit einer deutlicher differenzierten Dachlandschaft und einer Betonung der Eckrisalite zu stärken, wurde nicht wahrgenommen. Es zeigt sich bei diesem konservatorischen Ansatz ein Problem, indem selbst bei dieser architektonisch eher durchschnittlichen Bausubstanz und - bezogen auf die Renovationen des 19. Jahrhunderts - einem relativ geringen Gebäudealter der technisch-denkmalpflegerischen vor einer architektonisch-kritischen Erneuerung der Vorzug gegeben wurde.
In der gesamten Anlage waren zahlreiche Detailaspekte architektonisch zu lösen. Das sind Geländer, Treppenrampen, Anschlüsse von Alt und Neu, der Einbau von Liften, die Verteilung von Platzbelägen und so weiter. Ob es nun die in Steinbrüstungen eingeschnittenen zusätzlichen Glasgeländer oder überhaupt die gestalterisch stark hervortretenden, verschiedenen Geländerarten sind, die großen Glaslifte im rückwärtigen Bereich oder die sarkophagartigen Steinbänke vor der Reithalle: in dieser Maßstabsebene, in der der Mensch den Architekturelementen körperlich sehr nahe kommt, machen sich mangelnde Durcharbeitung in Hinblick auf Selbstverständlichkeit und Unkompliziertheit schnell bemerkbar. Wegen der angestrebten großen Keilform der Außentreppen werden beispielsweise die den Eindruck wieder schwächenden Glaseinsätze in Kauf genommen. Oder die attraktiven Gitter vor den Glasliften werden durch ihre anschließende Degradierung zu Geländern entwertet und entwerten ihrerseits die Liftprismen in ihrer Wirkung. Und wo stellt das erwartete, zahlreiche junge Publikum seine Räder hin?
Mag sein, daß bei so umfangreichen Projekten die Detailliebe nicht omnipräsent sein kann. Vielleicht handelt es sich auch um eine Entwicklung, die in anderen Ländern längst abgeschlossen ist und hier gerade nachvollzogen wird. Schade ist es allemal.
Spectrum, Sa., 2001.06.23
verknüpfte BauwerkeMuseumsQuartier Wien - MQ