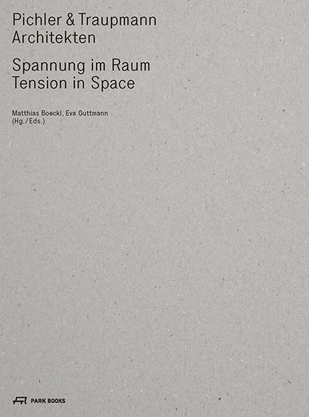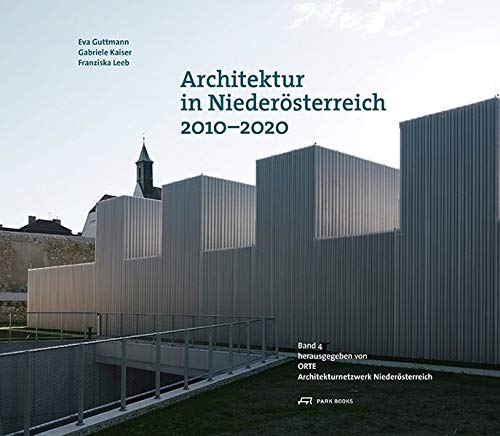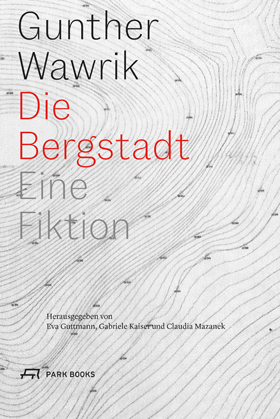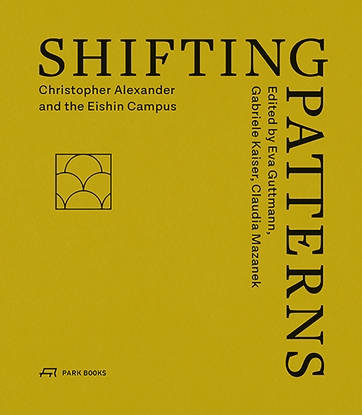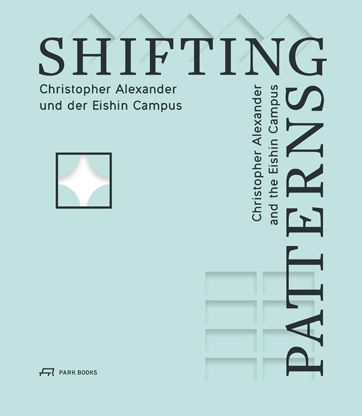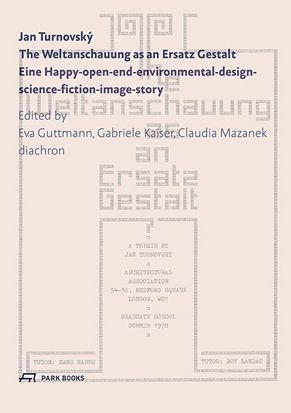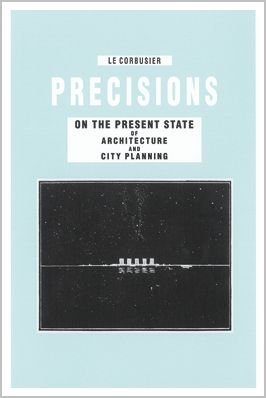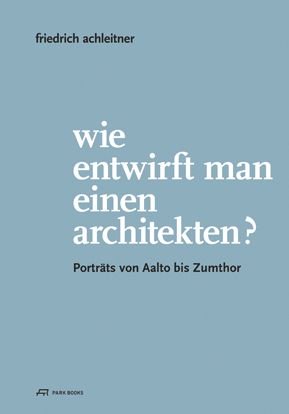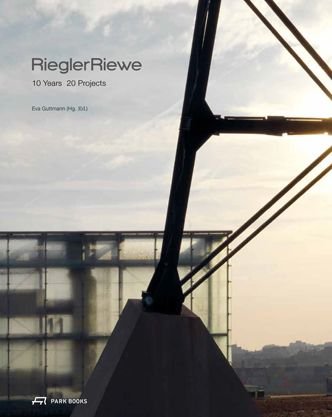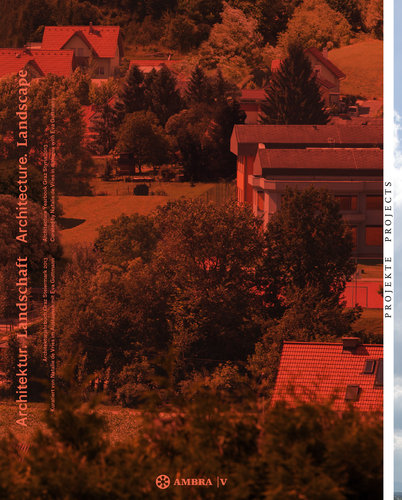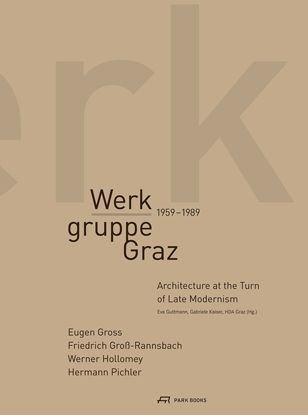Sachlich bis heiter
2009 wurde in Taufkirchen an der Pram, einer Marktgemeinde im Innviertel, ein neues, heiter-urban anmutendes Schulgebäude eröffnet. Aus einem von der Gemeinde ausgeschriebenen Wettbewerb war mit Dietmar Feichtinger ein Architekt als Sieger hervorgegangen, dessen Arbeiten für ihre technische Ausgereiftheit und visuelle Leichtigkeit bekannt sind.
2009 wurde in Taufkirchen an der Pram, einer Marktgemeinde im Innviertel, ein neues, heiter-urban anmutendes Schulgebäude eröffnet. Aus einem von der Gemeinde ausgeschriebenen Wettbewerb war mit Dietmar Feichtinger ein Architekt als Sieger hervorgegangen, dessen Arbeiten für ihre technische Ausgereiftheit und visuelle Leichtigkeit bekannt sind.
Das Grundstück für das Schulzentrum liegt südwestlich des Ortskerns von Taufkirchen zwischen der Bundesstraße Richtung Schärding im Norden und dem Flüsschen Pram im Süden. Der Neubau schließt im Westen an den bestehenden Kindergarten an und besteht aus einem parallel zur Straße liegenden, dreigeschossigen, lang gestreckten Baukörper, in dem Hauptschule, Musikschule, Turnsaal und Heimatmuseum untergebracht sind, sowie einem eingeschossigen, von großzügigen Terrassenflächen umgebenen Pavillon südlich davon, der die Volksschule beherbergt. Damit ist das Schulzentrum einerseits vom Verkehr im Norden abgeschirmt, andererseits konnte eine Öffnung der Klassenzimmer zum Naturraum der Pram erreicht werden. Diese Differenzierung ist auch an den Fassaden deutlich ablesbar: Während an der Nordseite eine ruhige, geschlossene Schindel- bzw. Glasfassade die Ansicht vom Ort bzw. der Bundesstraße aus dominiert, öffnet sich das Gebäude nach Süden hin und schafft mittels beschattenden Dachüberständen, Balkonen und durchgehenden raumhohen Glaselementen eine starke Verbindung zum Außenraum.
Der gesamte Neubau ist hell und transparent: Elemente wie der Stahl-Glas-Kubus, der zwischen die drei Baukörper eingeschoben ist und als Foyer die einzelnen Funktionen miteinander verbindet, der durchgehende Glasstreifen, der das zurückversetzte Erdgeschoss von den Obergeschossen trennt, oder die stirnseitige Verglasung des zweigeschossigen Pausenbereichs tragen ebenso zu diesem Eindruck bei wie die Schindelfassade, welche die Enden des Gebäudes als dünne Scheibe überragt und dadurch besonders klare Kanten formuliert, die von der Fassade übers Dach gezogenen Verglasungen, die damit zugleich als Oberlichten dienen, und der leichte Knick des nach Süden hin auskragenden Daches mit seiner Holzuntersicht.
Grundlage für all diese gestalterischen Maßnahmen ist das konstruktive Konzept, dessen Ausgangspunkt im Turnsaal zu finden ist. Dieser wurde ins Untergeschoss abgesenkt, um entsprechende wärme- und schalltechnische Vorteile ausnützen zu können. Das stützenfreie Volumen reicht über eine Höhe von zwei Geschossen und hat eine Spannweite von 40 Metern. Um darüber zwei Vollgeschosse errichten zu können und dennoch eine leichte Wirkung zu erzielen, wird der Turnsaal in seiner Mittelachse von einem Stahlfachwerkträger überspannt, in den die beiden Obergeschosse eingeschoben wurden. Daraus resultiert das System, das im gesamten Gebäude umgesetzt wurde: Ein Stahlskelett bildet die Tragkonstruktion, Massivholzelemente aus Brettsperrholz wurden für die ausfachenden Teile, Decken und Fassaden verwendet. So konnten eine zarte Tragstruktur und trotz großer Spannweiten – diese betragen etwa in den Klassenräumen bis zu 10 Meter in Querrichtung – vergleichsweise niedrige Konstruktionshöhen umgesetzt werden, wodurch die für den Architekten maßgebliche Leichtigkeit und Transparenz erreicht wurde.
Atmosphärische Gründe standen bei der Entscheidung im Vordergrund, die Konstruktionsmaterialien nach Möglichkeit sichtbar zu belassen. So sind der Stahlbeton des Gebäudesockels und des Erschließungskerns ebenso zu sehen wie das Stahlskelett und die flächigen Massivholzteile. Diese tragen ganz wesentlich zur sachlich-freundlichen Ausstrahlung des Schulzentrums bei, verfügen über große haptische und raumklimatische Vorteile und stellen eine Verbindung zum umgebenden Naturraum her. Darüber hinaus waren die Möglichkeit der Vorfertigung und die damit verbundene kurze Bauzeit ausschlaggebende Gründe, großflächig mit Holz zu bauen.
Die Detaillösungen in den Anschlussbereichen zwischen Holz und Stahl wurden so einfach wie möglich gehalten – eine Herangehensweise, die nicht nur wirtschaftlich ist, sondern aufgrund der guten Kombinierbarkeit beider Materialien auf der Hand lag. So wurden im Bereich des lang gestreckten Baukörpers die Holzdecken einfach zwischen die Stahlträger eingelegt, im Volksschul-Pavillon hingegen darunter abgehängt, um größere Maßtoleranzen zu erlauben. Um trotz der Sichtoberflächen den Brandschutzbestimmungen zu entsprechen, wurde eine technische Zulassung (Abbrandnachweis der die Stahlträger abdeckenden Dreischichtplatten über 30 bzw. 60 Minuten) für das Deckensystem erreicht, die Stahlträger wurden, sofern sichtbar verbleibend, zusätzlich mit einem brandhemmenden Anstrich (EI 30 bzw. EI 60) versehen. Die Schule verfügt über keine Sprinkleranlage, Hauptgänge werden mit Brandmeldern überwacht, darüber hinaus waren herkömmliche Brandabschnitte und Fluchtwege ausreichend. Problematischer war es, die hohen Schallschutzanforderungen zu erfüllen: Die für die Minderung der Schallübertragung aus Körperschall notwendige Masse wurde durch eine auf den Leichtbau abgestimmte präzise kalkulierte Schüttung auf den Geschossdecken erreicht. Die Leichtigkeit der Konstruktion wurde dadurch jedoch ebenso wenig in Mitleidenschaft gezogen wie ihre Schönheit.
zuschnitt, Mi., 2010.12.15
verknüpfte Bauwerke
Bilger-Breustedt Schulzentrum
verknüpfte Zeitschriften
Zuschnitt 40 Holz und Stahl