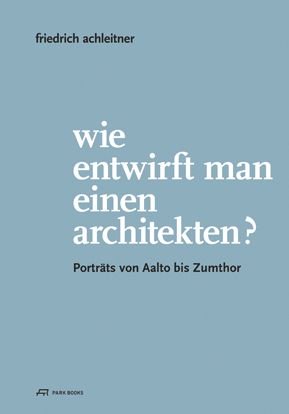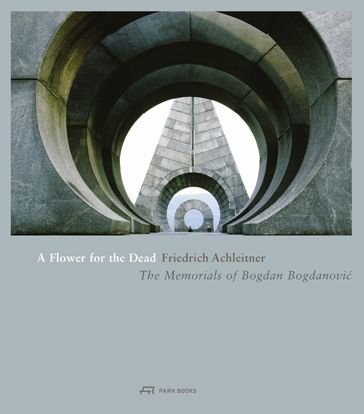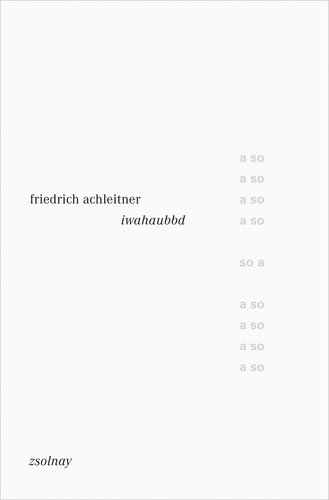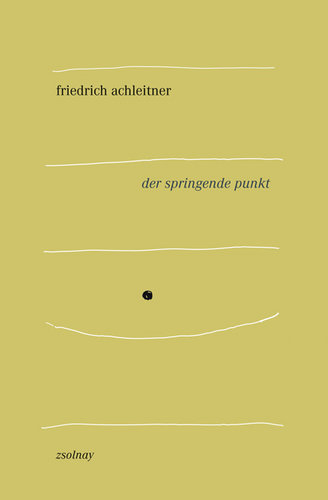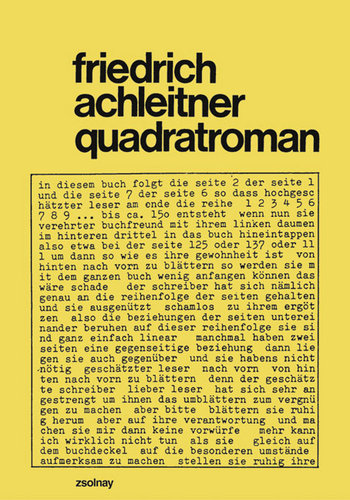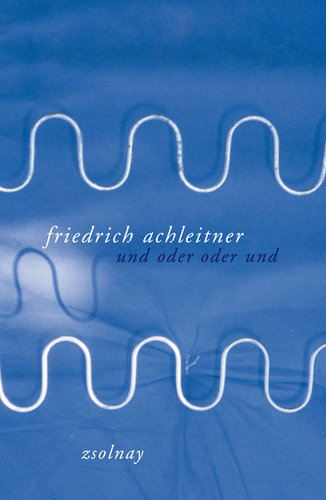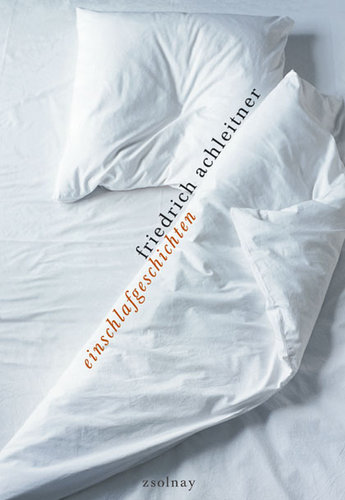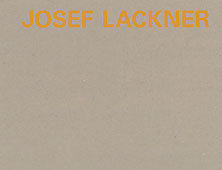1945-1975
Vermutlich ist heute der schlechteste Moment, um über diesen Zeitraum zu schreiben: Einerseits sind diese Jahrzehnte mit ihren architektonischen Fragen aus unserem Gesichtsfeld verschwunden, andererseits sind sie durch eine historische Aufarbeitung noch nicht neu in unser Bewußtsein getreten. Der Verfasser dieses Aufsatzes kommt in die paradoxe Rolle, selbst Subjekt und Objekt dieser „Geschichte“ zu sein, Interpret und „Zeitzeuge“ in einem.
Natürlich haben die fünfziger und sechziger Jahre heute eine Zeitdistanz, die selbst traditionellen Architekturforschern als genügend erscheint, um objektivierte Aussagen machen zu können, was natürlich einen älteren Referenten nicht von dem Versuch befreit, zunächst die eigenen Urteile und Vorurteile zu korrigieren.
Drei Dezennien
Man geht kein großes Risiko ein, wenn man behauptet, daß der Zeitraum von drei Dezennien als Beobachtungsfeld sehr willkürlich erscheint. Das erste Jahrzehnt kann zwar eine gewisse immanente Logik beanspruchen – schließlich erhielt 1955 Österreich den Staatsvertrag und damit seine Unabhängigkeit – aber auch mit diesem Datum ist es nicht viel anders als mit der „Stunde Null“ von 1945, die es nie gab, weil allein die personalen Kontinuitäten so stark waren, daß man architektonisch nur von einem gleitenden Übergang von einem Zustand in einen anderen sprechen kann.
Eine viel stärkere Zäsur, eine Art architektonischen Klimawechsel zeigte da schon das Jahr 1958, was noch zu belegen sein wird. Eine andere „Schwelle“ waren sicher die Jahre 1962/63, einerseits durch die Entwicklung im Kirchenbau, andererseits durch das Signal der Hollein-Pichler-Ausstellung in der „Galerie nächst St. Stephan“ und der damit endgültig eröffneten Funktionalismuskritik. Es hat keinen Zweck noch weitere Schwellen zu suchen, sie liegen je nach Bereich, ob Kirchen- oder Schulbau, ob sozialer Wohn- oder Industriebau, anders. Eine wirkliche Zäsur bildete sicher noch das Jahr 1973 mit der sogenannten „Ölkrise“, zusammen mit den Auswirkungen der Studentenrevolte kann man allgemein von einem größeren Bewußtseinswandel sprechen, der sich auch auf die Architektur, auf den Städtebau, sowie auf die Architektur-und Stadtforschung stark ausgewirkt hat.
Aber da wir es einmal gewohnt sind in Dezennien zu denken und die Jahre nach ihnen bezeichnen, halte ich mich an dieses Schema, auch mit diesem aussichtslosen Versuch einer Beschreibung.
Die späten vierziger Jahre oder: Eine Architektur der Symbole
Die frühen baulichen Entwicklungen der Ersten Republik sind am Beispiel von Wien am besten zu beschreiben. Wien hatte durch die Bombenschäden und die totale Vernachlässigung des Wohnbaus während des „Dritten Reiches“ einen quantitaviv hohen Bedarf an Wohnungen. Der Wiederaufbau konnte aber nur an den sichtbaren Symbolen der neuen (alten) österreichischen Identität demonstrativ vorgeführt werden, also an der Rekonstruktion der zerstörten politischen und kulturellen Objekte, allen voran Parlament, Burgtheater und Oper. Dabei ist ein kleiner psychologischer Nebeneffekt nicht uninteressant: Das zerstörte Abgeordnetenhaus wurde im Geiste einer zeitgemäßen, wenn nicht fortschrittlichen Architektur (Fellerer/Wörle) aufgebaut, während man die kulturellen Ikonen „Burg“ und „Oper“ (von uns Studenten heftigst kritisiert) in einem moderaten bis selbstverleugnerischen Eklektizismus rekonstruierte, obwohl die damit verbundenen Umbaumaßnahmen (etwa im Zusammenhang mit der Bühnentechnik) hier viel fortschrittlichere Lösungen erlaubt, ja verlangt hätten.
Neben den Staats- und Kulturbauten gab es natürlich innerhalb der Kommunen auch andere Anlässe, Symbole eines neuen, zukunftsorientierten Lebens zu schaffen, wie etwa in Wien das Freibad Gänsehäufel (Fellerer/Wörle) auf einer Insel der Alten Donau oder die Wiener Stadthalle von Roland Rainer. Was bei diesen Bauten die punktuelle Qualität ausmachte, das mußte im Wohnbau die Quantität sein. Das Wiener „Schnellbauprogramm“, eine von Franz Schuster entwickelte, leicht kombinierbare Typologie von später zusammenlegbaren Wohnungen, abgehandelt in einem ebenso adaptierbaren wie variablen städtebaulichen System, schuf, neben dem tatsächlichen Wiederaufbau der Baulückenfüllung, die Möglichkeit rascher Wohnungsbeschaffung.
Zur architektonischen Situation
Die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg studierende Generation hat es nicht verstanden, daß die Väter- und Lehrergeneration nach der Befreiung Österreichs nicht sofort wieder jene „Entwicklunglinien der Moderne“ aufgenommen hat, die sie scheinbar durch Hitler verlassen mußte. Im Gegenteil, auch jene Architekten, wie etwa Lois Welzenbacher oder, weniger bekannt, Hans Steineder, aber auch die im Lande verbliebenen Vertreter der „Wiener Schule“ (Max Fellerer, Eugen Wörle, Oswald Haerdtl, Franz Schuster u.v.a.) haben nicht nur die Fäden nicht wieder oder nur zaghaft aufgenommen, sondern in einer für uns unverständlichen Art über die Entwicklungen in den dreißiger und vierziger Jahren geschwiegen. Noch mehr: Ihre Architektur blieb jener moderaten Moderne verpflichtet, für die inzwischen die Schweiz und Schweden vorbildlich geworden sind. Heute weiß man natürlich, daß dieser geistige Anschluß an eine internationale Moderne gar nicht das Thema dieser Generation sein konnte, da sie ja schon selbst auf den unterschiedlichsten Ebenen die Demontage der Moderne eingeleitet hatte, dabei aber von zwei „Avantgarden“ (von Hitler und Stalin) politisch überrollt wurde. In Österreich war diese Entwicklung bereits durch den Ständestaat beschleunigt worden, der kulturpolitisch extrem österreichbezogen, zwischen Moderne und faschistischer Selbstdarstellung laviert hatte. Da die Architektur des Nationalsozialismus auf verschiedenen Ebenen die Erfahrungen der Heimatschutzbewegungen verwertete, konnte sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg (gerade im Wohn- und Siedlungsbau), nur gering modifiziert, fortgeführt werden.
Außerdem hatte die Regierung des neuen Österreich ein zwiespältiges Verhältnis zu den Emigranten und Vertriebenen, das heißt, statt sich die unbequemen Kritiker der jüngsten Vergangenheit ins Land zurückzuholen, zog man es vor, sich mit den „Belasteten“ (den ehemaligen Nationalsozialisten) zu arrangieren und den Wiederaufbau in einer konfliktfreien Melange von ambivalenten architektonischen Haltungen zu beginnen. Natürlich muß man auch zugestehen, daß die verarmte, zerbombte, hungernde und frierende Nachkriegsgesellschaft zunächst andere Sorgen hatte, als architektonische Glaubenskriege zu führen und für künstlerische Ambitionen wenig Verständnis herrschte. Das heißt mit anderen Worten, die Hauptkriterien für das Bauen waren Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit und zum Zuge kamen jene Architekten, die diese Qualitäten anzubieten vermochten.
Umso höher ist das Engagement jener Architekten anzusetzen, die vom ersten Tag an versuchten, den Wiederaufbau in eine Entwicklungsperspektive zu stellen, wie etwa Roland Rainer, der mit seinen Büchern „Städtebauliche Prosa“ und „Ebenerdiges Wohnen“ der Wohn- und Städtebaudiskussion erste Impulse gab. Hier wäre auch die Rolle der vom Wiener Stadtbauamt herausgegebenen Zeitschrift „Der Aufbau“ neu zu bewerten, es würde sich dabei zeigen, daß von Anfang an (unter dem Chefredakteur Rudolf J. Böck) verschiedene Fragen des Wiederaufbaus und der Stadtplanung auf einem hohen Niveau diskutiert wurden, aber den Planern und Architekten die Realität des schnellen Wiederaufbaus buchstäblich davonlief.
Architekturschulen
Die Technische Hochschule galt in den fünfziger Jahren mit den Lehrern Erich Boltenstern, Friedrich Engelhart, Karl Kupsky, Hans Pfann oder Siegfried Theiss als ein konservatives Institut, die Akademie am Stubenring (frühere „Reichshochschule“) war zwar mit renommierten Lehrern wie Max Fellerer, Oswald Haerdtl, Otto Niedermoser oder Franz Schuster besetzt, hatte aber merkwürdigerweise keinen „namhaften“ Ausstoß von Schülern. Lediglich am Schillerplatz (Akademie der bildenden Künste) entstand in der Polarität der Meisterschulen von Clemens Holzmeister und Lois Welzenbacher so etwas wie eine Talentschmiede, deren Absolventen das Baugeschehen von den sechziger Jahren bis heute entscheidend beeinflussen sollten. Allein die „Arbeitsgruppe 4“ (Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes Spalt) und die weiteren Holzmeister-Schüler Johann Georg Gsteu, Josef Lackner, Gustav Peichl, Hans Hollein und Anton Schweighofer, um nur die bekanntesten zu nennen, und der Welzenbacherschüler Ottokar Uhl, gehören zu den Schrittmachern der in den fünfziger Jahren sich entwickelnden neuen österreichischen Architektur. Es war vielleicht kein Zufall, daß ausgerechnet an der Technischen Hochschule unter den Fittichen Karl Schwanzers – der auch durch seine spätere Besetzungspolitik eine radikale Erneuerung des „Lehrkörpers“ einleitete – Günther Feuerstein sein „Clubseminar“ entwickeln konnte, das zum Sammelbecken und Treibhaus der meisten revolutionären Tendenzen der Studenten der sechziger Jahre wurde. Eine ähnliche Entwicklung kam in den Zeichensälen der Technischen Hochschule in Graz in Gang, natürlich unter anderen Bedingungen, vor allem mit einem anderen kulturellen Umfeld.
Schwerpunkte der frühen Entwicklungen
Es ist ganz interessant, sich der Schwerpunkte zu erinnern, in denen impulsartig die Entwicklungen stattgefunden haben. Obwohl im kommunalen Wohnungsbau der Stadt Wien zweifellos (gerade durch das Schnellbauprogramm des Franz Schuster und seinem an der Gartenstadtbewegung geschulten Städtebau) Eindrucksvolles geleistet wurde, konnte zu dieser Zeit kein architektonischer Fortschritt registriert werden. Diese Wohnanlagen – wie etwa in der Siemensstraße – werden erst heute, natürlich auch mit ihrer inzwischen entwickelten Vegetation, als Gesamtleistung positiv beurteilt.
Die eigentliche architektonische Diskussion fand merkwürdigerweise zunächst im Kirchenbau statt, ausgelöst durch eine sehr kleine Gruppe reformfreudiger „Neuländer“ wie Msgr. Otto Mauer oder Josef Ernst Mayer oder dem damaligen Jesuitenpater Dr. Herbert Muck und dem Herausgeber der „Christlichen Kunstblätter“ Dr. Günther Rombold. Besonders motiviert durch Clemens Holzmeister wurde diese Diskussion vor allem im Umfeld der „Arbeitsgruppe 4“ (neben dem „Einzelgänger“ Ottokar Uhl) geführt, die auch durch ihren Lehrer zum Bauauftrag der Kirche in Parsch/Salzburg kam. Die Aktivitäten hatten in der „Galerie nächst St. Stephan“ ihr geistiges Zentrum, wobei es Otto Mauer vor allem um ein neues Verhältnis der Kirche zur modernen Kunst ging. Dieses punktuelle kirchliche Interesse an der Kunst zeichnete eine so große Liberalität aus, daß es in der Folge (bis zum Beginn der siebziger Jahre) kaum eine architektonische Tendenz gab, die nicht in der Kirche baulich verwirklicht worden wäre. Das ästhetische Spannungsfeld reichte von Rudolf Schwarz bis zur „Arbeitsgruppe 4“, von Josef Lackner bis zu Johann Georg Gsteu und Ottokar Uhl, von Ferdinand Schuster bis zu Günther Domenig und Eilfried Huth. Beherrscht wurde der Kirchenbau trotzdem von den traditionalistischen Tendenzen, in denen Clemens Holzmeister oder Robert Kramreiter zur „Avantgarde“ zählten.
1958
Das Jahr 1958 vereint tatsächlich eine Summe von Ereignissen, die in verschiedenen Bereichen des Bauens einen Umschwung ankündigten. Neben der Fertigstellung der Wiener Stadthalle, dem Bau des Böhler-Hauses und der Berufung Roland Rainers zum Wiener Stadtplaner (und zwei Jahre vorher als Nachfolger Lois Welzenbachers an der Akademie am Schillerplatz), entsteht in Brüssel der Österreich-Pavillon von Karl Schwanzer (später Museum des 20. Jahrhunderts), das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) in Linz (Hiesmayr/Aigner) und – neben der bereits erwähnten kirchlichen Szene – beginnt sich auch schon von seiten der Künstler (Hundertwasser „Verschimmelungsmanifest“) das erste »Unbehagen am Bauwirtschafts-Funktionalismus« zu artikulieren. Auch Günther Feuersteins „Thesen zu einer inzidenten Architektur“ eröffnen den Reigen der Manifeste.
So gesehen, beginnen die sechziger Jahre tatsächlich mit einer Reihe von „Versprechungen“, die auch später in unterschiedlichen Formen eingelöst wurden. Von größerer Bedeutung ist noch, daß 1958 die Salzburger Seminare Konrad Wachsmanns an der Sommerakademie ihren Höhepunkt erreichen. Ihre Wirkung ist wiederum gerade auf die Holzmeisterschüler besonders groß, für die durch den rationalen, konstruktivistischen Ansatz der Wachsmannschen Thesen eine besondere Dialektik der Auseinandersetzung mit dem „Holzmeisterschen Erbe“ eingeleitet wurde. Vielleicht war es gerade das Spannungsfeld, das sich zwischen dem barocken Über-Ich Holzmeister und dem strukturalistischen Träumer Wachsmann aufbaute, daß diese erste Nachkriegsgeneration noch in der unmittelbaren Veränderung der baulichen Welt genug utopisches Potential vorfand, also es nicht notwendig hatte – wie die darauffolgende Generation – noch radikalere Ansätze zu suchen. Außerdem hatte (übrigens auch ermuntert durch Wachsmann) die Aufarbeitung der Geschichte der eigenen Moderne begonnen, der es an „rückwärtsgewandten Utopien“ ohnehin nicht fehlte.
Der Aufbruch der sechziger Jahre
Stark vereinfacht ausgedrückt, hat sich der „Aufbruch“ in den frühen sechziger Jahren auf drei Entwicklungsschienen oder in drei kulturellen Grundhaltungen abgespielt. Die erste Position war die der sogenannten „klassischen Moderne“, also eine konstruktiv und funktional dominierte, positivistische und puristische Grundhaltung, die einen Dialog mit der Geschichte prinzipiell ausschloß und die vordergründig problemorientiert argumentierte. Zu dieser Gruppe von Architekten könnte man heute Roland Rainer, Karl Schwanzer, Ernst Hiesmayr, Wolfgang und Traude Windbrechtinger oder in Graz Ferdinand Schuster zählen. Historische Berührungen gestattete sich hierbei natürlich vor allem Rainer, aber, wenn man so will, ausschließlich auf einer typologischen Ebene der anonymen Architektur, also für eine Durchsetzungs- oder Legitimationsstrategie des verdichteten Flachbaus.
Die zweite Position war die eines erweiterten, ganzheitlichen Architekturbegriffs, der einerseits die Geschichte der Moderne (Auseinandersetzung mit Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Joz?e Plec?nik, Josef Frank etc.) aufzuarbeiten versuchte und Kontakte zu Rudolf Schwarz, Egon Eiermann, Konrad Wachsmann etc., aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit den dominierenden Architekturschulen (etwa jener des Mies van der Rohe) suchte. Die Bauten der „Arbeitsgruppe 4“, wie die Seelsorgeanlage von Steyr/Ennsleiten (mit Gsteu) oder das Kolleg St. Josef in Salzburg, sind gute Beispiele für diesen real erweiterten Architekturbegriff.
Die dritte Position wurde, wie schon erwähnt, von Hans Hollein und Walter Pichler bezogen – hier gibt es auch die ersten Beziehungen zu Graz (Raimund Abraham, Friedrich St. Florian) –; sie urgierte einen totalen Architekturbegriff, der vor allem alte positivistische Feindbilder wie das Symbol, das Ritual und den Mythos wieder „inthronisierte“. Natürlich sind die kommenden,vor allem studentischen Aufbrüche nicht unter dieser Positionierung zu subsummieren, obwohl sie alle die Kritik an den bestehenden Verhältnissen (auch an den sich selbst kritisch verstehenden Gruppen) teilen und einen bewußt unkontrolliert ausgreifenden, ja sich auflösenden Architekturbegriff anstreben. Wer Günther Feuersteins Aufzählung „Was uns bewegte“ heute liest, findet ein komplettes Kompendium jener Fortschritt signalisierenden Elemente, die es im Bereich der Kunst, der Alltagskultur, der Politik, der Wissenschaft und Technik, der Psychologie und Soziologie gab. Angedockt an das psychologisierende Moment des Wiener Aktionismus wurde hier ein unbegrenztes Gebiet der Wirkungs- und Wahrnehmungsforschung eröffnet, dessen Ergebnisse in den Bauten der achtziger und neunziger Jahre zu finden sind.
Auch in Graz ist, wenn man so will, eine realistische und eine utopische (fundamentalistische) Polarisierung zu sehen, die sich beide gegen einen Rettungsversuch der „Tradition der Moderne“ durch Ferdinand Schuster wandten. Schuster versuchte redlich durch ein Verarbeiten der neueren Architekturtheorie (vor allem aus den Bereichen der Semiotik, Soziologie und Politikwissenschaft) eine aktuelle Architekturlehre zu entwickeln, wurde aber vom vitalen Schub der frühen „Grazer Schule“ überrollt. Da diese Entwicklungen ohnehin in anderen Zusammenhängen dargestellt werden, sei hier nur darauf hingewiesen, daß sich die „Realos“ zunächst heftig aus der Schweiz (Walter Förderer, Peter Steiger, Christian Hunziker etc.) beinflussen ließen. Das erste bauliche Ergebnis dieses Kontaktes war die Pädagogische Akademie von Eggenberg (Günther Domenig und Eilfried Huth), aber vermutlich kamen auch für die spätere Beschäftigung von Eilfried Huth und anderen mit den Problemen der Partizipation Impulse von Hunziker.
Ein anderes Thema der sechziger Jahre ist die Entwicklung des neuen Bauens in Vorarlberg, wo die Doktrin der Rainer-Schule jene Bedingungen vorfand, die zu einer eindrucksvollen Entwicklung führten. Aus der Gegenkultur der „Randspiele“ in der sich in den „Wälder-Tagen“ die aufmuckenden Dichter, Literaten, Musiker, Künstler, Lehrer und Architekten versammelten, rekrutierte sich jene Klientel, die für ein neues, offenes und billiges Bauen zu haben war und dann schließlich zu jenem Multiplikationsfaktor wurde, der die ganze Baukultur des Landes veränderte.
Nach den Kirchen – Banken, Geschäfte und Wirtshäuser
Zumindest seit der Jahrhundertwende gehört in Wien der Umbau und die Einrichtung von Geschäften und Lokalen zur Spielwiese und zum Experimentierfeld junger Talente und es gibt kaum eine Architektenkarriere, die an dieser architektonischen Kleinkunst vorbeiführte. Für die sechziger und siebziger Jahre sind Namen wie Retti oder Schullin Symbole dieser Szene. Trotzdem war es für die Wiener Architektur ein besonderer Augenblick, als sich die „Z“ (ehemalige Zentralsparkasse der Gemeinde Wien) mit dem Engagement ihres Generaldirektors Dr. Karl Vak insofern der neuen Architektur zuwandte, als sie systematisch begann, mit den Spitzen der jüngeren Avantgarde ihre Zweigstellen einzurichten. Zwar kam der erste Versuch mit Hans Hollein nicht zur Ausführung, aber es folgte dann doch die Reihe mit Friedrich Kurrent und Johannes Spalt, Johann Georg Gsteu, Wilhelm Holzbauer, Hans Puchhammer und Gunther Wawrik, Günther Domenig und vielen anderen.
Wesentlich war, daß dabei keine Corporate Identity angestrebt wurde, sondern eben die unabhängige Qualität der Architektur als Werbeträger. Auch die private Szene boomte, da einerseits die Wiener Innenstadt in eine radikale Umbauphase eintrat, andererseits auch trägere Institutionen (wie etwa das Österreichische Verkehrsbüro) plötzlich bei Hans Hollein architektonischen Bedarf anmeldeten. Daraus entstand jene architektonische Kleinkunstszene, die in ihrer dynamischen Entwicklung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Es wäre ohne Schwierigkeiten möglich, die Wiener Architekturgeschichte der letzten vierzig Jahre allein an Hand dieser Bautätigkeit zu schreiben. Gerade die Dichte der historisch angereicherten Wiener Baukultur provozierte immer neue Ansätze oder anders gesagt, die ästhetische Zeitmaschine erforderte immer größere Anstrengungen um sie in Gang zu halten.
Wohnbau
Zumindest machen die sechziger Jahre den Eindruck, als wäre das Thema Wohnbau in Wien komplett ausgetrocknet. Die noch von Franz Schuster angestrebten fast biedermeierlichen Idyllen waren von stringenteren, sicher großzügigeren, aber auch schematischeren Überbauungen verdrängt worden. Die Konzepte Rainers, die noch um Maßstäblichkeit bemüht waren, wurden unsensibel, aber ökonomisch erfolgreich aufgestockt. Die Anwendung der Plattenbauweise (Camus-System) mit eigens entwickelten Grundrißtypen trug das ihre zum architektonischen Schematismus bei. Fehler – die jedoch außerhalb der Finanzierung des Wohnbaus lagen – wie etwa der Mangel an Folgeeinrichtungen (Jugend, Kultur, Verkehr etc.) trugen dazu bei, daß sich diese Quartiere schnell zu sozialen Problemzonen entwickelten. Heute ist Beruhigung eingetreten und es wird auch zu einer Neubewertung dieses Wohn-und Städtebaus kommen.
Auf diesem Hintergrund, inklusive der Kritik daran, wurde im Sinne des Fortschrittsdenkens der sechziger Jahre von Großbüros (etwa von Harry Glück) eine erfolgreiche konsum- und lifestyleorientierte Wohntypologie entwickelt, die in der Stringenz der Erfüllung „elementarer Wohnbedürfnisse“ und genormter Zufriedenheit – was immer das sei – zu ebenso plakativen wie angezweifelten Lösungsangeboten führte.
So avancierte der Wohnbau in den späten sechziger Jahren zum Hauptthema und somit war es auch kein Zufall, daß die Österreichische Gesellschaft für Architektur (bald nach ihrer Gründung) mit der Ausstellung „Neue städtische Wohnformen“ eine schon lange anstehende Diskussion eröffnete. Die Reaktion kam zunächst nicht von der Stadt Wien, was zu erwarten gewesen wäre, sondern vom „Bund“: Das damals noch existierende Bautenministerium schrieb im Rahmen der Wohnbauforschung die Wettbewerbsserie „Wohnen morgen“ aus, die zumindest in Wien und in Niederösterreich (Wilhelm Holzbauer und Ottokar Uhl) zu einem essentiellen Qualitätssprung führte. Die Wiener Diskussion um neue Wohnmodelle war teilweise an die beginnende Diskussion um die „alten Wohnmodelle“ des Wiener Gemeindebaus gekoppelt (Kapfinger/Krischanitz: „Wiener Typen“), wurde also in den neuen Aufbruch der siebziger Jahre hineingetragen.
Der zweite Aufbruch
Vermutlich war es kein Zufall, daß nach der Mitte der sechziger Jahre eine Art zweiter Aufbruch begann, signalisiert durch die ersten Auslandserfolge (Hollein: Reynolds-Preis; Holzbauer: Wettbewerb Rathaus Amsterdam; Schwanzer: BMW-München etc.), charakterisiert aber auch durch einige exemplarische Entwürfe und Bauten, wie etwa das Juridicum von Ernst Hiesmayr, das Tagungsheim St. Virgil von Wilhelm Holzbauer, die ORF-Landesstudios von Gustav Peichl, die Stadt des Kindes von Anton Schweighofer oder das Sanierungsprojekt von Badgastein von Gerhard Garstenauer. Allen diesen und noch einigen anderen Projekten gemeinsam war ein gewisses Vertrauen auf die Mittel eines konstruktiven Funktionalismus, an die soziale oder technische Innovation, mit eingeschlossen eine plakative Zeichenhaftigkeit, die gewissermaßen die Inhalte von Fortschritt auch ausstellte. Natürlich lagen zwischen dem „Manierismus“ eines Holzbauer oder der funktionalistischen und konstruktivistischen Semantik eines Peichl oder Garstenauer schon „Welten“, wenn auch die Blickrichtung vielleicht die gleiche war.
Ein eigenes Thema dieses Jahrzehnts wäre noch die beginnende Aufarbeitung der Architekturgeschichte der Moderne, das langsame Eindringen dieser Themen in heimische Verlage (Otto Wagner, Lois Welzenbacher etwa beim Residenz Verlag), das Erscheinen der ersten Architekturführer von Wien (Uhl, Feuerstein) und vor allem auch die Ausstellungstätigkeit von Kurrent und Spalt sowie die zunehmende Diskussion um Architekturfragen in der Fach- und Tagespresse.
Mit der sogenannten „Ölkrise“ von 1973 wurde dieser Höhenflug ziemlich radikal unterbrochen, nicht nur die über ein Jahrzehnt alte Kritik des Funktionalismus zeigte Wirkung, auch die Studentenrevolte und die aufkeimende Diskussion um die Postmoderne. Es war an der Zeit, daß der Architekturbegriff erneut unter die Lupe genommen wurde, was ja schließlich, vor allem in Wien, Graz, Salzburg und Vorarlberg mit sehr verschiedenen Ansätzen und relativ fruchtbringend geschah.
newroom, So., 1995.10.01