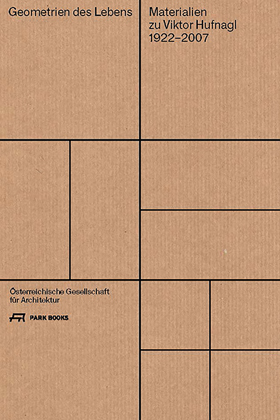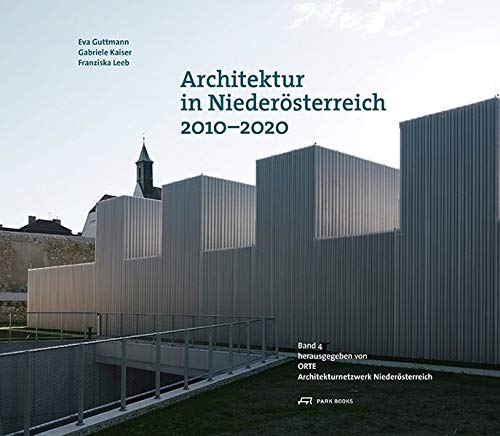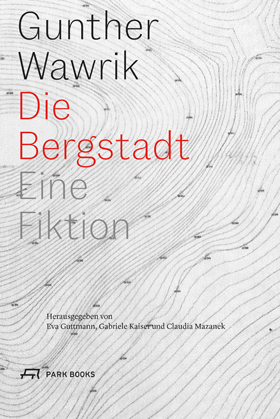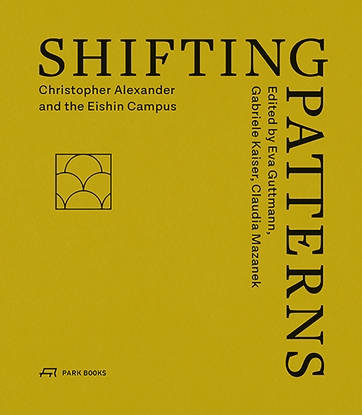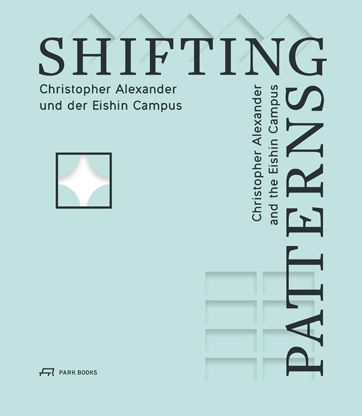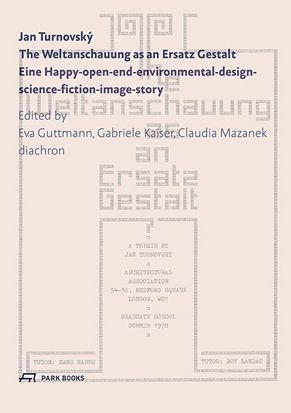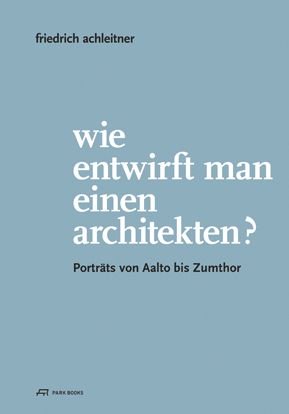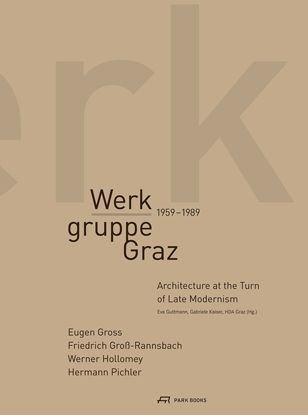Lob der Beständigkeit
Wer es nicht wusste: Der 17. Juni ist International Apple Strudel Day. Wir nehmen dies zum Anlass, um dem Café am Heumarkt, schräg vis-à-vis vom Wiener Stadtpark gelegen, einen Besuch abzustatten. Eine Zeitreise.
Wer es nicht wusste: Der 17. Juni ist International Apple Strudel Day. Wir nehmen dies zum Anlass, um dem Café am Heumarkt, schräg vis-à-vis vom Wiener Stadtpark gelegen, einen Besuch abzustatten. Eine Zeitreise.
Wegen des Apfelstrudels allein kommt niemand ins Café am Heumarkt. Schon eher wegen der Kuchenvitrine, die prominent im Raum steht, ein Eigenleben führt wie ein Haustier und alle paar Minuten mit einem Knattern auf sich aufmerksam macht. Die Vitrine, deren Marotte längst zum Inventar gehört, stammt aus den 1960er-Jahren, als das Kaffeehaus das letzte Mal erneuert wurde. Seitdem hat sich so gut wie nichts an der Einrichtung verändert.
Beschädigtes geht in die Alltagsroutinen des Lokals über, alles wird aus ökonomischen Gründen benutzt, solange es geht, und Repariertes muss nicht zwangsweise aussehen wie neu. Die spärlichen Neuanschaffungen (schwarze Klappsessel, weiße Monoblocks) lassen keinen ausdrücklichen (oder ausdrücklich keinen) Gestaltungswillen erkennen. In diesem Milieu der legeren Beständigkeit scheint die „im Heumarkt“ verbrachte Zeit der Gäste die wesentliche, ja vielleicht sogar die einzige Gestaltungskraft zu sein.
Und so haben sich im Verlauf vieler Kaffeehausjahre die Spuren des geselligen oder solitären Verweilens sichtbar in die Einrichtung eingeschrieben. Die Kaffeehausmöbel sind gesättigt von lebhaften Gesprächen und ausgedehnten Eigenbröteleien – die durchgesessenen Kunstledersitzbänke ebenso wie die geflickten Tapeten und angeschlagenen Marmortischchen. Dabei läuft das Schäbige niemals Gefahr, „shabby chic“ zu verströmen. Ganz im Gegenteil, das langsame und verlässliche Mitleben des Lokals mit seinen Gästen hat es in den Rang einer Wiener Institution gehoben. Im Extrazimmer hat sich ein reges Vereins- und Kulturleben etabliert, bei illustren Gästen war und ist es als alltäglicher Treffpunkt beliebt.
Gewiss hat das Café am Heumarkt schon bessere Zeiten gesehen (wer nicht?) und einige Zeit gebraucht, um zu seiner Identität zu finden. Heute liebt man diesen Ort für die authentische Mischung aus guten und schlechten Zeiten, für seine Geräumigkeit, vor allem aber für die Gelassenheit, die es der unprätentiösen Gastlichkeit der langjährigen Betreiber verdankt.
Vom Mehl zum Kaffee
Dabei waren die Anfänge des Lokals am einstigen Landstraßer Glacis bauzeitlichen Presseberichten zufolge äußerst „prachtvoll“. Im Eckbau der viergeschoßigen Häusergruppe, die der Hofbaumeister Anton Ölzelt 1852 bis 1858 auf der Parzelle des ehemaligen Mehlaufschlagsamts* errichten ließ, überzeugte das Café Wilda das Publikum, weil bei seiner Gestaltung „eine Künstlerhand das Arrangement des Ganzen“ leitete. Vom Ur-Interieur des Architekten Julius Schrittwieser sind heute noch Spurenelemente vorhanden, etwa die geschwungenen Intarsienbeine der durchlaufenden Sitzbank im längeren Raumschenkel des Cafés. Doch auch die beiden erstklassigen (heute ramponierten) Billardtische stammen noch aus der Ära des Kaffeesieders Heinrich Ludwig Wilda, der damals auch Pächter des Salons am Stadtpark war.
So raffiniert die Innenausstattung auch gewesen sein mag, seit jeher ist eine bauliche Gegebenheit – die Steinsäule am Gelenkpunkt des L-förmigen Raums – das eigentliche Prunkstück des Lokals. Der kleine Salon hinter dieser Säule, an beiden offenen Seiten von kräftigen Gurtbögen gerahmt, ist eine räumliche Preziose, die den Blick auf sich zieht, sobald man das Café betritt. Die flache Kurve der Gewölbe, die beide Raumachsen und das Entree wie helle Tücher überspannen, bildet zur dicken, gedrungenen Säule einen reizvollen Kontrast.
War das immer so? Läuft ein Grat des Gewölbes schon seit jeher frivol mitten in einer Fensterachse aus? Stand auch der amerikanische Holzofen, Marke „American Heating“, immer schon an seinem Platz, so wie die runden und rechteckigen Marmortische mit den markanten gusseisernen Fußkreuzen? Die Logik der Servierwege lässt kaum sinnvolle Alternativen zu.
Welche kleinen Veränderungen aber durchlebte das Interieur in den unsteten Jahren, die dem prachtvollen Auftakt folgten? Welche Szenen blitzten in den großen Wandspiegeln auf, die das unverstellte Entree noch weitläufiger erscheinen lassen, als es ohnehin ist? Die vielen Namenwechsel bezeugen ein reges Kommen und Gehen: Aus dem Café Wilda wurde das Café Zauner, daraus das Café Roth, daraus das Café Hummelberger, daraus das Café Raimund, daraus das Café Karl – und aus diesem das Café Bauer.
Resopal und rotes Kunstleder
Um 1930 taucht dann erstmals der Name des Kaffeesieders Josef Kührer auf, dessen Nachfahren Michael und Alexander Tomoff das Lokal nun seit Jahrzehnten führen. „Kührer & Tomoff“ steht auf einer winzigen Plakette über dem Eingang. Dieser unauffällige Eingang samt Windfang datiert aus den 1960er-Jahren, als sich zur etablierten Nachbarschaft des Eislaufvereins, des Stadtgartenamts und des Konzerthauses die hohe Scheibe des Hotel Intercontinental dazugesellte.
Ob an der damaligen Erneuerung des Cafés eine Künstlerhand beteiligt war? Jedenfalls griff diese Hand zu den Materialien der Stunde: zu eloxiertem Aluminium (für das Türportal, den Windfang und die Fenster), zu Resopal (für die Lamperie) und zu rotem Kunstleder (für die Sitzbänke).
Als weitere Zutat sorgen lachsrosa Kurzvorhänge in Karniesen sowie Gardinen und Blumentöpfe in den Fenstern für den Charme einer Epoche, die nie darauf erpicht war, „prachtvoll“ zu sein.
Doch da sich die jüngere Zeitschicht nicht blickdicht über die ältere schob, sondern ohne besondere Kunstfertigkeit mit all dem Vorhandenen verwob, ist im Café am Heumarkt seine gesamte bisherige Zeit wie in einem Palimpsest ablesbar. In dieser Gleichzeitigkeit aller Zeitschichten inklusive aller Gebrauchsspuren der Gäste bleibt das Café am Heumarkt gegenwärtig und lebendig.
Derzeit klebt an der Wand ein Zettel mit dem mal zentrierten, mal linksbündigen Hinweis: „Trotz Renovierungsarbeit aufrechter Betrieb.“ Auf eine Schrecksekunde folgt die Erleichterung. Es werde nur die beschädigte Wandverkleidung repariert, sagt Herr Tomoff und trägt einen leeren Kuchenteller, vom Knattern der Vitrine begleitet, in die Küche zurück.
*Das über die Landstraße angelieferte Mehl wurde auf der sogenannten Mehlwaage gewogen, um die zu entrichtende staatliche Steuer zu ermitteln. Mit der Eingemeindung der Vorstädte 1850 entfiel diese Steuer, und das k. k. Mehlaufschlagsamt wurde obsolet.
Der Standard, Sa., 2023.06.17