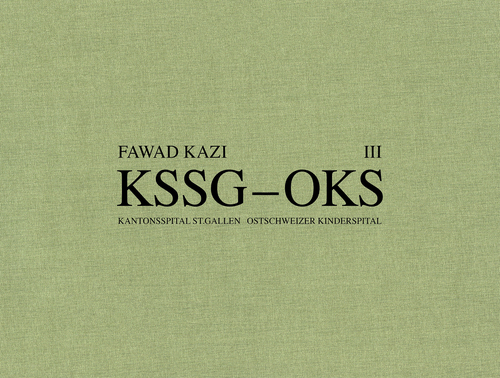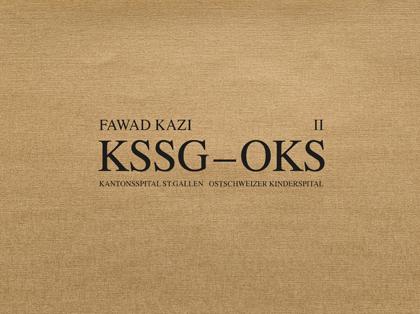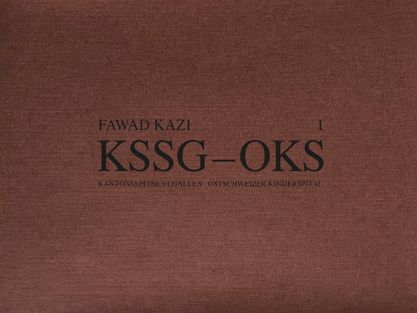«Neben Handschrift braucht es auch Überraschendes»
Das Interesse an Stoff und Raum verbindet die Architektin Anna Jessen und den Modedesigner Albert Kriemler. Wie begründet sich die gegenseitige Affinität? Und was inspiriert sie in ihrem kreativen Schaffen?
Das Interesse an Stoff und Raum verbindet die Architektin Anna Jessen und den Modedesigner Albert Kriemler. Wie begründet sich die gegenseitige Affinität? Und was inspiriert sie in ihrem kreativen Schaffen?
TEC21: Herr Kriemler, Sie haben ein enormes Interesse an Architektur. Hätten Sie auch Architekt werden können?'
Albert Kriemler: Ja, da ist eine grosse Nähe. Und ich wäre vielleicht auch Architekt geworden, wenn ich nicht die letzten 35 Jahre gemeinsam mit meinem Bruder Peter unsere Firma entwickelt hätte.
Anna Jessen: Ich finde, man könnte dich durchaus als Architekten bezeichnen.
Albert Kriemler: Es gibt interessante Gemeinsamkeiten. Aber das macht mich noch lang nicht zum Architekten. Dazu braucht man das Wissen, das aus Ausbildung, Gefühl und Erfahrung erwächst. Ich diskutiere gern über Architektur und bin ein Partner für Architekten, weil mich das Thema nicht nur in meiner Arbeit interessiert.
TEC21: Inwiefern lässt sich Ihre Arbeit mit der eines Architekten vergleichen?
Albert Kriemler: Architekten, Designer und Künstler arbeiten jeweils mit ihrer Kreativität. Grundsätzlich denken Architekten und Modedesigner über Proportionen nach. Was uns verbindet, ist der Zweck. Wir dienen einem Zweck. Ein Künstler drückt sich selbst aus. Bei mir steht das Material am Anfang, daraus folgt die Idee. Das ist sicher bei jedem Einzelnen anders, ob Designer oder Architekt.
TEC21: Sehen Sie noch weitere Parallelen?
Albert Kriemler: Wir fragen beide: Was ist der Mensch im Raum? Natürlich kann man auch von Architektur sprechen, wenn es um das Formulieren eines Volumens bei einem Kleid geht. Mit dem Thema Material ist der Aspekt Farbe eng verbunden.
TEC21: Frau Jessen, Sie beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema des «textilen Raums». Wo liegt für Sie die Faszination darin?
Anna Jessen: Die Beziehungen zwischen Stoff und Raum sind sehr vielfältig und ursprünglich. Das Gegenmodell zur Höhle und zum Erdhügel ist das nomadische Zelt. Da weist die Wand eine textile, gewobene und strukturelle Qualität auf. Der Begriff der «Wand» leitet sich ja offenbar vom althochdeutschen «want» ab, das wiederum verwandt ist mit dem heutigen Verb «winden» und das auf ein mit Lehm bestrichenes Geflecht zurückgeht. Die sprachliche Nähe zwischen Wand und Gewand drückt eine noch direktere Beziehung aus. Auch der Begriff der «Decke» als oberer Raumabschluss verweist auf einen sehr ursprünglichen Zusammenhang zum textilen Raum. Ähnlich verhält es sich mit dem Wort «Knoten», mit dem in der Architektur meist eine starre Verbindung bezeichnet wird, die eigentlich aber eine geknüpfte war, wie Semper es ausführlich dargestellt hat.
TEC21: Sie bauen einen neuen Studiengang für Architektur an der FHS in St. Gallen auf, der im Herbst den Betrieb aufnimmt. Wie lassen Sie dieses Thema dort einfliessen?
Anna Jessen: Unter dem Begriff «textiler Raum» unterscheide ich zwei Denkrichtungen. Es gibt die direkte Übersetzung und die Anwendung im übertragenen Sinn. Beide weisen ein grosses Potenzial auf. Ich glaube, dass das Textile wieder stärker ein Thema in der Architektur werden wird. Daneben gibt es den Begriff «Stoffwechsel», wie ihn Semper eben geprägt hat. Wir leben in einer Zeit des intensiven Stoffwechsels, in der plötzlich altüberlieferte Baustoffe neue Leistungsmerkmale erhalten und ihre klassische Verwendung neu interpretiert wird. Holz ist ein gutes Beispiel dafür. Da passieren spannende Dinge – bei textilen Materialien werden wir Ähnliches erleben.
TEC21: Sie haben aber auch eine ganz persönliche Beziehung zum Textilen.
Anna Jessen: Ich habe vor dem Architekturstudium eine Schneiderausbildung gemacht und immer Bekleidung für mich selbst angefertigt. Weil ich nirgends die Kleider bekommen konnte, die ich mir wünschte.
TEC21: Was hatten Sie denn vermisst?
Anna Jessen: Ich glaube, es hatte etwas mit der eigenen haptischen Wahrnehmung der Kleider zu tun. Sie sind dann natürlich auch so etwas wie eigene Zelte, erste Häuser, die du dir selber baust. Wir sind ständig umgezogen als Kinder – für mich ist es tatsächlich ein eigenes Haus gewesen, das ich mitnehmen kann. Und das ist es auch heute noch.
TEC21: Hat dies Auswirkungen auf Ihr architektonisches Schaffen?
Anna Jessen: Natürlich. Wenn ich heute beim Bauen Dinge füge, dann ist es oft das Bild: Wie und mit welcher Naht füge ich zwei Stoffteile zusammen?
TEC21: Worin gleichen sich für Sie die beiden Disziplinen?
Anna Jessen: Vor allem in der Bekleidung eines Körpers – wobei wir dann schon bei den Unterschieden wären: Denn wir entwerfen den Körper, sprich die Struktur ja mit. In beiden Disziplinen geht es um die Frage: Was sind Raumbeziehungen? Der ganze Entwurfsprozess hat Parallelen. Schnittstellen gibt es natürlich auch in der Art des Fügens, der Art eben, wie Nähte zusammenkommen. Das ist ganz nah an architektonischen Fragen.
TEC21: Ein Architekt, der sich dezidiert zu Mode und Architektur geäussert hat, ist Adolf Loos.
Albert Kriemler: Das Interesse an Loos begleitet mich in meiner Arbeit täglich. Für mich ist er ein wirklich genialer Architekt – gerade in Fragen der Materialiät und der Reduktion. Loos ist viel gereist und hat von jeder Reise Material mit nach Hause gebracht: japanische Tapeten, chinesische Seide, er wusste auch von Kaschmir und Tweed, alles war vom Feinsten.
Anna Jessen: Zur Frage der Materialität beschäftigt mich Mies van der Rohe noch mehr als Loos. Da ist der Stoff sehr präsent. Bei Mies hat das Pure des Materials eine grosse Bedeutung, die man in seinen Häusern sehr stark fühlt. Es gibt da eine haptische Verbindung zum Haus – während das Primäre bei Loos wirklich die Raumfügungen sind, wie die Räume dreidimensional miteinander verwoben sind.
Albert Kriemler: Ich sehe das etwas anders. Wenn Mies das Material in der Reduktion anwendet – und das tut er –, trifft er den Gedanken, den Loos zu wertvollen Materialien formuliert hat, ins Schwarze. Die Onyxwand in der Villa Tugendhat wirkt als massiver Wandkörper, der das Wohnzimmer von der Bibliothek trennt. Mies verwendet Stein, Hölzer wie Mahagoni und edle Stoffe. All diese Materialien sind wertvoll, sie besitzen Farbe und Struktur, benötigen also keine weitere Aufwertung durch Dekoration. Beim Wert und bei der Reduktion treffen sich Loos und Mies. Bei Loos gab es immer auch das Einfache.
TEC21: Um nochmals zu Loos zurückzukommen: Er hat auch Wesentliches zum Ornament geschrieben. Herr Kriemler, wie sieht Ihr Bezug zum Ornament aus?
Albert Kriemler: Das Zitat mit dem Ornament und Verbrechen wird immer ganz schnell aufgegriffen. In meiner Kollektion gibt es aufwendig gestaltete und verarbeitete Stoffe, oft moderne St. Galler Stickerei oder im Haus entwickelte Materialien, die man in ihrer Gesamtstruktur als Ornament bezeichnen könnte. Diese Ornamentik ist vollständig als Stoff in ein Kleidungsstück integriert und wirkt nie wie eine hinzugefügte Dekoration. So hat es die New Yorker Museumskuratorin Valerie Steele einmal beschrieben. Das Prinzip gilt auch für Drucke.
Anna Jessen: Mich interessieren bei Bauwerken nur die Dinge, die etwas fürs Ganze tun. Es gibt strukturelle und dekorative Ornamente. Auch deswegen ist die Mode von Akris interessant, weil das Ornament sehr stark strukturell ist. Wir suchen das ebenfalls in unseren Bauten.
TEC21: Können Sie das illustrieren?
Anna Jessen: Wo gehören zum Beispiel die Bronzerahmen der äusseren Verglasung im Verwaltungszentrum Oberer Graben hin? Auf jeden Fall haben die Öffnungen im Blech eine Funktion. Ihre Zahl und Anordnung ist hinsichtlich Strömungsverhalten und Lüftung des Kastenfensters im Computer simuliert worden. Aber erst die Übersetzung der Öffnungen in je zwei Halbkreise, die sich im Wechsel drehen, macht aus dem einfachen Loch im Blech – sprich aus dem Lochblech – ein spielerisches Element, das die reine Funktion sublimiert, poetisch sanft überhöht und den Charakter des Hauses akzentuiert.
Albert Kriemler: Wenn die Funktionalität unter der Idee leidet, dann darf man das nicht machen. Für mich hat die Funktionalität viel mit der Modernität und Selbstverständlichkeit eines Kleidungsstücks zu tun. Wenn es in irgendeiner Form kompliziert ist, dann ist es schon obsolet.
TEC21: Und doch braucht es eine Balance zwischen Entwurf und Funktionalität – so wie zwischen Tradition und Innovation.
Albert Kriemler: Das ist das Schwierige in der Architektur – und in der Mode ist es dasselbe: Wie entwickelst du deine Handschrift? Und überraschst trotzdem immer wieder mit dem Neuen? Ich habe gelernt, in unserem Entwurfs- und Entwicklungsprozess Raum für Überraschungen zu schaffen. Mode lebt von der Abwechslung, deshalb ist sie Mode. Und dennoch müssen wir innerhalb unserer Handschrift erkennbar bleiben, also Konstanz zeigen. Aber das ist es, was die Passion für den Beruf aufrecht erhält. Es ist eine permanente Evolution. Und das ist bei Architekten vielleicht nicht anders.
TEC21: Sie haben sich für Ihre Sommerkollektion 2016 von der Arbeit des japanischen Architekten Sou Fujimoto inspirieren lassen. Wie würden Sie diese Zusammenarbeit beschreiben? Wie erfolgte dieser Austausch?
Albert Kriemler: Die Auseinandersetzung mit der Architektur von Fujimoto war einer der Momente, wie ich sie immer wieder erlebe, wenn ich reise. Als ich seinen Serpentine-Pavillon von 2013 in London gesehen habe, war ich fasziniert davon, wie man mit einem weissen Metallstab und ein bisschen Glas so ein wunderbares Gebäude schaffen kann, das nicht nur eine fantastisch fragile, schöne Wolke ist, sondern auch als Pavillon funktioniert. Dieses Überraschungsmoment, wenn eine attraktive Erscheinung mit verblüffender Funktionalität zusammenfällt, ist für mich eine Parallele zur Mode.
Bei einem Akris-Kleid geht es um ähnliche Faktoren: Attraktivität, Angemessenheit, Freude an Funktionalität und das Ausreizen der Reduktion in jedem Detail hin zu einer einfachen Erscheinungsform.
TEC21: Wie war die Begegnung mit dem Architekten?
Albert Kriemler: Ich habe mit ihm auf Vermittlung des Fotografen Iwan Baan, mit dem ich befreundet bin, über Skype telefoniert und gesagt, dass ich gern eine Kollektion mit der Inspiration seiner Architektur entwerfen möchte. Und obwohl er keinen Bezug zur Mode hatte, hat es ihn interessiert, seine eigenen Arbeiten in einem anderen Kontext zu sehen. Dieser Vertrauensvorschuss ist eine wichtige Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit. So war es auch mit den Künstlern Thomas Ruff und Carmen Herrera. Das verpflichtet zu grösstem Respekt und zum Einsatz all dessen, was mein Team und ich zu geben haben. Danach haben wir uns zweimal in Paris getroffen und beschlossen, zusammenzuarbeiten. Im Sommer darauf habe ich ihn in Tokio besucht und ihm vorgelegt, was wir entwickelt hatten.
TEC21: Wie finden seine Bauten Eingang in Ihre Kollektionen?
Albert Kriemler: Es war seine Auswahl aus meinen Entwürfen. Seinen Naoshima-Pavillon hatte ich auf meiner Japanreise besucht, das Musikhaus in Budapest war ein Entwurf – wir hatten Lasercut-Technostoffe entwickelt, aber auch eine klassische Broderie Anglaise, in der sich jeweils die geplanten Öffnungen im Dach darstellten. Die Bambusstruktur seines Taiwan Towers – ein unrealisierter Entwurf – wurde zum feinsten Strickgewebe, das wir bis anhin gefertigt hatten. In Anlehnung an sein Miami-Projekt aus blauem Glas habe ich einen Stoff entwickelt, der an blaues Plexi erinnert. Die rote Tinte, mit der er alle Skizzen und Notizen festhält, wurde zu einem feinen Sommertweed. Und ein Foto von Iwan Baan vom «House N», seinem ersten gebauten Haus, wurde zu einem digitalen Fotodruck auf Seide. So gab es acht oder neun Themen um Fujimoto, die dann meine Sommerkollektion formulierten.
Anna Jessen: Du lässt dich inspirieren durch Fujimotos Architekturen, durch Teile seiner Architekturen, durch Wandgestaltung, durch Baustoffe, die er verwendet. Sie werden übersetzt in ein Kleidungsstück, das dann in einem Nachbau seiner Räume präsentiert wird. Der Raum und der sich darin bewegende, bekleidete Körper sind plötzlich miteinander verwandt und bauen so eine neuartige, spezifische Raumbeziehung auf.
Albert Kriemler: Das «House N» haben Appenzeller Schreiner aus Trogen für das Defilee massstabsgetreu auf dem Set im Grand Palais in Paris nachgebaut, weil ich mit den Pariser Handwerkern nicht zurechtkam. Die Rekonstruktion wurde zur Bühne für den Laufsteg und zum Eingang für alle Gäste. Sie war das erste Posting der New York Times von diesem Defilee.
TEC21: Gibt es weitere räumliche Interpretationen im Entwurf Ihrer Kollektionen?
Albert Kriemler: Ein schönes Beispiel war die Herzog-&-de-Meuron-Kollektion 2007/2008. Die Materialität und die aussergewöhnliche Gestaltung der Fassade, zum Beispiel des Walker Art Center in Minneapolis oder des de Young Museum in San Francisco, waren für mich die Inspiration. Ich habe versucht, diese aufregende Mehrlagigkeit im Erscheinungsbild der Stoffe zu spiegeln, zum Beispiel mit gebrochenem Aluminium in einer Seidengeorgette-Hülle oder einer St. Galler Spitze, die wie Asphalt aussah.
TEC21: Frau Jessen, wie gehen Sie mit dem Thema Inspirationen um?
Anna Jessen: Ich bin fasziniert, wie klar sich eine Kollektion auf eine Inspirationsquelle ausrichten kann. Bei uns Architekten läuft das meist unbewusster und über längere Zeiträume ab. Wir bauen uns einen Referenzraum auf, der durch Werke der Architektur, der Kunst und Alltagskultur geprägt ist. Wenn dann das Programm und der Ort dazukommen, dann muss dieser Referenzraum spezifisch und explizit werden. Das äussert sich dann zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit ruraler Holzarchitektur oder dem Funktionalismus der 1960er-Jahre. Deswegen sehen unsere Häuser und Ensembles auch immer anders aus. Für mich muss ein gutes Stück Architektur am Ort ankommen, auch wenn es neu ist und vielleicht provoziert.
Albert Kriemler: Was bei euch der Ort ist, ist bei mir der Stoff. Der steht im Vordergrund, und es ist schon typisch für uns, dass ich immer zuerst den Griff des Stoffs fühle. Und dann weiss ich, wie sich der Stoff verhält und was ich damit machen kann. Das ist ein Sinn für Haptik, den ich von meiner Grossmutter, der Firmengründerin, und meinem Vater geerbt habe.
Anna Jessen: Wir leben ja in einer sehr visuell dominierten Welt. Und doch behaupte ich, das Erste, was man von Architektur wahrnimmt, wenn man einen Raum betritt, ist es nicht das Visuelle, sondern es ist ein Gemisch aus Licht, Klang, aus Geruch …
TEC21: Könnte man das als Atmosphäre zusammenfassen?
Anna Jessen: Genau. Und manchmal beginnt auch bei uns der Entwurf mit einem Material. Am Schaffhauser Rheinweg haben wir mit einem Stück Holz angefangen und sind danach zum Städtebau gekommen. Nicht weil wir uns das vorgenommen haben, sondern weil ich finde, dass das Wohnen am Wasser sich am besten in Holz ausdrückt, vielleicht weil man an ein Boot denkt. Wenn ich morgens barfuss auf meinen Balkon trete, dann ist ein Stück Holz unter meinen Füssen etwas völlig anderes als ein Stück Beton. Da denke ich wieder, Material und Struktur sind entscheidend, wenn es um die haptische Wahrnehmung geht.
Albert Kriemler: Das Interessante ist die Erscheinung in der Bewegung. Die visuelle Seite der Mode ist für viele das Entscheidende – der «Look» ist ja die Hautpsache in der Mode geworden. Für mich ist das nur ein Aspekt. Es beginnt mit dem Fühlen, und ich glaube, dass sich dieses Gefühl letztlich auf die Körpersprache der Trägerin auswirkt, auf ihre Präsenz. Es ist dieses Denken, das mich in der Arbeit für Akris prägt. Alles zusammen ergibt die Selbstverständlichkeit, die ich suche – wie du sie wohl auch suchst – beim Tragen und in der Erscheinung.
Anna Jessen: Darin liegt ein grosses Potenzial für die Architektur. Die Wahrnehmung in der Bewegung – des Betrachters, aber auch als Veränderung des Bauwerks durch seine Benutzung, im Tagesverlauf oder im Lebenszyklus. Vielleicht öffnet gerade die ephemere Kunst des Textilen wieder den Blick für die Zeitlichkeit der scheinbar immobilen Architektur.
TEC21, Fr., 2017.10.13
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2017|41 Stoff und Raum II – die Arbeit am Textilen