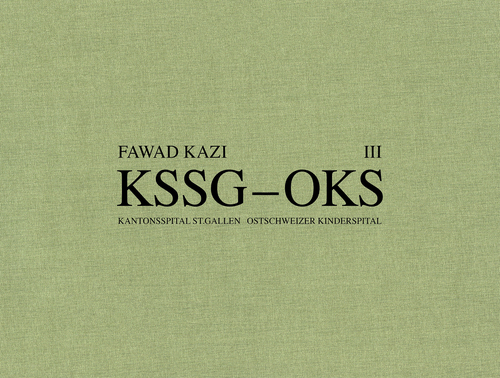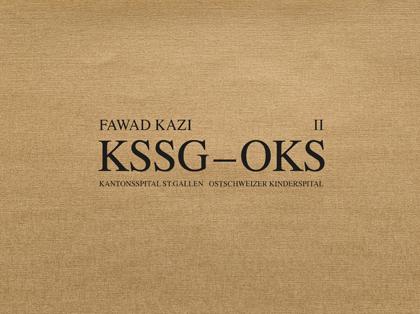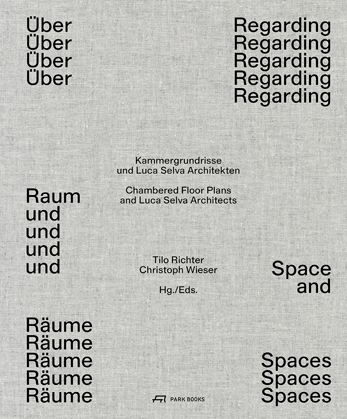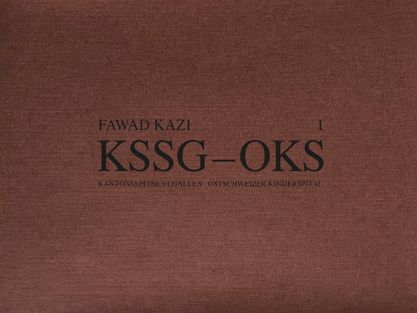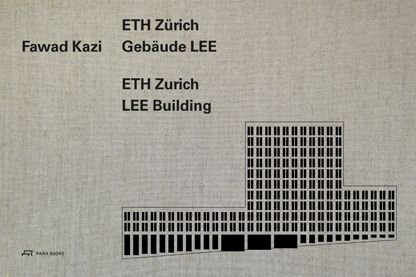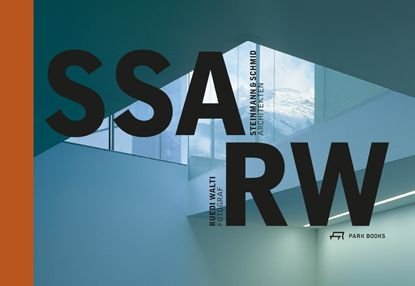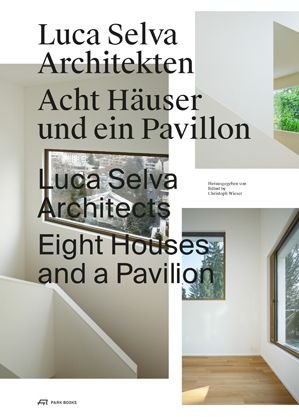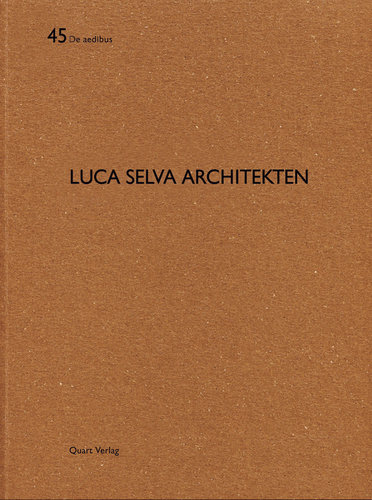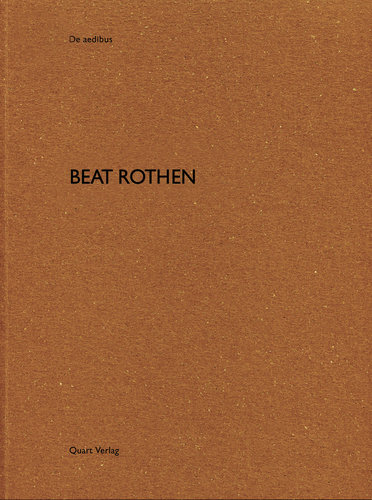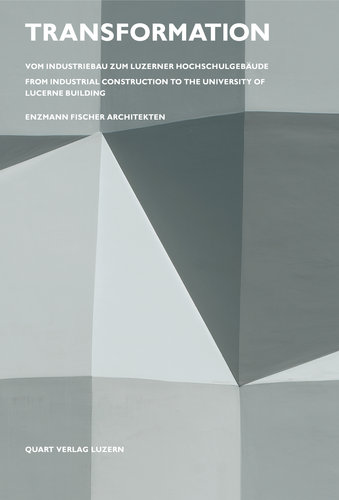Eigenständig, aber eng verbunden
Mit einem Flügelschlag befreit der Neubau von Christ & Gantenbein das Kunstmuseum Basel von der Monumentalität und Symmetrie des Hauptbaus. Er bezieht sich aber anspielungsreich auf ihn und etabliert so eine Beziehung, die allen zugute kommt: der Stadt, der Kunst und den Besuchenden.
Mit einem Flügelschlag befreit der Neubau von Christ & Gantenbein das Kunstmuseum Basel von der Monumentalität und Symmetrie des Hauptbaus. Er bezieht sich aber anspielungsreich auf ihn und etabliert so eine Beziehung, die allen zugute kommt: der Stadt, der Kunst und den Besuchenden.
Die im April dieses Jahres eröffnete Erweiterung ergänzt den streng axialsymmetrisch angelegten, von Rudolf Christ und Paul Bonatz erstellten Hauptbau von 1936 wie ein stadträumliches Passstück. Dieser bildet den Abschluss einer Reihe repräsentativer Bauten, die den St. Alban-Graben beidseitig säumen, bevor er mit einer Kurve zur Wettsteinbrücke überleitet.
An diesem neuralgischen Punkt befindet sich der Neubau. Das Grundstück wurde dem Kunstmuseum zusammen mit einer Spende von 50 Millionen Franken, der Hälfte der Gesamtkosten, von Maja Oeri geschenkt. Dieselbe Mäzenin ermöglichte bereits vor rund zehn Jahren mit der Stiftung des ehemaligen Nationalbankgebäudes – dem südwestlich anschliessenden Laurenzbau – eine erste Transformation des Kunstmuseums, in den die Bibliothek ausgelagert wurde.
Während sich der Hauptbau den stadträumlichen Gegebenheiten verweigert, sodass entlang der Dufourstrasse mehrere dreieckige Restflächen entstanden, ist der Neubau passgenau auf die Umgebung abgestimmt. Der Baukörper betont mit seinen Kanten und präzis gesetzten Knicken die räumliche Kontinuität der Strassenräume.
Gleichzeitig spielt er das Volumen frei und schafft zwei Plätze: Über die tief einspringende Ecke zum St. Alban-Graben entsteht beim Eingang ein Vorplatz, der die Kreuzung fasst und zentriert, und dank der Fassadenfront entlang der Dufourstrasse erhält der Hauptbau ein Visavis, die ehemalige Restfläche mit bestehendem Brunnen und Bäumen wird aufgewertet.
Neu befindet sich der Kassenbereich in der Kolonnade des Hauptbaus – so können die Besucher frei wählen, ob sie zunächst über den grossen Hof das Stammhaus betreten oder direkt zum Neubau gehen wollen. Obschon beides möglich ist, sind die Hierarchien klar verteilt: Der weitgehend geschlossene Neubau erweckt durch die wuchtigen verzinkten Gitter beim Eingang und der Anlieferung einen noch introvertierteren Eindruck als der Hauptbau.
Seiner massigen Hausteinmauern von 90 cm Dicke wegen wurde Letzterer als «Tresor der Kunstschätze» bezeichnet[1] – eine Charakterisierung, die auch auf den Neubau zutrifft.
Stabile Ordnung mit Kontrapunkten
Bei aller Massivität ist beiden jedoch ein überraschend feinmassstäblicher Ausdruck eigen, hervorgerufen durch die Materialisierung. Sind es beim Hauptbau die verschiedenen Steinsorten und vielfach diversifizierten Formate, die den Fassaden eine gewisse Feingliedrigkeit geben, entsteht diese Wirkung beim Neubau über den Backstein (vgl. «Keine Illusion»).
Die lagenweise abwechselnd vor- und zurückspringenden, nur 4 cm hohen Steine betonen die Horizontale und gliedern über drei unterschiedliche Grautöne die Fassadenflächen zusätzlich.
Durch die «Feuergeburt», wie der deutsche Architekt Fritz Schumacher das Brennen der Ziegel bezeichnete,[2] erreicht das Material eine Beständigkeit, die beim Kranzgesims in Form eines Medienfrieses höchst effektvoll und auf neuartige Weise unterwandert wird: Mittels LED-Technik wird eine immaterielle «Flammenschrift» erzeugt, die auf Ausstellungen und Aktivitäten des Museums aufmerksam machen kann und so dem unverrückbaren Volumen eine dynamische Komponente verleiht.
Die Kombination von archaischem Mauerwerk und zeitgenössischer Technik findet im Innern eine Fortsetzung in der Gegenüberstellung von «armen» und «reichen» Materialien – Materialien, die aus unterschiedlichen Kontexten stammen und mit verschiedenen Bedeutungen konnotiert sind wie Marmor und verzinkte Stahlbleche, Gitterroste und hochwertige Eichenböden.
Die von den Architekten als «Cross-over» bezeichnete Methode verbindet nicht nur die Vergangenheit mit der Gegenwart. Sie verweist auch auf das gewandelte Kunstverständnis und die typologische Annäherung der Kunstmuseen an die Kunsthallen, hervorgerufen durch den Bedarf an möglichst flexibel nutzbaren Ausstellungsräumen für Wechselausstellungen.
Christ & Gantenbein werden dieser Anforderung in hohem Mass gerecht, indem der Neubau eine Vielzahl unterschiedlicher Räume bereithält, die mehrheitlich mit Sonderausstellungen bespielt werden sollen. Gleichwohl ist jeder Raum klar definiert, sorgfältig proportioniert und spezifisch belichtet. Kunstlicht, natürliches Seiten- und Oberlicht sind, wie im Hauptbau, die bewährten Mittel dazu. Sie verorten die Besucher im Gebäude und ermöglichen über einige wenige, grossformatige Öffnungen einen Bezug zur Umgebung.
Die architektonische Ordnung schafft für die Kunstwerke einen im doppelten Sinn stabilen Hintergrund: Die massive, auf Dauerhaftigkeit ausgelegte Konstruktion in Stahlbeton mit vorgefertigten, sandgestrahlten Rippendecken bildet das tragende Gerüst.
Zudem strahlen die langlebigen Materialien mit ihrer körperhaften Präsenz Beständigkeit aus. Dazu gehören neben Beton gebrochen weiss gestrichene Gipsplatten und Eichenböden in den Ausstellungsräumen, grauer Marmor bei den Treppen, verzinkte Bleche im Eingangsgeschoss sowie ein analog zum Hauptbau grob strukturierter Verputz im Treppenhaus. Dessen ausgesprochen kühles, etwas gewöhnungsbedürftiges Grau steht in deutlichem Kontrast zum warmtonig gehaltenen Gebäude der 1930er-Jahre.
Die mit der Farbgebung verbundene Atmosphäre des Neubaus entspricht einem wesentlichen Zug der hervorragenden, weltweit ältesten öffentlichen Kunstsammlung: «Nüchternheit, Strenge und radikale Wirklichkeitsbefragung sind – vielleicht aus einer speziell baslerischen protestantischen Tradition heraus – über mehrere Jahrhunderte hinweg wichtige Kategorien für Ankaufsentscheide gewesen.
Daneben existiert jedoch auch eine diese Tradition kreuzende Leitlinie, die von der Lust zur Opulenz, zum Fabulieren, zu Ausschmückung und Faszination am Ding charakterisiert ist.»[3]
Treppenhäuser als Rückgrat
Solche Kontrapunkte begegnen einem auch im Neubau, besonders im Treppenhaus. Da finden sich eine überraschend geschwungene Treppenuntersicht, eine elegant geschnittene Geländerabdeckung in Marmor oder eine Verschwenkung der Treppenläufe zueinander.
Auf diese Weise entsteht eine Dynamik, die eingangs als befreiender Flügelschlag bezeichnet wurde. Die neue Treppe, die von der Eingangshalle des Hauptbaus hinunter zum grosszügig dimensionierten und mit Kunst bestückten Verbindungstrakt unter der Dufourstrasse führt, folgt der rechtwinkligen Logik des Bestands.
Das daran anschliessende Foyer im Untergeschoss der Erweiterung ist jedoch leicht abgedreht, worin sich die Positionierung des Neubaus manifestiert. Weil alle Ausstellungsbereiche parallel zu den umgebenden Strassen angeordnet sind, entsteht ein polygonaler Treppenraum, der die unregelmässige Form des Grundstücks aufnimmt und in eine ebenso imposante wie spannende Raumfolge übersetzt.
Dank der gleich starken Gewichtung der Treppenanlage im Neubau wie im Hauptbau entsteht eine innenräumliche Verklammerung der beiden Häuser, die bereits im Stadtraum als Paar auftreten. Es gelingt den Architekten, den Rahmenbedingungen der hochkomplexen Aufgabe gerecht zu werden und sie scheinbar mühelos in eine geometrisch entspannte Ordnung von hoher Stabilität zu überführen. Sie verleiht dem Neubau physische und stadträumliche Präsenz.
Anmerkungen:
[01] «Bautechnisches vom neuen Basler Kunstmuseum». In: Schweizerische Bauzeitung, 26.6.1937, S. 307.
[02] Fritz Schumacher: Das Wesen des Neuzeitlichen Backsteinbaus. München: Callwey 1920, S. 17.
[03] Bernhard Mendes Bürgi: «Vorwort». In: Derselbe und Nina Zimmer (Hrsg.): Kunstmuseum Basel. Die Meisterwerke. Ostfildern: Hatje Cantz 2001, S. 6–7.
TEC21, Fr., 2016.08.12
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2016|33-34 Kunstmuseen, erweitert