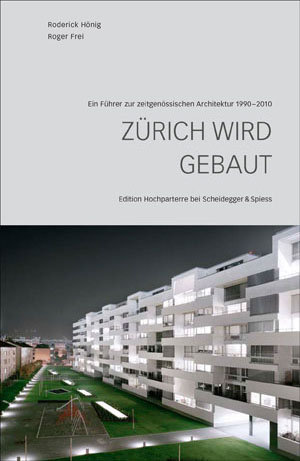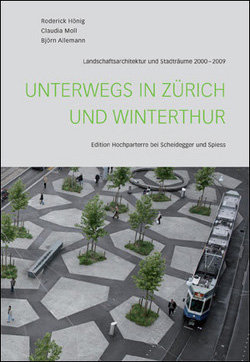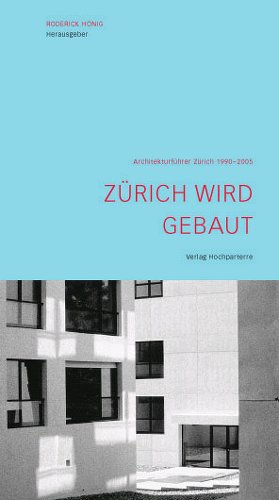In Ordos, der Provinzhauptstadt der inneren Mongolei, planen derzeit 100 Architekten aus aller Welt 100 Villen in 100 Tagen. ‹Ordos 100› heisst die kuriose Architekturolympiade im Auftrag eines mongolischen Milchmoguls. Im April war Ortstermin, Hochparterre war dabei.
In Ordos, der Provinzhauptstadt der inneren Mongolei, planen derzeit 100 Architekten aus aller Welt 100 Villen in 100 Tagen. ‹Ordos 100› heisst die kuriose Architekturolympiade im Auftrag eines mongolischen Milchmoguls. Im April war Ortstermin, Hochparterre war dabei.
«‹Ordos 100› ist eine grossartige Chance, China kennenzulernen, und eine tollkühne Performance des Individualismus der westlichen Welt», fasst Jachen Könz das Projekt zusammen. «Spannend finde ich auch den von Ai Weiwei und seinem Team aufgespannten Rahmen: Er macht kaum Vorgaben und garantiert grosse Freiheiten», meint der Bündner Architekt mit Büro in Lugano. Auch Reto Pedrocchi schwärmt: «‹Ordos 100› ist eine Utopie, wie sie derzeit nur in China realisiert werden kann.» Der Basler freut sich über die für ein junges Büro einmalige Chance: «Wir können spannende Erfahrungen in einem völlig fremden kulturellen Kontext sammeln und erst noch ein Haus bauen. Gleichzeitig ist die Vorgabe, dass man bereits das Vorprojekt inklusive Urheberrechte nach 100 Tagen aus der Hand geben muss, ein gutes ‹Höhentraining› für die Architektenpraxis in der Schweiz.» Für Simon Hartmann, vom Basler Büro HHF, steht noch ein weiterer Punkt im Vordergrund: «Anlässlich von ‹Ordos 100› lernen wir 99 andere Büros aus der ganzen Welt über ihr Werk, viele sogar persönlich kennen. Das Projekt ist deshalb auch eine ausserordentliche Gelegenheit, über Architektur zu diskutieren und freundschaftliche Beziehungen zu knüpfen.» Dass bei den Beteiligten kaum Kritik zur absurden Architekturveranstaltung zu hören ist, die eher Züge einer Kunstperformance trägt, überrascht nicht. Überraschend ist eher die Offenheit – oder ist es Naivität? –, mit der die meisten Teams der Einladung nach China folgten. Sie erhielten Ende 2007 eine E-Mail, die das Projekt nicht einmal skizzenhaft umriss, und mussten innert zehn Tagen zusagen. Honorar: 25 000 Euro für ein überarbeitetes Vorprojekt für eine 1000-Quadratmeter-Villa inklusive Urheberrechte.
Viel Geld und politische Rückendeckung
Doch beginnen wir von vorne, also bei Cai Jiang. Der Mongole spielt die Hauptrolle im kuriosen Stück – er ist der Bauherr. Der 40-Jährige ist ein zurückhaltender, makellos gekleideter Geschäftsmann mit Ziegenbärtchen und schwarzer Mercedes V-12-Limousine, einem 3000-Euro-Handy in der einen und einer kubanischer Zigarre in der anderen Hand. Von sich selbst sagt er, dass er seine Karriere begonnen hat, indem er mit Russen Kaschmir- und Süsswasserperlen gegen recyclierten Stahl getauscht habe. Heute führe Cai Jiang ein verzweigtes Rohstoff-Imperium. Das Nachprüfen, ob das stimmt, ist sowohl für die Architekten wie auch für den Journalisten ein Ding der Unmöglichkeit. Der Mongole besitze unter anderem eine der grössten Milchfarmen Chinas mit 50 000 Stück Vieh an der nördlichen Grenze zur Mongolei. Das wiederum kann stimmen, denn in seinem Privatmuseum steht ein Foto, das den Business-Bauern auf seiner Farm Arm in Arm mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao zeigt. Cai Jiang hat also nicht nur Geld im Überfluss, sondern auch die nötige Rückendeckung von ganz oben.
Wie es sich für einen kultivierten Neureichen gehört, sammelt der schlanke Chinese seit einigen Jahren zeitgenössische Kunst und lernt dabei – wenn einer das seriös tut, kommt er kaum um ihn herum – den voluminösen Ai Weiwei kennen. Der wiederum ist nicht nur Künstler, sondern auch (ungelernter) Architekt und hat sich in den letzten Jahren zu den weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten in der Kunst- und Architekturszene hochgearbeitet. Und weil Cai Jiang nicht nur mit Rohstoffen handelt, sondern auch im Immobiliengeschäft tätig ist, beauftragt er den Pekinger Künstler, der ‹Architektur als Hobby› betreibt, neben seinem Privatmuseum für Kunst und Architektur in Ordos Künstlerateliers zu bauen. So wurde aus der spinnigen Idee eine Realität: Das Museum wurde letztes Jahr eröffnet, Ai Weiweis elegante Artist-in-residence-Studios bekamen ihren letzten Schliff im April dieses Jahres. Beide Bauten sind die ersten realen Vorboten eines 1 460 000 Quadratmeter grossen ‹Creative Industry Park›, der rund um diese beiden ersten Leuchttürme herum entstehen soll. Die Investitionskosten gibt der Geschäftsmann mit 4,5 Milliarden Renminbi an, umgerechnet 650 Millionen Franken. Das Quartier für die noch in die innere Mongolei zu lockende Kreativ-Industrie soll aus Konzertsälen, Akademien, Theater, Filmstudios, Wohnungen und Büros bestehen. Und eben den 100 Luxusvillen, welche Cai Jiangs Yuan Water Engineering Company als Teil des Parks realisieren will. Das Budget für eine dieser 1000-Quadratmeter-Villen beträgt umgerechnet eine halbe Million Franken, der ganze Villenpark soll 50 Millionen Franken kosten. Cai Jiang will alle Villen bis Ende 2009 gebaut haben und sie für rund 1,5 Millionen Franken an örtliche Geschäftsleute verkaufen, die sie entweder selbst als Wohnhäuser oder als Gästehäuser für wichtige Kunden oder Geschäftspartner brauchen.
Und wie kam die ominöse Liste der 100 ‹Avant-Garde-Architekten› (Artforum) zusammen? Sie hat, wegen ihrer geografischen Unausgeglichenheit und des fehlenden Praxisnachweises einzelner Teams für bissige Kommentare in verschiedenen Architekturmedien (HP 4/08) gesorgt. Zusammengestellt hat sie Herzog & de Meuron, die bereits am Olympia-Stadtion mit Ai Weiwei zusammengearbeitet haben. Den verhältnismässig hohen Anteil an Schweizer beziehungsweise Basler Büros erklärt Jacques Herzog in der New York Times lapidar: «Die Zusammenstellung ist keine Aussage über ein Land, sondern ein Abbild unseres eigenen Netzwerks.» Voraussetzung für eine Einladung war also ein persönlicher oder professioneller Berührungspunkt mit dem Basler Büro: Eingeladen wurden ehemalige Mitarbeiter, Assistenten des ETH Studios Basel, Kollegen aus dem Lehrkörper in Harvard, Freunde von Freunden. Dass einige, vor allem amerikanische Architektinnen und Architekten, die vornehmlich in der Lehre und Forschung tätig sind, noch nie gebaut haben, ist für Simon Hartmann kein Ausdruck von Gefälligkeit: «Offensichtlich zählten bei der Auswahl nicht nur gutschweizerische Werte wie Praxiserfahrung und Werkliste, sondern auch andere Dinge, beispielsweise akademische Erfahrungen.»
Bauen in China?
«Wir haben lange diskutiert, ob wir bei der Aktion mitmachen oder nicht», antwortet Anne Marie Wagner auf die derzeit in deutschen Feuilletons heiss diskutierte Frage, ob man als westliche Architektin in einem Land mit einem politischen System wie China bauen darf. «Aber was haben wir davon, wenn wir nicht mitmachen? ‹Ordos 100› ist auch eine Gelegenheit, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen, sich mit dieser Frage direkt zu konfrontieren. Ausserdem bauen wir nicht für die Staatsmacht, sondern für chinesische Oligarchen. Und im Unterschied zu anderen Vorhaben dieser Art stehen Ai Weiwei und Herzog & de Meuron als Kuratoren für das Projekt.» Ähnlich sieht das Luca Selva: «Wir haben im Vorfeld, soweit es uns möglich war, recherchiert, wer der Bauherr ist. Cai Jiang ist ein Financier, wie es sie hier auch gibt. Er hat ein privates Wohnhausprojekt lanciert, an dem einige Fragen der Stadtentwicklung dranhängen.» Für den Basler ist klar: «Der Architekt ist immer Komplize, denn bauen tut nur, wer Geld und damit Macht hat. Das ist im Westen wie auch in China so.» Simon Hartmann doppelt nach: «Der Diskurs ‹Bauen in China – ja oder nein› ist interessant.» Aber die Basis, sich ein Urteil über den Bauherrn oder den sozialen und politischen Kontext zu bilden, sei wacklig. Architekten sähen nur selten, woher das Geld für ein Bauvorhaben wirklich komme, und trotzdem bauen sie, so Hartmann. «Der Ort als Kriterium für moralische Fragen erscheint mir ziemlich unbrauchbar. Ist ein Resort in den Schweizer Alpen a priori moralisch unbedenklicher als ein Projekt in China oder in den USA?»
Vorstadt in der Wüste
Und wie stellen sich die Teilnehmer zur Übungsanlage, also zum Verfahren, das keinen Kontext erzeugt, weil alle Architekten praktisch gleichzeitig und ohne Austausch an ihren Projekten arbeiten? Oder zum von Ai Weiweis Büro Fake Design dürftig ausgearbeiteten Masterplans, der nicht viel mehr als ein einfacher Raster von Bauparzellen ist? Viele Teilnehmer waren denn auch sichtlich schockiert, als sie zum ersten Mal das Ensemble der 28 niedlichen Modelle sahen, welche die Teilnehmer der ersten Phase ins Masterplanmodell in Ordos einsetzten. Sie bilden nicht etwa eine elegante Villensiedlung, sondern einen laut brüllenden Architekturenzoo. Sie formen eine Nachbarschaft, die in der Schweiz als Vorzeigebeispiel für schlechten Städtebau gelten würde. Es scheint, dass jeder einzelne der 28 Architekten der ersten Phase den – notabene unausgeschriebenen – Preis für Originalität gewinnen wollte und dabei deutlich übers Ziel hinausschoss. Die hohe Dichte – gefordert sind absurde 1000 Quadratmeter pro Villa auf Grundstücken mit einer Fläche von 1200 bis 2200 Quadratmetern – trägt das ihre zum traurigen Gesamtbild bei. «Es geht um die Erfindung von Suburbia. Was in unserer freiheitlichen Welt als Folge individueller Rechte entstanden ist, wird von Ai Weiwei geplant. Vorstadt ist für uns negativ behaftet, für die Chinesen positiv», meint Könz lakonisch. Mehr Mühe habe er mit der vorgegebenen Dichte: «Für ein Villenviertel sei sie zu hoch, für ein Stadtquartier zu niedrig.» Auch Reto Pedrocchi moniert den rigiden Masterplanentwurf: «Es wird ein Villenviertel entstehen, das an eine Semesterarbeit zum Thema Villa in der Vorstadt erinnert. ‹Ordos 100› wird eine Ansammlung von Einzelobjekten, eine Art Architekturausstellung. Wir konzentrierten uns deshalb auf den Innenraum.» Für Simon Hartmann ist klar: «‹Ordos 100› ist vielmehr Kunst- als Architekturprojekt – eine clevere Marketingstrategie, die bewusst auf unkontrollierte Diversität setzt.».
Der aus Architektensicht unausgereifte Masterplan überzeugt vor dem künstlerischen Hintergrund von Ai Weiwei: «Ich kenne meine eigenen Grenzen und wollte nicht, dass sie das Projekt limitieren», verteidigt sich der Künstler, «zudem gibt es für mich keine Grenzen in der Architektur, weder positive noch negative. Ordos ist eine ausserordentliche Gelegenheit, etwas zu lernen und seinen Horizont zu erweitern.» So sieht das auch Anne Marie Wagner: «Die wenigen Vorgaben erzeugen so viele Freiheiten, wie wir sie als Architektinnen selten geniessen. ‹Ordos 100› erwartet von uns eine gute Antwort, wie wir mit diesen Freiheiten umgehen. Wir nutzen die Gelegenheit für eine Selbstanalyse: Wir beobachten uns beim Entwerfen, fragen uns, wieso uns etwas fasziniert, und versuchen, daraus zu lernen.» Die ungewöhnlich grosse Entwurfsfreiheit, mit der viele der eingeladenen Architekten hadern, hat am Schluss vielleicht doch mit dem Ort zu tun, mit der grenzenlosen Weite der mongolischen Wüste.
[Roderick Hönigs Chinatagebuch und weitere Bilder unter: www.schweizblog.hochparterre.ch/architektur/hochparterres-china-tagebuch-1-tag.html]
Interview mit dem Künstler Ai Weiwei
Der Künstler Ai Weiwei hatte für die Kunst-Performance ‹Fairytail› an der letztjährigen Documenta 1001 Chinesen nach Kassel eingeladen. Dieses Jahr organisiert er ‹Ordos 100›. Roderick Hönig sprach mit ihm in China.
Ist ‹Ordos 100› die Umkehrung von Fairy-tail, also eine Kunstperformance?
‹Ordos 100› ist keine Performance. Der grosse Unterschied zu einer Kunstaktion ist, dass die Architekten hier einen Gebrauchsgegenstand für einen Bauherren entwerfen. Richtig hingegen ist: Ich bin Künstler und kein Architekt. Und weil nun viele Menschen das Gefühl haben, dass ich solche Projekte gut manage, beginne ich selbst zu zweifeln, ob ich überhaupt ein Künstler bin.
Um was geht es bei ‹Ordos 100›?
Für ‹Ordos 100› habe ich Architekten aus verschiedenen Kulturen eingeladen, sich mit China, mit Ordos und mit den anderen 99 Teams auseinanderzusetzen. Dass sie im vergangenen April alle in Ordos zusammentrafen, zwang sie dazu, miteinander zu kommunizieren. Und Kommunikation hilft, Grenzen zu überwinden, und löst sehr viele Probleme. Wichtig ist mir auch, dass die 100 Architekten merken, dass sie als Individuum nur ein Prozent der Masse ausmachen. Das verändert ihre Selbstwahrnehmung.
Was war zuerst: Der Bauherr Cai Jiang oder Sie mit der Projektidee?
Cai Jiang und ich kennen uns schon eine Weile. Aber der Kontakt ist lose: Er ist Geschäftsmann und ich Künstler. Ich habe die Ateliers neben seinem Museum gebaut. In der Folge schlug ich vor, für die Villen 100 Architekten aus der ganzen Welt anzufragen. So einfach war das.
Wie nutzen Sie das Projekt?
‹Ordos 100› ist für mich die Gelegenheit herauszufinden, wie wir ausländische Wissensressourcen effizient nutzen können. Im Westen wird viel mehr über Architektur nachgedacht, als gebaut. In China ist es genau umgekehrt. Anlässlich meiner Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron beim Olympiastadion habe ich gelernt, was es braucht, damit ein gutes Projekt entsteht und wie ein Architekturprojekt die aktuelle gesellschaftliche Situation verändern kann. Kurz, ich profitiere von den Kontakten und von den interessanten Gesprächen, die Architekten haben einen Auftrag und der Bauherr Cai Jiang macht ein Geschäft.
Einverstanden, Sie, der Bauherr und die 100 eingeladenen Teams profitieren. Wo aber profitieren chinesische Architekten?
Wie ich schon sagte, in China wird im ganz grossen Massstab gebaut, aber es wird ganz wenig oder einseitig darüber diskutiert. ‹Ordos 100› wird ein eigener Beitrag zur Architekturdiskussion in China werden.
Um die Diskussion zu lancieren, müssen Sie das Projekt kommunizieren. Wie sehen ihre Vermittlungspläne aus?
Im Informationszeitalter ist es eher schwer zu verhindern, dass so ein Projekt nicht die Runde macht. Als Sender werden die 100 Teams aus über 30 Nationen wirken. Sie werden ihre Erfahrungen aus China in ihre Projekte, aber auch in ihre Lehrtätigkeit einfliessen lassen.
Was ist für Sie wichtiger: der Prozess oder das Resultat?
Der Prozess ist wichtiger. Aber auch viele Architekten haben mir bestätigt, dass sie diese Gelegenheit, andere Architekten persönlich zu treffen und mit ihnen über ihre Arbeit und Architektur zu sprechen, sehr genossen haben.
Während der Fragerunden und Diskussionen haben die Architekten heftig über den ‹Architekturenzoo› debattiert, der entstehen wird. Waren Sie auch schockiert, als die das wilde Nebeneinander der Häuser zum ersten Mal sahen?
Für mich gibt es keine Grenzen in der Architektur. Weder positive noch negative. Die negative Bezeichnung ‹Architekturenzoo› hat für mich keine Bedeutung. Ich frage mich viel lieber, ob der heutige Tag eine Bedeutung hatte für mich oder nicht. Ich bin ein Pragmatiker: Lieber einen Architekturenzoo bauen, als darüber lästern und ihn nicht bauen. Diskutieren können wir ewig, nur wer baut, muss eine Entscheidung treffen. Noch einmal: Ordos ist eine ausserordentliche Gelegenheit, etwas zu lernen und seinen Horizont zu erweitern. Die Alternative ist der «sichere» Arbeitsalltag zu Hause.
Wie finden Sie die ersten 28 Entwürfen?
Die Formen möchte ich nicht kommentieren. Ich will nicht den Geschmack der Architekten kritisieren, sondern die Gebrauchstauglichkeit ihrer Entwürfe. Spannend finde ich, wie die Gestalter mit den vielen Freiheiten und den wenigen Randbedingungen umgegangen sind: Wie haben sie eine andere Kultur verstanden, welchen Respekt haben sie dem fremden Ort entgegengebracht.
Was meinen Sie mit Respekt?
Unter Respekt verstehe ich, dass die Architekten ein Haus entwerfen, das den Verhältnissen der Zeit und des Orts entspricht. Sie sollen aber etwas probieren, das sie in ihrem heimatlichen Arbeitsalltag nicht probieren würden.
Wie haben die Architekten auf ihre offene Fragestellung geantwortet?
Ich wollte möglichst wenige Randbedingungen aufstellen. Denn ich kenne meine Grenzen und wollte nicht, dass sie das Projekt limitieren. Einige Architekten haben gemerkt, um was es mir geht, andere werden es nie merken.
‹Ordos 100› wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, ein Statement zum energieeffizienten Bauen zu machen. Nachhaltiges Bauen ist kein Thema. Wieso?
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind nur zwei von vielen Antworten. Die Kritik aus dem Westen tönt immer gleich: Architektur in China erreicht das westliche Komfort-Niveau nicht. Gleichzeitig kritisieren viele Westler, dass chinesische Bauten nicht effizient mit Energien umgehen. Unser Beitrag zur Umwelt-Diskussion ist, dass die 100 Teams viel einfachere und viel billigere Häuser als in Europa bauen werden. In Europa oder in den USA kostet das Bauen rund sechs Mal mehr als in China.
Würden Sie in einer der Villen wohnen?
Jede der geplanten Häuser wäre gut für mich! Jeder Raum kann bedeutungsvoll sein.
hochparterre, Mi., 2008.06.18
verknüpfte Zeitschriftenhochparterre 2008-06|07
![]()