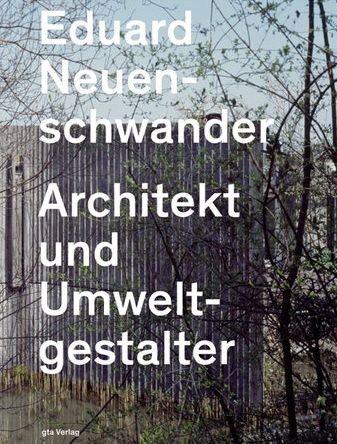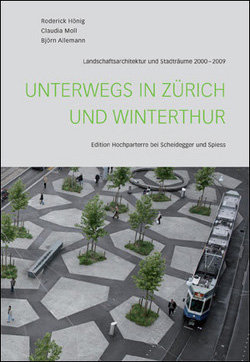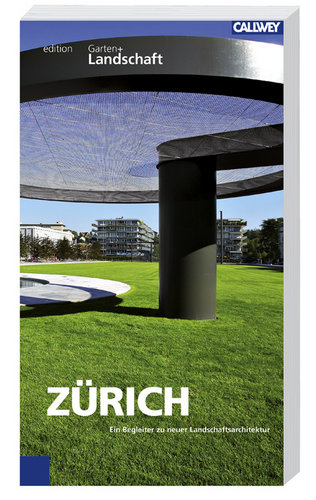Während langsam auch in deutschen Städten ein Trend zur Neugestaltung und »Öffnung« von Flussufern zu verzeichnen ist – etwa in Frankfurt, Ingolstadt oder unlängst in Wuppertal –, verdeutlichen mehrere bereits in den vergangenen vier Jahren realisierte Projekte in Zürich den vorbildlichen Umgang der Stadt mit ihren Flussufern. Diese bietet ihren Bewohnern kurzfristige Naherholung direkt am Wohn- oder Arbeitsort – und das auf bemerkenswert einfache und dennoch großzügige Art und Weise.
Während langsam auch in deutschen Städten ein Trend zur Neugestaltung und »Öffnung« von Flussufern zu verzeichnen ist – etwa in Frankfurt, Ingolstadt oder unlängst in Wuppertal –, verdeutlichen mehrere bereits in den vergangenen vier Jahren realisierte Projekte in Zürich den vorbildlichen Umgang der Stadt mit ihren Flussufern. Diese bietet ihren Bewohnern kurzfristige Naherholung direkt am Wohn- oder Arbeitsort – und das auf bemerkenswert einfache und dennoch großzügige Art und Weise.
Sommers wandelt sich Zürich, allseits eher als korrekte Bankenmetropole bekannt, zu einem wahren Badeparadies. Am See und entlang der zwei die Stadt durchfließenden Flüsse Limmat und Sihl laden zehn Badeanstalten und eine Vielzahl öffentlicher Zugänge zu den Gewässern zum Baden mitten in der Stadt ein. Vor allem die Ufer, an denen sich in der Vergangenheit Fabriken und Lagerhallen angesiedelt hatten, haben sich zu begehrten Bade- und Aufenthaltsorten gewandelt. Die konstant gute Wasserqualität hat bestimmt ihren Anteil an der hohen Beliebtheit. Dass immer mehr neue, öffentlich zugängliche Freiräume am Wasser entstanden, ist aber auch mit einem gesellschaftlichen Wertewandel und damit einher gehenden, neuen Ansprüchen an Erholungsgebiete in der Stadt zu begründen.
Bis heute wurden vor allem an der immer schon prominenteren Limmat – Ausfluss des Zürichsees – Projekte realisiert. Planungen und erste neu gebaute Anlagen zur Aufwertung der Ufer der Sihl – der Fluss, der von einem Seitental herkommend in die Limmat mündet – gibt es jedoch auch.
Wiederentdeckung der Flüsse – Wipkingerpark
In den letzten Jahren weihte die Stadt vier größere Projekte ein, die die neue Wertschätzung der Orte am Wasser verdeutlichen. Seinen vierten Sommer erlebt dieses Jahr der Wipkingerpark. Prägendes Element dieses Freiraums an der Limmat ist eine großzügige Treppenanlage zum Fluss. Sie befindet sich anstelle einer ehemaligen Ufermauer. Der heute intensiv genutzte Hauptteil des Parks war früher nicht mehr als ein Grünstreifen entlang dieser Mauer. Im Laufe der Zeit marode geworden, wollte das Tiefbauamt sie zuerst durch ein Low-Budget-Projekt ersetzen: Der Weg sollte verbreitert werden und eine Grünböschung die Mauer ersetzen. Das AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) bewilligte diesen Vorschlag nicht und plädierte für mehr Gestaltung. Drei Büros wurden aufgefordert, eine Projektstudie mit Honorarofferte und Ideenskizzen einzureichen, Sieger waren schließlich die Landschaftsarchitekten asp aus Zürich. Zu ihrer ursprünglichen Planung gesellten sich schon bald die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes des angrenzenden Gemeinschaftszentrums, eine bessere Anbindung des Parks an den bestehenden Uferweg und eine Neuorganisation der großen Wiese neben dem Spielplatz. Kernstück blieb aber die großzügige Treppenanlage: Auf 180 Metern Länge führen Stufen direkt ans Wasser. Sandsteinblöcke mit rauen Oberflächen unterbrechen an mehreren Stellen die lang gestreckten, glatten Betonbänder. Neben einer visuellen Auflockerung dienen sie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Genauso der vor den Stufen abgeflachte Flussgrund und die partiell aufgeschütteten Buhnen. Die Geröllpackungen unter den hohl aufliegenden Betonstufen werden zudem von den an der Limmat angesiedelten Zauneidechsen bewohnt.
Die langen Betonstufen haben zwar einerseits eine angenehme, unzürcherische Großzügigkeit. Andererseits kann die Treppenanlage gestalterisch aber auch als unsensibel gewertet werden: Das Projekt nimmt wenig Bezug auf den Fluss und seine Strömung, zudem spendet nur ein Baum auf der gesamten Länge Schatten. Dennoch scheint die Treppenanlage dem Bedürfnis vieler zu entsprechen: Kaum wärmen die ersten Sonnenstrahlen die Stufen, sind sie dicht besetzt von Schülern der angrenzenden Berufsschulen, Beschäftigten des neuen Quartiers Limmat-West und Bewohnern der umliegenden, mit Grünflächen eher unterversorgten Stadtteile. Bis spät in die Nacht wird hier der neue Ort am Fluss genossen.
Lettenareal – Bühne und Tribüne
Nicht weit flussaufwärts lockt ein weiterer beliebter Ort die Bevölkerung ans Wasser. Auch hier herrscht im Sommer Hochbetrieb, der »Oberen Letten« ist Zürichs Badeplatz schlechthin und Bühne und Tribüne für das alltägliche Theater. Ohne Tattoo und Piercing fällt man auf. Der ehemals als Bahntrasse genutzte, schmale Streifen entlang dem Wasserwerkkanal, einem Teil der Limmat, hat eine kontrastreiche Geschichte hinter sich: 1990 wurde der Zugverkehr eingestellt, das Gelände blieb sich selbst überlassen. Es wurde zu einem innerstädtischen Ruderalstandort – eine urspünglich vegetationslose Fläche, bei der sich im Laufe der Zeit wieder Pflanzen und Tiere ansiedelten, die sich am stark der Sonne exponierten Standort wohlfühlten. Und nicht nur das: Bald darauf hatte sich hier die offene Drogenszene eingerichtet, das Gelände wurde trotz zentraler Lage von der Bevölkerung gemieden. Nach der polizeilichen Räumung Anfang 1995 sollte es so schnell wie möglich neu genutzt werden. Die Stadt schlug die Fläche der Erweiterung der Badeanstalt am gegenüberliegenden Flussufer zu. Im Sommer desselben Jahres wurden eine Liegewiese, ein Beachvolleyballfeld und ein Holzrost am Wasser eingeweiht. Gerade sein provisorischer Charakter verlieh dem Ort seinen Charme und ließ ihn schnell zum In-Spot der Zürcher Szene werden. Als 2002 der wenige hundert Meter entfernte Lettentunnel aufgefüllt werden und die ehemalige Bahntrasse für den Zeitraum der Bauarbeiten als Baupiste dienen sollte, gab das Anlass zur Neugestaltung – weg vom Provisorium zu einer standhafteren Gestaltung. Das beauftragte Büro Rotzler Krebs Partner entwickelte ein Konzept, das zwei Hauptnutzergruppen gerecht werden musste: Erholungssuchenden und Eidechsen – auf dem Areal hatten sich in der Zwischenzeit so viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten angesiedelt, dass es als kommunales Naturschutzgebiet gilt.
Der östliche Teil des Geländes blieb weiterhin Pflanzen und Tieren vorbehalten. Mit Bahnschotter bedeckt, führt er bis zum zugemauerten Tunnel und ist idealer Lebensraum für die wärmeliebenden und geschützten Zaun- und Mauereidechsen – Barfüssige betreten diesen Abschnitt lieber nicht. Sie nutzen den westlich davon gelegenen Hauptteil mit Liegewiese, Sandflächen, Beachvolleyballfeldern und einem heute für Skater gestalteten Asphaltplatz. Zum etwas tiefer liegenden Uferweg führen Betonstufen, unterbrochen von teils neu gesetzten, teils spontan gewachsenen Bäumen. In einer Reihe fest installierter Container befinden sich während des Sommers eine Bar und ein Restaurant, dessen Außensitzplatz auf dem Dach der Container man über eine breite, hölzerne Freitreppe erreicht.
Obwohl der Holzrost nochmals um 16 Meter verlängert wurde und ein großzügiges Angebot an Liegeflächen besteht, findet man an einem schönen Tag nur schwer ein Plätzchen für sein Handtuch. Die Neugestaltung hat der Beliebtheit des Ortes keinen Abbruch getan. Die neuen Elemente ergänzen die bestehenden wie selbstverständlich. Keine gestalterischen Spielereien, sondern das Potenzial des Ortes – das kühle, stark strömende Wasser des Kanals – steht nach wie vor im Vordergrund.
»Kulturufer« Gessnerallee
Im Sommer 2005 konnte eine weitere Treppenanlage am Wasser der Sihl von der Bevölkerung in Beschlag genommen werden. Sie ist Teil der Außenräume der »Kulturinsel Gessnerallee«. In einer ehemaligen Militärreithalle und ihren Nebengebäuden hat sich seit den siebziger Jahren ein reges kulturelles Leben etabliert: ein Theaterhaus mit Restaurant und Bar auf der einen Seite der Straße, Schauspielakademie und Jugendtheater auf der anderen. Der Komplex liegt an der Spitze der Halbinsel, die Sihl und Schanzengraben bilden, längs geteilt durch die stark befahrene Gessnerallee. Durch den Entschluss der Stadt, unter dem Straßenraum eine Tiefgarage zu bauen, konnten zwei Parkdecks aufgehoben werden, die seit den fünfziger Jahren über den Flussraum kragten. Der Bau der Tiefgarage gab zudem Anlass, die Freiräume an der Oberfläche neu zu gestalten. Auch dieses Projekt planten die Landschaftsarchitekten von Rotzler Krebs Partner, die bereits an der Erstellung des Leitbilds Sihls (siehe nächste Seite) beteiligt waren. Mit einem durchgehenden Materialkonzept vereinheitlichten sie die einzelnen, kleinteiligen Außenräume. Die Stufen zum Wasser und neue Ufermauern bestehen aus grauem Sandstein, derzeit noch kleine Weiden nehmen Bezug zum Standort am Fluss und spenden künftig Schatten. Bis diese Treppenanlage zu einem angenehmen Aufenthaltsort wird, müssen die Bäumchen allerdings noch kräftig wachsen. Zurzeit sind die Stufen der Sonne und den Immissionen der viel befahrenen, angrenzenden Straßen stark ausgesetzt und werden erst zögerlich genutzt. Zudem hat die Sihl ein natürlicheres Geschiebe als die Limmat, was nach Regenfällen braunes Wasser bedeutet. Schwimmer vermochte der Ort noch nicht anzulocken, er wird bislang vor allem von den Schülern der Schauspielakademie während ihrer Mittagspause genutzt.
Schräg gegenüber, auf dem Areal, das heute noch von der Zürcher Hauptpost besetzt ist, soll ab 2010 das Quartier »Stadtraum HB« (Hauptbahnhof) entstehen. Den Wettbewerb für die Außenräume konnten auch Rotzler Krebs Partner für sich entscheiden. Ihren Plänen zufolge wird sich der Neue Bahnhofplatz an seinem flussseitigen Ende mit einer Treppenanlage bis an die Sihl schieben.
Historische Atmosphäre – Fabrik am Wasser
Auf halbem Weg zwischen Wipkingerpark und der nicht weit flussabwärts gelegenen Badeanstalt auf der Werdinsel gibt es seit 2007 eine weitere Bereicherung des Fußweges entlang der Limmat: der Außenraum der Ende 19. Jahrhunderts erbauten Fabrik am Wasser. Das Hauptgebäude der ehemaligen Seidenstoffweberei nutzt heute eine bunte Mischung von Handwerkern und Kreativen als Arbeitsort. Am Platz der 1992 abgebrannten Shedhalle entstand eine Grundschule und unmittelbar daran angrenzend neue Wohngebäude.
Zwischen Gebäudekomplex und Fluss befand sich früher der Fabrikkanal, das darin fließende Wasser formten die Landschaftsarchitekten Schweingruber Zulauf – sie gewannen bereits 1994 den nach dem Brand der Halle ausgelobten Wettbewerb – nach: Rasen-, Kies- und Betonbänder wechseln sich ab, in ihrer dynamischen Form erinnern sie an sanfte Wellen. Die Ufermauer ließen die Planer teilweise abreißen, hier »strömt« der Kanal in Form eines kleinen steinigen Strands in den Fluss. Eine partielle Tieferlegung des Uferwegs ermöglichte diese grundsätzliche Änderung des Außenraums. Das kurze »Strandstück« ist dank des direkten Zugangs zum Wasser eine willkommene Abwechslung am Uferweg, der ansonsten immer über dem Wasserspiegel des Flusses liegt. Die der Flussströmung angepasste Steingröße des Strands eignet sich zwar nicht zum In-der-Sonne-räkeln, Sand wäre hier aber im Nu weggespült.
Limmataufwärts, auf der anderen Seite des an das Haupthaus angebauten Turbinengebäudes, setzt sich das Band des ehemaligen Kanals fort. Hier in Form einer Kiesfläche, die dem Restaurant innerhalb des historischen Baus als Außensitzplatz dient. Ein Spielplatz schließt die lang gestreckte Form ab.
Eschen und Erlen stehen locker gestreut auf dem neu gestalteten Grünstreifen. Ob Passanten und Anwohner den nachgeformten Fabrikkanal als solchen erkennen, ist fraglich. Mithilfe des Bandes konnten die Planer aber der Fülle geforderter Nutzungsarten, klar zoniert, gerecht werden. Zudem bleibt die Geschichte des Ortes – wenn auch nur für Eingeweihte – ablesbar.
Eigenverantwortung statt Vorschriften
Allen Projekten ist eines gemein: Keinerlei Zäune oder Mauern trennen die Anlagen vom Wasser, obwohl die Strömung zeitweise stark und das Baden nicht immer ungefährlich ist. Steigt beispielsweise der Pegel der Limmat an, werden beim Wipkingerpark die untersten Stufen überspült. Die Stadt zeigt sich demgegenüber bemerkenswert offen und setzt auf Eigenverantwortung. Für sie sind die neuen Zugänge zum Fluss – ausgenommen das Lettenareal – offiziell keine Badeplätze. Baden ist zwar nicht verboten, geschieht aber auf eigene Gefahr. Genau diese Haltung ermöglicht die verblüffend großzügigen Lösungen.
All diese Einzelprojekte sind Teil übergeordneter Planungsinstrumente. Für die beiden Flüsse sind dies das Leitbild Sihlraum, seit 2003 in Kraft, und das Leitbild Limmatraum, das 2001 veröffentlicht wurde. Ziel dieser Leitbilder und des heutigen Umgangs mit den Flussufern ist es, einerseits den vorhandenen Erholungsraum aufzuwerten, neuen zu schaffen sowie Fahrrad- und Fußwegverbindungen zu verbessern. Gleichzeitig soll sich der ökologische Wert der Ufer erhöhen.
Die Leitbilder definieren auch für die Zukunft Visionen zur Aufwertung der Uferstreifen: Weitere, vor allem stadtauswärts gelegene Abschnitte sollen sich auch künftig zu attraktiven Naherholungsgebieten wandeln, ohne die Bedürfnisse von Pflanzen und Tiere außer Acht zu lassen.
db, Mo., 2008.09.01
verknüpfte Zeitschriftendb 2008|09 Draußen