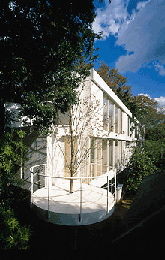Zwei Ausstellungen in Wien, zweimal junge Architektur, einmal aus Japan, einmal aus Österreich: von Papier, Kartonröhren, Wohnraum auf Autoabstellplätzen - und was einem hierzulande mitunter japanisch vorkommen kann.
Zwei Ausstellungen in Wien, zweimal junge Architektur, einmal aus Japan, einmal aus Österreich: von Papier, Kartonröhren, Wohnraum auf Autoabstellplätzen - und was einem hierzulande mitunter japanisch vorkommen kann.
Fünfundvierzig unter 45": Im Ausstellungszentrum im Wiener Ringturm werden derzeit 45 junge japanische Architekten und Architektenteams vorgestellt, deren Werdegang Vielversprechendes erkennen läßt. Darunter auch einige etablierte Größen - wie Kazuyo Sejima, ehemalige Mitarbeiterin bei Toyo Ito und bekannt durch ihre überaus feine Glasarchitektur, oder Shigeru Ban, der seine Lehrjahre bei Arata Isozaki absolviert hat und dessen innovative Konstruktionen aus Papier international renommiert sind.
Der Gesamteindruck der Schau spiegelt durch die Mannigfaltigkeit ihrer Projekte in vielerlei Hinsicht japanische Werte und Gegebenheiten wider: Tradition, Materialverbundenheit, Vergänglichkeit und Ästhetik stehen im Kontext zur gegenwärtigen urbanen Situation.
Traditionelle Bau- und Lebensweisen sind am besten bei Masatoshi Yashimas Kindergarten spürbar: „Fantasia 1, 2 und 3“ sind einfache, auf die Aktivitäten und den Maßstab der Kinder angepaßte Holzgebäude mit weit auskragenden Dächern, niedrig situierten Fenstern und großzügig offenen Holzterrassen. Das Leben und Schlafen spielt sich nach herkömmlichem Brauch auf dem Boden ab.
Die japanische Tradition des Papiers ist an mehreren Projekten in unterschiedlicher Weise zu finden. Shigeru Ban etwa setzt Papier konstruktiv in Form von Kartonröhren in seinen Bauwerken ein. Der japanische Pavillon für die Expo Hannover 2000, die „Paper Gallery“ für Issey Miyake in Tokio und die „Paper Church“ in Kobe zählen dazu. Der Umstand, daß in Ballungsgebieten wie Tokio und Umgebung Grundstückspreise oft über den Baukosten liegen, und das Bewußtsein für die in der Geschichte immer wiederkehrenden, alles zerstörenden Erdbeben sind neben der buddhistischen Philosophie Gründe für die temporäre asiatische Architekturauffassung im Gegensatz zur europäischen. Daher gibt es auch keine Tradition der Restaurierung.
Formal herausragend sind nicht nur Kazuyo Sejimas Entwürfe, sondern auch die graphische Darstellung ihrer Grundrisse und die Komposition ihrer Projektphotos, die per se schon als Kunstobjekte betrachtet werden können. Der Stellenwert, den das Photo hier im Vergleich zum realen Projekt und im täglichen Leben gegenüber tatsächlichen Situationen einnimmt, ist in Japan generell auffällig hoch.
Fast kindlich wiederum mutet die 1997 von Satoshi Okada für einen Videokünstler geplante Villa „man-bow“ an, die aus zwei voneinander unabhängigen Baukörpern, einem ellipsoidischen und einem quaderförmigen, besteht. Wie ein soeben gelandetes Ufo aus einem Comicstrip ragen die schwarze Schachtel und das mit bräunlich schimmernden Kupferplatten überzogene Ei auf je sechs dünnen weißen Stützen aus den Baumwipfeln des steilen Grundstücks in seiner dörflicher Umgebung südlich von Tokio.
Unter den 13 nicht ausgeführten Projekten finden sich einige experimentelle Ansätze, die aus der gegebenen Stadtsituation resultieren. Kenichi Inamura, ein Mitarbeiter der Shimizu Corporation, präsentiert ein virtuelles Büro der Zukunft, den „Tunable Club“. Dreidimensionale Diagramme von Abläufen der „workspaces“, „workstyles“ und „collaboration units“ beschreiben hier eigentlich Zustände, die in einer Stadt wie Tokio bereits zu finden sind. Analysen komplexer Funktionsabläufe sind im Prinzip nichts anderes als Versuche, den vorhandenen Organismus „Metropole“ aus Verkehr, Menschen, Aktivitäten, Gebäuden, Bildwänden, Reklameschildern, Zügen und Lautsprechern abzubilden, den permanenten Informationsfluß und Datenaustausch rationell zu fassen und daraus Architektur zu generieren.
Visionäre Projekte sind immer mit kollektiver Rationalisierung unter Zusammenfassung gemeinschaftlicher Aktivitäten verbunden. Sei es durch parasitäre Formen, die sich der bestehenden Struktur mit der Zielsetzung, diese zu verbessern, unterordnen oder durch radikale Satellitenstädte.
„Polyphonic City“ ist hier ein Beispiel der radikalen Variante: Die für New York visionierte vertikale „Stadt in der Stadt“ besteht aus einem Konglomerat von miteinander vernetzten Hochhäusern, das durch inhärente städtische Funktionen autark sein kann.
Im Gegensatz dazu stehen zwei hier gezeigte, individuelle Projekte, die sich am Ist-Zustand orientieren und sofortige Lösungen für stadträumliche Problemzonen anbieten. Rikuo Nishimori etwa hatte die raffinierte Idee, containerartige Boxen in die als Autoabstellflächen vorgesehenen, zurückgesetzten Erdgeschoßflächen einzuschieben. Die Container sind als einfache Rahmen konstruiert und wahrscheinlich auf diese Weise auch nur in Japan möglich, wo man bauphysikalischen Fragen weniger Bedeutung beimißt.
Ein Stadtbild, das alle jene Freiräume unter den ersten Geschoßen auf diese Weise füllt, ist durchaus vorstellbar, allerdings wohl nur unter der Voraussetzung, daß die Bewohner auf ihr Auto zugunsten des neugewonnenen Raums verzichten. Kisho Kurokawa, der bereits 1970 den legendären Nakagin Kapselturm, ein austausch- und additierbares System von Minimal-Raumzellen um einen Versorgungsschacht, in Tokio realisierte, meint, daß in 200 Jahren die Stadt nur noch aus derartigen Bauwerken besteht. Vielleicht auch schon früher.
Die Architektengruppe Mikan andererseits beschäftigt sich mit einer für flexible städtische Anwendungen hervorragend geeigneten Problemlösung, und zwar mit transportfähiger Architektur. Das Projekt KH-2 ist ein mobiles Café, das auf einem Modulsystem aus zylindrischen Elementen und abnehmbaren Verbindungsteilen besteht, die in beliebiger Anzahl zu einer sowohl komplett offenen als auch geschlossenen Gesamtform kombiniert werden können.
Gleichzeitig mit „45 unter 45“ ist der dritte Teil von Otto Kapfingers „emerging“-Reihe im Architekturzentrum Wien zu sehen, die ganz im Zeichen der jungen heimischen Architekturszene steht. Trotz des grundverschiedenen kulturellen Ursprungs, der unterschiedlichen Größe der Länder und Anzahl der Menschen, der daraus resultierenden Probleme und daher divergierenden urbanen Situation sind in der Architektur zahlreiche Parallelen auf gestalterischer Ebene zu bemerken. Viele Formen der traditionellen japanischen Bauweise finden sich auch in der neuen österreichischen Architektursprache: geradlinige und reduzierte Formen, Bezüge zwischen Innen- und Außenraum, flexible Raumnutzung, Schiebeelemente als raumhohe Türen und Fenster.
Die Zwischenraumzone „Engawa“ etwa, eine dem Wohnbereich mit beidseitigen Schiebewänden vorgelagerte Art von Veranda, ist in neuinterprätierter Ausformung sowohl in der zeitgenössischen japanischen als auch in der zeitgenössischen österreichischen Architektur oftmals präsent.
Das 1997 fertiggestellte „Haus C.“ in Graz der Architekten Feyferlik/Fritzer gibt dafür ein gutes Beispiel: aufschiebbare Glaselemente öffnen sich Richtung Garten und gewähren auch der Badewanne direkten Bezug zum Außenraum. Das Gesamtbild des Hauses und seine Positionierung in die Landschaft erinnern an japanische Konzepte.
Daigo Ishiis „Landhaus C“ wurde für die schneereichste Region Japans geplant. Verbüffend ähnlich wirken die um 2000 geplante Reihenhausanlage und Wohnbox der Architektengruppe Holz Box Tirol. Hier sind klimatische Parallelen und die formal reduzierte Anwendung des Werkstoffes Holz wohl für die formale Assoziation ausschlaggebend. Die räumlich raffiniert ausgeklügelte „Minibox“ gleichnamiger Tiroler Architekten thront auf einem Innsbrucker Dach und wäre in dieser Form durchaus in Japan vorstellbar.
Auch das Projekt „turnOn“ der Architektengruppe AllesWirdGut ist nicht frei von Anmutungen ans japanische Formenrepertoire. Das an ein Hamsterrad erinnernde Objekt enthält sämtliche Möbel aus einem Guß, die durch das Weitergehen innerhalb des Rads benützbar werden. „turnOn“ wäre eine Antwort auf die vorgefertigten japanischen Plastikboxen als Badezimmer und Konsequenz der extrem beengten Wohnverhältnisse. Es hätte zum Beispiel im „Mini Haus“ von Yoshiharu Tsukamoto und Momoyo Kajima Platz, dessen Breite sich auf die Länge des davor geparkten Autos „Mini“ beschränkt!
[ Die Ausstellung „45 unter 45 - Junge Architektur aus Japan“ ist noch bis 31. Jänner im Ausstellungszentrum im Ringturm (Wien I, Schottenring 30) Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr zu sehen, „emerging architecture 3“ noch bis 10. März im Architekturzentrum Wien (Wien VII, Museumsplatz 1) täglich 10 bis 19 Uhr. ]
verknüpfte AkteureShigeru Ban Architects
![]()