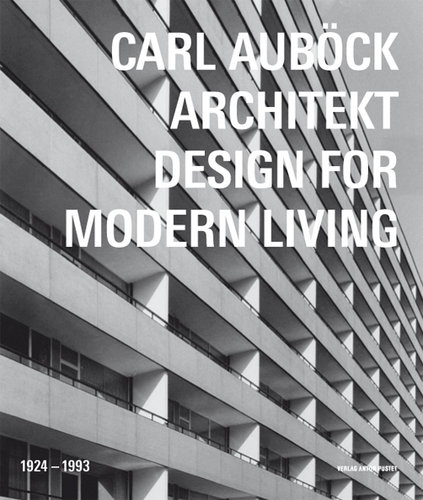sonntags im bauhaus
Auf ein „Bauhaus-Intensivseminar“ begab sich sonntags im diesjährigen September anlässlich des Jubiläums 90 Jahre Bauhaus. Einstieg in das vielfältige...
Auf ein „Bauhaus-Intensivseminar“ begab sich sonntags im diesjährigen September anlässlich des Jubiläums 90 Jahre Bauhaus. Einstieg in das vielfältige...
Auf ein „Bauhaus-Intensivseminar“ begab sich sonntags im diesjährigen September anlässlich des Jubiläums 90 Jahre Bauhaus. Einstieg in das vielfältige Spektrum rund um die Schule des Bauhauses verschaffte die Ausstellung „Modell Bauhaus“ im Martin-Gropius Bau in Berlin. Der als Präsentationsort für die Bauhausthematik etwas überraschend anmutende Ort eines klassizistischen Museumsgebäudes wurde vom Großonkel des Bauhaus-Protagonisten Walter Gropius gebaut, vom Neffen selbst einst vor dem Abbruch bewahrt und nun würdig geehrt. In chronologischem Aufbau erzählte die umfangreiche Schau die Geschichte und Wirkung des Bauhauses an seinen drei Schauplätzen Weimar, Dessau und Berlin, die auch unsere Reiseziele waren.
Das Bauhaus – eine Religion, eine Lebensphilosophie, ein gestalterisches Dogma, das Generationen von Architekten bis heute maßgebend beeinflusst. Der Gedanke eines Gesamtkunstwerkes, das sich neben dem Kunstschaffen auf alle Lebensbereiche bezieht, wird von den Bauhaus-Meistern gelebt und doziert. Wie man wohnt, mit welchen Gegenständen man sich im Alltag umgibt, wie man sich kleidet und was man isst, ist der Bedeutung des täglichen Skizzierens, Entwerfens, der Beschäftigung mit Kunst und Literatur gleichgestellt. Gemeinsames Ziel ist die Produktion von leistbarer Qualität und intelligentem Alltagsdesign. Grundfarben, Grundformen sind dabei die Vorgaben, innovative und praktikable Lösungen in allen Bereichen angestrebt, wie etwa auch die Kleinschreibung, die die Bauhaus- Meister 1925 eingeführt haben.
Albert Speer jun. beschreibt in der Sonderausgabe „90 Jahre Bauhaus“ der Berliner Morgenpost die „Marke Bauhaus“ als „deutsches Qualitätsprodukt“ und „Exportschlager“. Nicht zu Unrecht wird die erfreuliche Seite der so dunklen Epoche in Deutschlands Zeitgeschichte vehement hervorgehoben und das Jubiläum der in der internationalen Architektenschaft so hochgeschätzten Strömung groß gefeiert.
Am 1. April 1919 wurde das Bauhaus unter dem offiziellen Titel „Staatliches Bauhaus in Weimar – Vereinigte ehemalige Großherzogliche Hochschule für bildende Kunst und ehemalige Großherzogliche Kunstgewerbeschule“ von Walter Gropius gegründet.
1925 zog das gesamte Bauhaus – nun als städtische Einrichtung – nach Dessau. Vierzehn Jahre bestand die richtungsweisende Schule, bis sie 1933 auf Beschluss des Lehrkollegiums aufgelöst wurde. Die Bedingungen der Gestapo und allgemeine wirtschaftliche Schwierigkeiten seit dem Börsenkrach 1929 in New York erwiesen sich als untragbar, insbesondere infolge vorangegangener Übergriffe von Seiten der NSDAP, die 1931 nach den Gemeinderatswahlen in Dessau zur stärksten Partei geworden war. Verhaftungen von Studenten, Hausdurchsuchungen durch die Gestapo, Streichungen der Zuwendungen für das Bauhaus bis zur Schließung der Dessauer Räumlichkeiten und Übersiedlung nach Berlin 1932, wo die Institution Bauhaus als „Freies Lehr- und Forschungsinstitut“ in einer ehemaligen Telefonfabrik ihr letztes Jahr verbracht hat.
WEIMAR: Überwältigend geschichtsträchtiges Pflaster beflügelt und bedrückt gleichermaßen. Ein Ort, der Persönlichkeiten wie Goethe beherbergte, seine Aura und Literatur bis heute weiterleben lässt, der Geburtsort des Bauhauses und die bis heute bestehende, international renommierte Bauhaus Universität trägt die Bürde einer stets mitschwingenden Erinnerung an die gerade in der Hochblüte der Bauhaus- Bewegung aufkommende Nazipartei mit ihren Auswüchsen. Goethes Farbenlehre bereitete eine essentielle Grundlage für die Thematik „Farbe“ als einen der Schwerpunkte in der Bauhaus-Lehre mit Johannes Itten als Meister der Farbkunst.
Goethes Gartenhäuschen befindet sich in unmittelbarer Nähe des „Haus Am Horn“, das 1923 als Musterhaus, den Prinzipien der Bauhaus- Lehre folgend, unter der Leitung von Georg Muche und mit Hilfe aller Bauhaus- Werkstätten errichtet wurde. Der Prototyp eines Atriumhauses, in dem das zentrale und durch ein Oberlichtband belichtete Wohnzimmer von allen anderen Räumen umschlossen wird, sollte in Serienproduktion gehen, die jedoch bis heute niemals realisiert wurde. Im gleichen Jahr wurde auch das legendäre Direktorenzimmer an der Bauhaus Universität Weimar von Walter Gropius eingerichtet. Die kubische Raumkomposition, die orthogonale Formgebung und Farbzusammenstellung der Möbel sowie Lampen und Textilien haben ihren avantgardistischen Anspruch bis heute erhalten.
DESSAU: Die Person Walter Gropius wird beim Besuch aller Bauhaus-Einrichtungen in Dessau greifbar. Unter der strengen Leitung des Lehrers, Meisters und Bauhaus-Vaters arbeitete eine Generation von Studenten nach Gropius’ Motto der Einheit von Kunst und Technik und des Zusammenspiels von Kunstschaffenden und industrieller Produktion. Herausragende Persönlichkeiten wie Carl Fieger, Adolf Meyer, Ernst Neufert, Johannes Itten, Lyonel Feininger, Marcel Breuer, Josef Albers, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Herbert Bayer, Hinnerk Scheper, Georg Muche, Hannes Meyer, László Moholy-Nagy, Paul Klee und Lothar Schreyer reihten sich unter die Lehrenden. Dabei ist zu bemerken, dass Gunta Stölzl als einzige Frau unter den Bauhaus-Meistern für die Webereiklasse, in die alle weiblichen Studentinnen abgeschoben wurden, verantwortlich war. Trotz Assoziation der Frauenschaft mit dem Werkstoff Textil und deren Ausgrenzung in allen anderen Meisterklassen machte Gunta Stölzl aus der Textilklasse eine professionelle Industriedesignwerkstätte. Sie experimentierte mit neuen Materialien abseits traditioneller Webtechniken. Der berühmte Eisengarnstoff etwa, mit dem die frühen Stahlrohrmöbel des Bauhauses bespannt wurden, ist eine Erfindung der Bauhaus-Weberei, die überdies die einzige wirtschaftlich lukrative Abteilung des Bauhauses darstellte! 1926 ließ Walter Gropius die Meisterhäuser in Dessau errichten. Sein eigenes Direktorenhaus, gefolgt von den drei Doppelhäusern – Moholy-Nagy/Feininger, Muche/Schlemmer und Kandinsky/Klee – für seine Bauhaus-Meister. Unter strikten Vorgaben, die auch die Privatbereiche der Meister betrafen, brachte Gropius seine eigene Persönlichkeit in die Entwürfe und Ausführungen ein. So wurde unter anderem Georg Muche ein schwarz glänzend ausgemaltes Schlafzimmer aufoktroyiert, das er angeblich niemals benutzt, aber auch nicht verändert hat.
Erst 1927 wurde die Architekturklasse im Bauhaus etabliert, bislang wurden alle Bauprojekte von Walter Gropius’ privatem Baubüro abgewickelt.
Bis auf das zerstörte Direktorenhaus sind alle Bauhaus-Einrichtungen in Dessau zu besichtigen und der Studentenwohntrakt auch bewohnbar. Eine wirkliche Empfehlung für alle Architektur-, Design und Kunstschaffenden, die in das Ambiente des Bauhauses eintauchen und sich inspirieren lassen möchten.
Hintergrund, Mi., 2009.11.25
verknüpfte Zeitschriften
Hintergrund 44