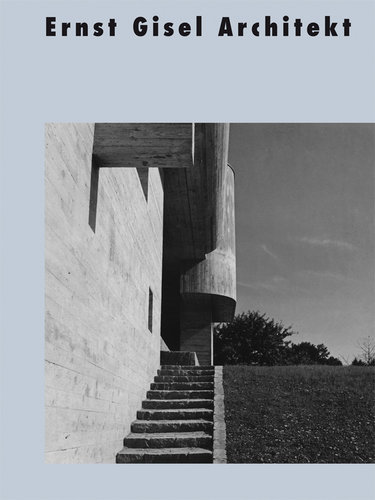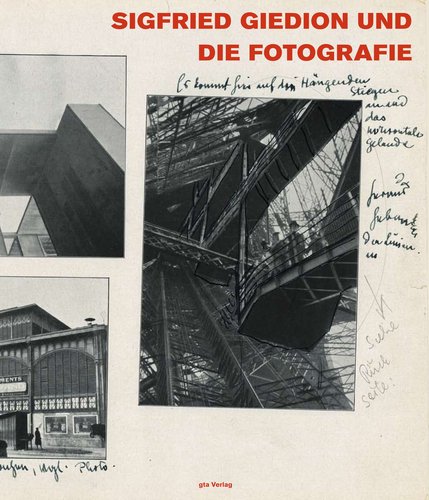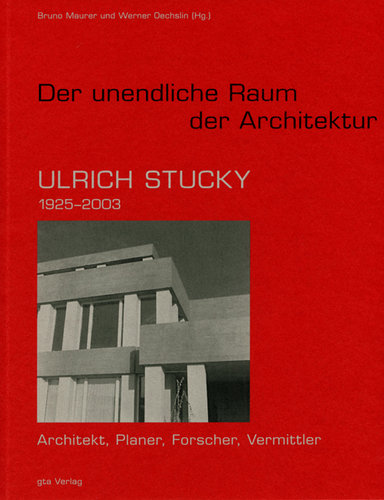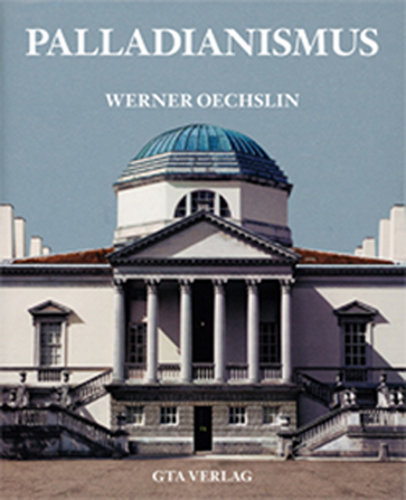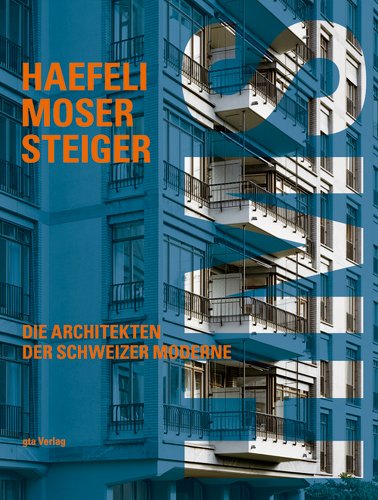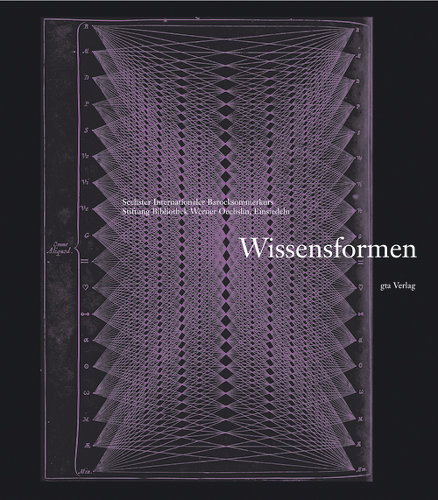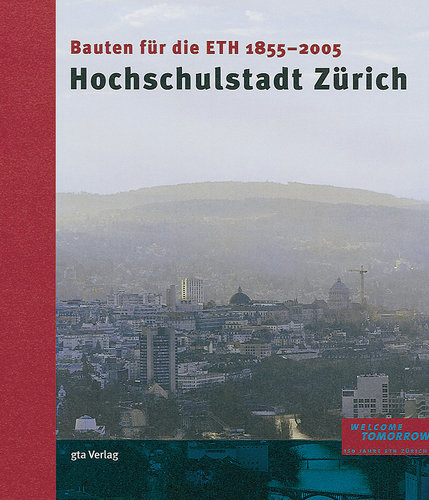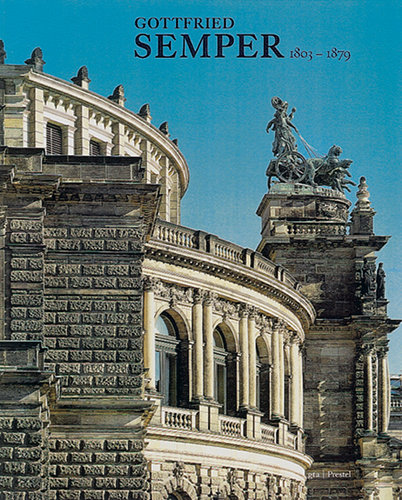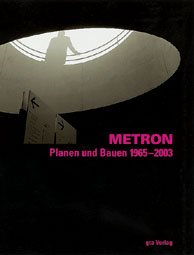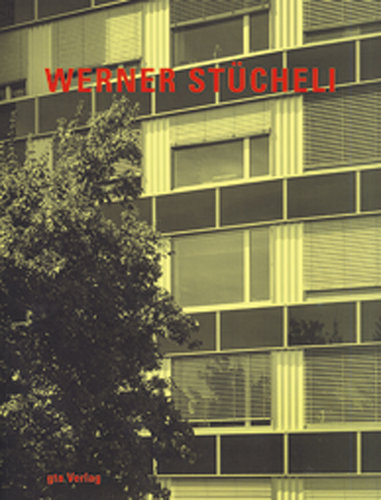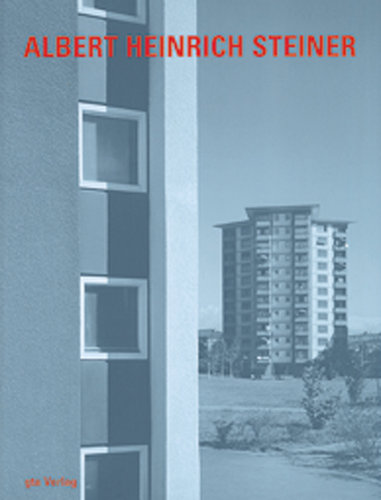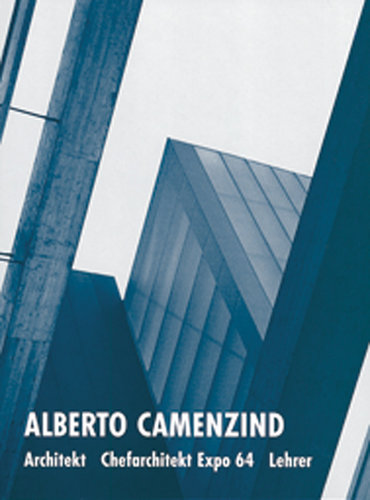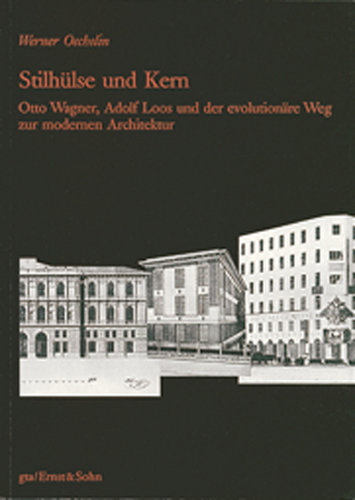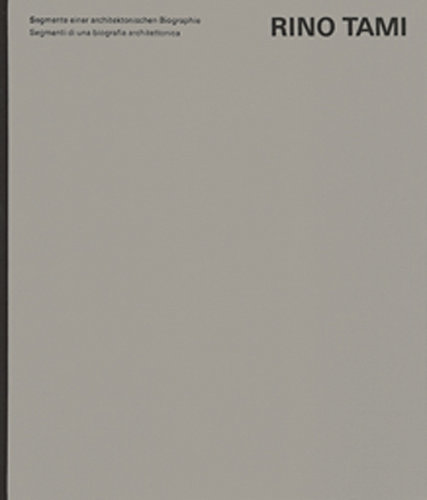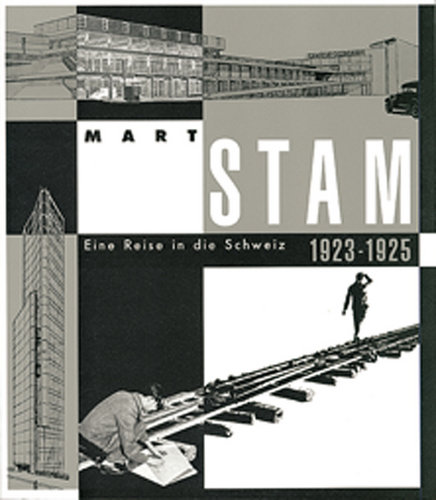Wie beurteilt man eine herausragende künstlerische Leistung? Woher bezieht man die Kriterien der Beurteilung - gerade dann, wenn es sich anerkanntermassen um einen ausserordentlichen Fall handelt? Nach verlässlichen Selbstdarstellungen oder nach einer die Praxis adäquat abbildenden Theorie sucht man meist vergebens. Die «histoire des opinions» ist zwar von der Encyclopédie als «recueil des erreurs humaines» entlarvt worden. Gleichwohl ist man auf die Rezeptionsgeschichte angewiesen. Trotz viel Ausgefallenem dokumentiert diese die Bedeutung des Gegenstandes oft genauer als manch solide nachgereichte Analyse. So auch im Falle des aus Bissone stammenden Borromini (1599-1667), dessen 400. Geburtstag am 27. September gefeiert wird.
Wie beurteilt man eine herausragende künstlerische Leistung? Woher bezieht man die Kriterien der Beurteilung - gerade dann, wenn es sich anerkanntermassen um einen ausserordentlichen Fall handelt? Nach verlässlichen Selbstdarstellungen oder nach einer die Praxis adäquat abbildenden Theorie sucht man meist vergebens. Die «histoire des opinions» ist zwar von der Encyclopédie als «recueil des erreurs humaines» entlarvt worden. Gleichwohl ist man auf die Rezeptionsgeschichte angewiesen. Trotz viel Ausgefallenem dokumentiert diese die Bedeutung des Gegenstandes oft genauer als manch solide nachgereichte Analyse. So auch im Falle des aus Bissone stammenden Borromini (1599-1667), dessen 400. Geburtstag am 27. September gefeiert wird.
Anton Francesco Doni überrascht den Leser seiner «Seconda Libreria» (1555) mit dem Hinweis auf einen schriftlichen Nachlass Bramantes, der aus einem Traktat zu den Säulenordnungen und einer - auch als «trattato del lavoro tedesco» umschriebenen - «Pratica di Bramante» bestehe. Das hat zu Irritationen geführt. Für Doni selbst ist allerdings weniger die Existenz solcher Dokumente als der grundsätzliche Anspruch entscheidend, die herausragenden Künstler möchten doch im Hinblick auf eine allgemeine Verbesserung der Künste ihr Tun mit Schriften begleiten.
DIE RICHTIGE SICHT DER DINGE
Was für Bramante zutrifft, gilt auch für Borromini. Man kann sie, die Grossen der Kunst, nicht so einfach in die Pflicht nehmen. Nun ist gerade seit Joseph Connors' jüngsten Forschungen im Falle Borrominis dokumentiert, wie sehr dieser sich angestrengt hat, die richtige Sicht der Dinge festzulegen. Sein «Opus» ist allerdings erst lange nach seinem Tode erschienen, seine «Lieblingskinder», die Zeichnungen, hat er vor seinem Tode verbrannt und so der Nachwelt - eifersüchtig - entzogen. Es gibt sie also nicht, jene «Pratica di Borromini», die man sich in seinem Falle genauso gewünscht hätte und die man - wie bei Bramante - als «un trattato del lavoro tedesco» hätte untertiteln können. Gerade dies, wie Borromini seine Architektur konzipiert, entworfen und umgesetzt hat, ist heute einmal mehr Kernfrage der Forschung - und keineswegs so entschieden, wie man das gemäss Donis Unterstellung einem Traktat hätte entnehmen können. Glücklicherweise hat sich trotz Borrominis Zerstörungswerk einer der grössten Zeichnungsnachlässe erhalten. Und hier hat die jüngere Borromini-Forschung, insbesondere seit Heinrich Thelens mustergültigem erstem Band der «Handzeichnungen Francesco Borrominis» (1967), auch neu angesetzt.
Johann Caspar Füesslin unterstellt 1774 dem jungen Borromini, er sei «mit dem ernstlichen Vorsatz und der innern Überzeugung» nach Rom gereist, «einer der grössten Männer seines Zeitalters zu werden». Folgt man dieser Spur, wird man verstehen, weshalb schon die frühen Biographien meist eher Psychogramme als kommentierte Werklisten Borrominis festgeschrieben haben. Eine solche Sichtweise, die auch die Kleidung des Künstlers mit ins Visier nimmt, hat sich schon lange vor Adolf Loos festgesetzt. Entsprechend diente Borrominis konsequent getragenes «Spanisch-Schwarz» auch nur dazu, die Besonderheit und Abweichung seines Charakters glaubhaft zu illustrieren. Passeri meint, Borromini habe auf diese Weise als «besonders» auffallen wollen.
Borromini verstösst gegen die Konvention. Das Charakterbild stimmt auf Schlimmeres ein. Schlechter Charakter, schlechte Architektur, heisst die Gleichung. Am Höhepunkt klassizistischer Ästhetik wird Milizia diese Betrachtungsweise auf die Spitze treiben, wenn er die Losung ausgibt, Borrominis Werke seien Verrücktheiten, «frenesie». Selbst verrückt geworden, habe sich Borromini schliesslich umgebracht. Und jene architektonische Verrücktheit sei ansteckend. Ein Krankheitsbild, die pathologische Sicht der Dinge, hat die architektonische Beschreibung der Werke Borrominis schon 1787 und nicht erst 1930 überlagert, als Hans Sedlmayr Borrominis Weltbild mit Hilfe der Kretschmerschen Temperamentenlehre als «schizotym» bezeichnet hat.
NOTORISCHE EIFERSUCHT
Für jene frühe psychologisierende Panegyrik der Künstlerviten bot sich die Konkurrenz Borromini - Bernini als ideale Folie an. Diese war geschichtlich solide abgestützt, nachdem Bernini die Nachfolge Madernos als Leiter der Fabrica di San Pietro, des höchsten Architektenamtes, angetreten hatte. Borromini, der die Arbeit leistet und die guten Ideen entwickelt, und Bernini, der nach aussen als Realisator auftritt, das ist der Stoff eines echten Psychodramas. Doch so romantisch wird dies kaum je gesehen. Bei Baldinucci (1728) erscheint Borromini formal vielleicht korrekt, aber doch reichlich tendenziös als «Discepolo del Cav. Bernino». Angelo Comolli (1788) nimmt das dann zum Anlass, um von Borromini als einem kaum würdigen Schüler eines so berühmten Lehrers zu sprechen. So werden Bruchstücke einer Biographie und Anekdoten zu einer kunstgeschichtlichen Topik verfestigt. Unter dem Druck knapper Fassung schreibt etwa Roland le Virloys 1770: «Il fut jaloux de la réputation du Bernin, jusqu'au désespoir.»
Andere versuchen sich herauszuhalten. Lione Pascoli (1730) meint, die notorische «gelosia» Borrominis wäre nicht halb so schlimm, wenn daraus nicht auch noch Hass, Missgunst, Feindschaft, Streit und Blutvergiessen entstanden wären. So lasse sich der Konflikt zwischen Borromini und Bernini eben kaum verschweigen. Schlimmer: dieser habe sich auch auf alle anderen, so insbesondere auf die «animi degl'intendenti» übertragen. So müsste man zumindest darauf vertrauen können, dass sich Sympathie und Antipathie eben auch genauer, in architektur- und kunstspezifischen Begriffen niederschlügen. Bellori hat diesbezüglich in einer berühmt gewordenen Postille zu Baglione über San Carlino den Anfang gemacht: «brutta e deforme, gotico ignorantissimo e corruttore dell'architettura, infamia del nostro secolo».
Da ist alles enthalten, was die klassizistische Kritik hundert Jahre später genüsslich ausbreiten wird. Pascoli vereinigt statt dessen schon früh die doppelte - positive wie negative - Sichtweise; Genialität («era portato dal genio») steht auf der einen, der Regelverstoss auf der andern Seite. Letzteres wird auf die Innovationssucht - und öfters auch auf das Dekorative bezogen. Passeri empfiehlt, man möge Borromini jene «kapriziösen», aber doch stets genialen («ingegnose») Irregularitäten nachsehen. Er sei ein «architetto spiritoso» und seine «intelligenza» sei schon seit Anbeginn in der Bauhütte von St. Peter offenkundig geworden. Allein, die umgekehrte Sicht der Dinge setzt sich durch: zwar habe Borromini über ausserordentliche Talente verfügt, doch diese seien fehlgeleitet worden. Resultat: Borromini sei «uno de'principali corruttori dell'arte» geworden, was dann später zur Definition eines «Style-Italique dégénéré» oder «Style-Italique corrompu» (so der Chevalier de Wiebeking) führte.
Man schreibt schon längst Kunstgeschichte. Und natürlich nimmt die klassizistische Kritik bald einmal überhand. Man übersieht dabei, was für ein grundsätzlicher Wechsel in der Beurteilung von der offen formulierten Einsicht in die Notwendigkeit «einiger weniger universaler Regeln» durch Palladio (1570) zur schulmeisterlich ausgelegten Liste architektonischer Verfehlungen durch Milizia eingetreten ist, so wie man später kaum bemerkt hat, dass jene Umwertung des - vorerst negativ bestimmten - Barockbegriffs ins Positive noch lange nicht den Blick aufs Ganze zurückgebracht hat. Die Reduktion der borrominischen Architektur auf das nunmehr akzeptierte Kurvenspiel - «quel suo modo ondulato ed a zic zac» (Milizia) - bleibt formalistisch-klassisch und wird Borrominis Architekturauffassung nicht gerecht.
Andererseits sind differenziertere Positionen bis heute teilweise völlig vergessen. Bottari geht 1754 von der in seiner Zeit vermissten Synthese von Theorie und Praxis, von Kenntnis und Erfahrung aus, um dann am Beispiel der Deckenkonstruktion über dem Oratorio Borrominis Befähigung zu virtuoser Problemlösung herauszustellen. Deshalb figuriert er als «uno de'più ingegnosi talenti». Seine Exzellenz ist dort angesiedelt, wo weitab von den ästhetischen Kategorien architektonisches Können, Problembewältigung gefordert sind. Der Antiquar aus Pesaro, Giambattista Passeri, hat 1772 aus denselben Gründen das Urteil des «gran pensatore Borromino» gefällt.
Gleichzeitig hatte sich aber längst jene klassizistische, ästhetisierende Sichtweise durchgesetzt, die von Alessandro Pompei und dessen Verdikt gegen die «cieca pratica», die blinde Praxis der römischen Architektur, ausging. Dieser hatte sich schon früh nach England ausgerichtet und im Palladio-Apologeten Lord Burlington sein Ideal erkannt. Und so verurteilt Pompei jetzt unmissverständlich jeglichen Drang nach Schaffung neuer Formen. Das hat bei Milizia zu einer eigenwilligen Beurteilung der Leistungen Borrominis geführt. Er verleiht ihm gute Noten für jene Zeit, in der er sich noch aufs Kopieren beschränkte, während mit dem Beginn seiner Eigenständigkeit - und dem Exzess an «novità» - Borromini der Häresie und der «malinconia» verfallen sei.
Doch selbst bei Milizia finden sich Spuren der anderweitigen Betrachtungsweisen eines Bottari. Auch er kann die Qualitäten der Bauten Borrominis nicht einfach totschweigen. «E' però mirabil», entfährt es ihm, wenn er auf das kunstvoll eingezogene flache Gewölbe im Oratorio zu sprechen kommt. Und so lässt selbst er sich bezüglich der Vorzüge der Architektur Borrominis «un certo non so che di grande, di armonioso, di scelto che fa conoscere il suo sublime talento» entlocken. Unversehens begibt sich Milizia aufs Terrain des Erhabenen. Doch ist er schnell wieder bei seinen rational-stringenten Beurteilungen angelangt. Wenn Borromini wegen seiner hohen geistigen Gaben zu den Ersten seines Jahrhunderts zu zählen sei, dann eben auch zu den Letzten wegen des «lächerlichen Gebrauchs», den er davon gemacht habe. Borrominis Qualitäten bezüglich «firmitas» und «utilitas» nützen ihm, der bezüglich Schönheit ein «matto» ist, gar nichts: «chi lo condanna in questa lo condanna anco in quelle», lautet die erstaunliche Logik. Deutlicher kann man den Primat des Ästhetischen kaum herausstellen.
Auf dieser - glatten - Oberfläche lässt sich so ziemlich alles aussagen. San Carlino, für Milizia das «delirio maggiore del Borromino», ist für Comolli ein «gabinetto di una galante Madama», was parallel zu den profanisierten Interpretationen von Berninis Verzückung - oder eben den orgasmusähnlichen Konvulsionen - der heiligen Theresa zu lesen ist. Die stereotype Sicht der Dinge hebt sich je länger, je stärker vom Gegenstand ab. Cancellieri sammelt in seiner Fussnote zu Borromini alles, was an Anekdoten zu finden ist, so Berninis gegen Borrominis Fassade der Propaganda Fidei gerichtete priapische Stuckformen und Borrominis Antwort in Form von Eselsohren gleichen Materials. Uggeri liefert dann das griffige und scheinbar so unverfängliche Bild der massstabsgleichen Grundrisse von San Carlino und eines Vierungspfeilers von St. Peter: San Carlino als Barockjuwel! In den Romführern des 19. Jahrhunderts gerät dies zum Stereotyp: «is worth observing from the fact that the whole building corresponds with one of the four piers supporting the cupola of St. Peter's». Mehr findet man in Augustus J. C. Harpes «Walks in Rome», einem Standardwerk für britische Touristen, nicht - nicht einmal Borrominis Namen.
CARTESIANISCHE WELTAUFFASSUNG
«A curious work of Borromini» - zum Turm von Sant'Andrea delle Fratte im weitverbreiteten Romführer von Vasi und Nibby - sagt auch viel weniger aus als frühere Bezeichnungen wie «con ingegnoso, e vago disegno del Borromini». Das kann nicht erstaunen, zumal auch die Forschung kaum danach fragte, was zu Zeiten Borrominis Emanuele Tesauro in seinem «Cannocchiale Aristotelico» unter «ingegno» und «argutezza» im spezifisch architektonischen Sinn verstand: Erfindungsgabe, aber auch Ingeniosität! Worauf dann Tesauro prompt an die Bezeichnung «Ingegnere» für den Architekten erinnert. Auch Ermenegildo Pini geht es 1770 um ein tieferes Verständnis des «ingegno umano». Und so interessiert er sich - ähnlich wie Bottari - für das, was er als innere Kohärenz begreift, selbst wenn sich dies in Anbetracht ästhetischer Wertsetzungen als «combinazione d'errori» erweisen sollte. Auf diesem Weg gelangt Pini zur provokativen Äusserung, Borrominis architektonisches Verdienst müsste doch zumindest demjenigen gleichgesetzt werden, das ohne Zweifel Descartes zukäme. Das führte in den «Effemeridi Letterarie» in Rom zu einem Aufschrei der Entrüstung: «Dio volesse . . .»! Wo käme man hin, wenn man von den Delirien Borrominis auf Descartes schliessen würde.
Sedlmayr ist also auch hier nicht der erste, wenn er für Borromini eine «cartesianische Weltauffassung» reklamiert. Die Rede ist auch hier von System und von Elementen, die zu Kombinationen und Konstellationen führen, was dann Sedlmayr den Vergleich noch enger zur Chemie eines Lavoisier ziehen lässt. Der Hinweis auf die Zugehörigkeit Borrominis und Descartes' zu derselben Generation konnte in der Zeit von Pinders Kunstgeschichte nach Generationen (1926) kaum fehlen. Erstaunlicher ist allerdings, dass Sedlmayr mit seinem Ansatz massiv gegen den im Trend liegenden modernen Einheitsbegriff anging, den die Stilgeschichte - Hubala nannte es eine «stilgeschichtliche Fundamentalkonstruktion» - genauso verkörperte wie die damals der Ideologie der «einheitlichen Erscheinungsform» aufsitzende Architektur. Als dann Sedlmayr das Cartesianische Weltbild mit Bezug auf Kretschmer auch noch als typisch schizothyme Weltauffassung freilegte, musste der letzte gestandene Kunstwissenschafter sich empört abwenden.
Gurlitts für die Ehrenrettung barocker Kunst hochangesehene «Geschichte des Barockstils in Italien» (1887) lässt auch nur Unbeholfenheit im Umgang mit dem komplexen Phänomen Borromini erkennen. San Carlino wird jetzt wegen der «ächt barocken Grösse ihrer Verhältnisse» gerühmt. Gurlitt lässt das Bild eines antiklassischen, zu neuen Horizonten aufbrechenden Künstlers entstehen. Plötzlich ist da die Rede vom «bewussten Bruch mit der Antike und den Gesetzen Vignolas». Nicht mehr der Regelverstoss ist das Thema, sondern modernes Kunstwollen. Borromini, ein Mann von «selbstbewusster Kraft» und «kühner Tat», habe gemerkt, «in welche Wüsteneien die schematische Befolgung der Buchlehren der grossen Renaissancetheoretiker führten». Lange hält Gurlitt diesen Ton nicht durch. Er verfällt alsbald in die üblichen Topoi der klassizistischen Borromini-Kritik. Der Turm von Sant'Andrea delle Fratte ist zwar «eines der keckesten Geniestücke», allein die Fassade von San Carlino erscheint auch ihm als «ein reines Dekorationsstück». Schliesslich folgt Gurlitt Milizia und den Deutungen des Suizids: «Diese traurige Tatsache erklärt manches.» «Nirgends innere Würde, Übereinstimmung zwischen Mass und Absicht.» Auch er sieht das «Krankhafte» Borrominis, was er dann am Ende mit seinem zuerst geäusserten Enthusiasmus auf höchst zeitgemässe Weise zusammenführt: «Er war ein Riese im Wollen.»
NERV DES BAROCK
Eine solch spontan-zufällige Vermengung überkommener Vorurteile mit neuformulierten Ansprüchen an künstlerische Kreativität wollte Heinrich Wölfflin sicherlich vermeiden. Seine Absicht in «Renaissance und Barock» (1888) war es ja, in den «Symptomen des Verfalls», in «Verwilderung und Willkür» «womöglich das Gesetz zu erkennen». Doch auch bei ihm ist das Psychologisieren sehr schnell zur Hand. Er nimmt sich das «Gesetz der Abstumpfung» - «das erschlaffte Formgefühl verlangt nach einer Verstärkung des Eindrucks» - zwecks Erklärung barocker Expressivität vor. Da hatte er doch in den «Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur» (1886) den Abschied vom Psychologisieren genommen und sich den «allgemeinen Formgesetzen» zugewandt. Aus den bekannten Wesensdefinitionen der Architektur wie der «Schwere» und den von ihm selbst weiter benützten Begriffen von «Kraft», «Wille» und «Leben» formte er sodann den Kompromiss: «Ich nenne es Formkraft.» Dann griff er in der Gleichsetzung von «Architektonik» und «System» bis auf Kant zurück. Kehrtwendung? Auf alle Fälle zeigt sich schnell, dass bei dieser neuerlichen Beschränkung Borromini kaum beizukommen ist. Natürlich konnte die Umkehrung der Winckelmannschen Begriffe von «Mass und Form, Einfalt und Linienadel, Stille der Seele und sanfte Empfindung» gemäss Wölfflins Empfehlung - «Man setze das Gegenteil eines jeden dieser Begriffe, und man hat das Wesen der neuen Kunst bezeichnet» - kaum zum Ziel führen.
Wölfflin hatte bemängelt, den Barock begleite keine Theorie wie die Renaissance, was übrigens nur dann zutrifft, wenn man - fälschlicherweise - von einer kontinuierlichen Fortschreibung der älteren Theorie in gegebenen Grenzen ausgeht. Hat denn niemand in Perraults «Ordonnance» (1683) nachgelesen, dass selbst aus der Sicht der französischen Architekturtheorie ausserhalb der engen Doktrin der Säulenordnung so gut wie (noch) nichts geregelt war? Von jener beschränkten Basis aus wird man die Gesetzmässigkeit «barocker Architektur» nicht erreichen können.
Wölfflin flüchtet - ganz im Sinne des Zeitgeistes - in atmosphärische Beschreibungen: «weniger Anschauung, mehr Stimmung». «Gesamteindruck» und «Barockgeist» sind entscheidend. «Hier treffen wir auf den Nerv des Barock», stellt Wölfflin fest: «Aufgehen im Unendlichen, Sich-Auflösen im Gefühl eines Übergewaltigen und Unbegreiflichen», «Verzicht auf das Fassbare», «eine Art von Berauschung». Wie schnell entfernt sich hier der Kunsthistoriker von seinen guten Vorsätzen! Man ist kaum erstaunt, dass Wölfflin mangels passender «Gesetzmässigkeiten» bei Borromini nur einen «wilden Taumel» verspürt und auch er sich der pathologischen Annäherung verschreibt: «Die Hauptbarockmeister litten alle an Kopfweh», präzisiert Wölfflin in einer Fussnote und belegt dies mit Milizia.
Wölfflins Flucht in «Stimmung» findet anderswo ihre konsequente Fortsetzung und Parallele. Alois Riegl fragt in seinen Vorlesungen zur «Entstehung der Barockkunst in Rom» (1908) nach dem «Sinn» des Barockbegriffs und kommt auf die Bedeutung «wunderlich, ungewöhnlich, ausserordentlich». Dem kann er offensichtlich selbst wenig abgewinnen, denn, «jenes Ausserordentliche, das die Barockkunst darstellt, verstehen wir nicht, es überzeugt uns nicht, enthält einen Widerspruch, wirkt unwahr, wir finden es daher wunderlich» - als ob ein solches Urteil gefragt wäre! Wieder kommt ein Vorurteil in die Quere. Es heisst «lästige Unklarheit». Da findet Riegl zu den Vorurteilen der Klimatheorie zurück: «Wir hassen vor allem die heftige Handlung» (der Südländer) und nur (der nördliche) Rembrandt kann ihn beruhigen. Das «Psychologisieren» feiert Urständ. Wie sollte es anders sein, wenn Wölfflin von der folgenden Definition ausgeht: «Wir bezeichnen die Wirkung, die wir empfangen, als Eindruck. Und diesen Eindruck fassen wir als Ausdruck des Objekts.» Ein- und Ausdruck dasselbe! Das Objekt letztlich in harmonischer Identität mit seiner Interpretation! So einfach wird subjektive Betrachtungsweise zur kunstgeschichtlichen Methode erhoben. Vor den «Fatalitäten», in die die Kunstgeschichte stürzt, wenn sie «als letzten Rat zur Lösung des Barockproblems die Psycho-Physiologie heranholt», hat schon 1912 Carl Horst - ein heute im Gegensatz zu den eben zitierten Vertretern der Kunstgeschichte vergessener Name - allerdings ohne Erfolg gewarnt.
MODERNE BORROMINI-FORSCHUNG
Man muss also Hempel verstehen, wenn er zu Beginn seiner ersten modernen Monographie (1924) als Ziel angab, «für die Darstellung des Lebenswerkes Francesco Borrominis durch die Heranziehung des gesamten in Betracht kommenden Materials eine möglichst breite Basis zu gewinnen». Das war der Ausgangspunkt der modernen Borromini-Forschung, aber natürlich keine ausreichende Option auf eine verlässliche Beantwortung des längst im Raum stehenden, den Rahmen einer blossen Fallstudie sprengenden Borromini-Problems. Man muss deshalb auch verstehen, dass Sedlmayrs systematischer Ansatz und die an den Beginn der ersten Ausgabe (1930) seiner Borromini-Studie gestellte Kritik der Orientierung am blossen «Bild» und der Nähe kunstgeschichtlicher Arbeit zu «literarischen Formen» völlig berechtigt war. Doch mit dem Vorschlag einer «ersten» und «zweiten» Kunstwissenschaft hatte er in den Augen der soliden kunstgeschichtlichen Basis den Bogen überspannt. So wenig man den psychologischen Grundton seiner Vorgänger zu bemerken schien, so übel stiess nun Sedlmayrs «Zur Psychologie Borrominis» auf. Anthony Blunt bezeichnete Sedlmayrs Arbeit noch 1979 als «ingenious but perverse analysis of his (Borrominis) work in terms of Freudian (!) psychoanalysis». Offensichtlich reichte für Blunt die saloppe Gleichsetzung von Psychologie und Freud, um über die Angelegenheit der Wesenserfassung barocker Kunst hinwegzugehen.
Wirkliche Kritik an Sedlmayr würde sich erst dann ergeben, wenn seine Schlussfolgerungen mit den zum Ausgangspunkt genommenen Auffassungen der Gestalttheorie verglichen würden. Dieser Mühe hat sich die Kunstgeschichte nicht unterzogen. Doch wer mag sich mit Friedrich Sanders experimentellen Untersuchungen über rhythmusartige Reihen- und Gruppenbildungen, über «Vorgestalterlebnis» oder mit dem von Sedlmayr wiederholt zitierten Hans Reichenbach und seinen Feststellungen zum Verhältnis einer «normativen Funktion der Anschauung» und «dem Zwang einer logischen Implikation» auseinandersetzen? Solche Fragen haben Sedlmayr auf seinem Gang zu einer Strukturanalyse der Architektur am Beispiel Borrominis zweifellos beschäftigt. Er ist nur gar schnell von den Fragen der Wahrnehmung zu denen einer «architektonischen Vorstellungswelt» - wie Wölfflin vom «Eindruck» zum «Ausdruck» - gelangt und hat diese wiederum voreilig in der Orthodoxie reiner Geometrie (auch dies ein Modernismus!) aufgelöst, womit dann die architektonische Kreativität Borrominis einmal mehr zu Grabe getragen war.
EINE «PRACTICA DI BORROMINI»
Auch Sedlmayr hatte sich also von Borromini entfernt. Gleichwohl hat er am richtigen Ort, dem Entwurfsvorgang, angesetzt, um endlich hinter das «Bild» zu kommen. Allein, was tut man, um sowohl die Strukturanalyse mit ihren geometrischen Reduktionen als auch die Auflösung der Frage in eine Kasuistik einzelner Untersuchungen zu vermeiden? Man brauchte bloss den Kontext von den Fakten auf die Denkformen auszuweiten, um ein ziemlich brachliegendes Forschungsgebiet zu entdecken. Und natürlich würde dies nicht bedeuten, Borrominis Entwurfsmethoden - analog zu Sedlmayrs Schlussfolgerungen - etwa auf Nicolaus Cusanus' «De transmutationibus Geometricis» zurückzuführen. Aber auf solchen Grundlagen liesse sich gleichwohl - das «gotico», die Praxis der (Mailänder) Bauhütte, wie die gerühmte «intelligenza» Borrominis, seine intellektuelle Begabung, berücksichtigend - eine «Pratica di Borromini» umschreiben, wenn man sich denn einiger anderer Grundsätze, ja, wenn man sich etwa jenes bei Scamozzi (1615) vermerkten «Ars est universalium cognitio, experientia vero singularium, come dice Aristotele» vergewissern würde. Wie wollte man in Anbetracht der umfangreichen Zeugnisse ausgerechnet Borromini auf das eine oder das andere festlegen! Bei ihm ist vielmehr, wovon man meist nur zu träumen wagt, Praxis und Theorie, das Einzelne und das Ganze aufs engste ineinander verwoben, und dies macht den Zugang zu seinem Werk und zu seiner Architektur insgesamt so anspruchsvoll und schwer und immer wieder lohnenswert.
Neue Zürcher Zeitung, Sa., 1999.09.25
![]()