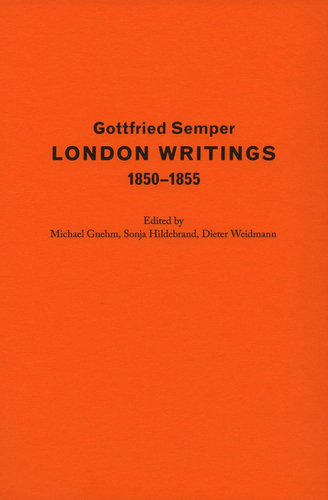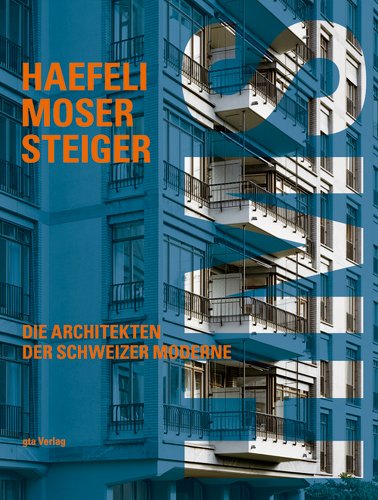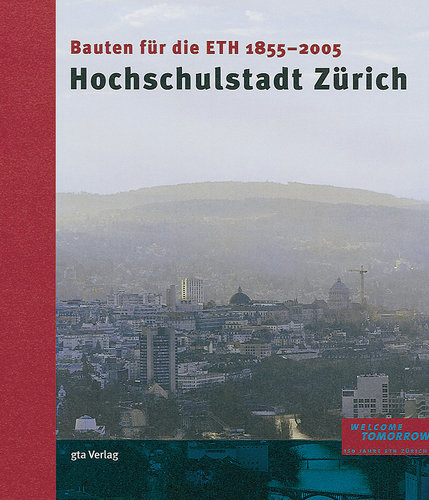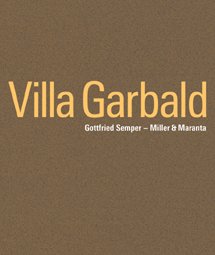Egon Eiermann, dessen Geburtstag sich am 29. September zum hundertsten Mal jährt, dominierte als Architekt und Professor zwei Jahrzehnte lang das bundesdeutsche Baugeschehen. Sein seit Ende der zwanziger Jahre entstandenes Werk galt und gilt als Ausweis einer «Kontinuität der Moderne» vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Egon Eiermann, dessen Geburtstag sich am 29. September zum hundertsten Mal jährt, dominierte als Architekt und Professor zwei Jahrzehnte lang das bundesdeutsche Baugeschehen. Sein seit Ende der zwanziger Jahre entstandenes Werk galt und gilt als Ausweis einer «Kontinuität der Moderne» vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Egon Eiermann, 1904 bei Potsdam geboren, gehört zur zweiten Generation der Moderne. Vielleicht war es dieser Umstand, der es ihm erlaubte, schon als junger Mann einen differenzierten Blick auf die moderne Architektur zu entwickeln. Als er Ende der zwanziger Jahre seine Berufspraxis begann, hatte das Neue Bauen jedenfalls in Publizisten wie Adolf Behne oder Peter Meyer auch in den eigenen Reihen seine kritischen Begleiter gefunden. Für Eiermann wurde Hans Poelzig prägend. Sein Lehrer an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg hatte sich stets eine eigenständige Position zwischen den Lagern der «Konservativen» und «Modernen» bewahrt.
Moderne Grundhaltung
Ganz zeittypisch vertrat Eiermann damals seine Position nicht als Einzelkämpfer, sondern gründete 1926 zusammen mit Kommilitonen die «Gruppe junger Architekten», deren Publizist Julius Posener war. Was man nicht wollte, war eine plakative Modernität um ihrer selbst willen, eine unreflektierte, nur modische Verwendung moderner Signete. Von der Integration fachfremder Wissenschaften wie der Soziologie oder der Hygiene in den Entwurfsprozess hielt man ebenfalls wenig: «Wir waren der Meinung, dass der Architekt in erster Linie die Bedingungen des Bauens kennen muss: des (handwerklichen) Bau- Vorgangs sowie der Umwelt und der Nutzung.»
Eiermann begann 1928 als angestellter Architekt. Doch weder im Hamburger Baubüro der Karstadt AG noch bei den Berliner Elektrizitätswerken hielt es ihn lang. Schon 1930 machte er sich in Berlin selbständig; bis 1934 teilte er das Büro mit seinem Studienfreund Fritz Jaenecke. Eiermanns Erstling, das Umspannwerk Berlin- Steglitz, fand unter anderem 1931 in Heinz Johannes' Führer zum «Neuen Bauen in Berlin» Aufnahme. Vom Bauhaus schickte Mies van der Rohe seine Studentinnen und Studenten 1932 beim nahe gelegenen Haus Hesse vorbei, Eiermanns und Jaeneckes frühem Kabinettstück im Süden Berlins. Noch 1934 wurde dieser eingeschossige Flachdachbau mit der im Prüssverband gemauerten Sichtziegelfassade und einer Vielzahl an räumlichen Bezügen in der Fachpresse als beispielhafte «Verwirklichung eines zeitgemässen geistigen und materiellen Wesensgehaltes» gelobt, in dessen Mittelpunkt der Mensch stehe. Mit wenigen Ausnahmen zeigen alle Bauten Eiermanns dieser Jahre eine moderne Grundhaltung ohne Zug ins Extreme, die ihm nach der nationalsozialistischen Machtübernahme das Weiterbauen erleichterte.
Bauen im dritten Reich
In der Literatur wird Eiermanns Berliner Zeit bis 1945 zwar oft marginalisiert; für sein Selbstverständnis und seine öffentliche Wahrnehmung vor und unmittelbar nach 1945 besass sie indessen ein nicht zu unterschätzendes Gewicht. Gerade in diesen Jahren manifestierte sich Eiermanns Arbeitsethos besonders deutlich. Sein Freund, Berliner Mitarbeiter und Karlsruher Kollege Rudolf Büchner hat es so beschrieben: «Mensch und Architekt Egon Eiermann? Beides lässt sich gerade bei ihm nicht trennen. Der Mensch war immer zugleich Architekt, und zwar mit Leidenschaft und Besessenheit und stets mit kontrollierender Strenge sich selbst gegenüber.» Der (gute) Mensch definierte sich über die (gute) Arbeit. Dass die Mitmenschen de facto dabei aus dem Fokus geraten konnten, lag auch an der Logik des diktatorischen nationalsozialistischen Systems und des Krieges. Seine Mitarbeiter ermahnte Eiermann noch im Februar 1945 zum rechtzeitigen Arbeitsbeginn: «Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich von jedem trennen werde, bei dem private Neigungen und Wünsche den Beweis erbringen, dass er diese für wichtiger hält als die Arbeit im Büro.»
Die Einfamilienhäuser, die bis 1942 in Berlin und dessen Umland entstanden, zeigten trotz nunmehr (flach) geneigten Dächern eine klare Kubatur der oft asymmetrisch ausgebildeten Baukörper, betont flächige Fassaden und eine enge Verzahnung mit der umgebenden Natur. Während Eiermann in der äusseren Erscheinung seiner Bauten explizit landschaftsgebundene oder gar historisierende Formen vermied, forcierte er im Innern mitunter ein rustikales Erscheinungsbild. Öffentliche Anbiederung an den verordneten Zeitgeschmack war das nicht.
Das grösste Potenzial für die Zukunft schuf sich Eiermann mit den Industriebauten, deren Planung ab 1936 zunehmend seinen Büroalltag bestimmte. Dass er auf diesem Feld reüssieren konnte, lag teils an der nationalsozialistischen Rüstungs- und Wirtschaftspolitik, teils an den gestalterischen Möglichkeiten, die die Diktatur dort erlaubte. Die von den Industriearchitekten nach 1945 für sich in Anspruch genommene politikfreie «Nische Industriebau» hat es dagegen bekanntlich nicht gegeben. Auch Eiermanns formal und funktional konsequent modern gestaltete Fabrikgebäude wie der 1939 entstandene Stahlbetonskelettbau der «Total»-Werke in Apolda mit seinem markanten Dachgarten wurden bis in die Kriegsjahre hinein öffentlich wahrgenommen.
Eiermann war kein Freund der offiziellen Repräsentationsarchitektur; sein Verriss der Beiträge zum Dessauer Theaterwettbewerb von 1935 ist berühmt. Das bedeutete aber nicht, dass er grundsätzlich keine öffentlichen Aufträge annahm. Seine politisch brisanteste Arbeit ist die Gestaltung der «Leistungsschau» der staatlichen Propagandaausstellung «Gebt mir vier Jahre Zeit!», die 1937 auf dem Berliner Messegelände gezeigt wurde. Den Auftrag hatte Eiermann Ende 1936 nach einem eingeladenen Wettbewerb vom Propagandaministerium erhalten. - Dank seinem Einstieg in den Industriebau blieb Eiermann auch in den Kriegsjahren gut beschäftigt. Bei Kriegsende leitete er Baustellen im gesamten Reich einschliesslich der annektierten Ostgebiete. Die Bandbreite seiner Projekte reichte von Behelfsunterkünften bis zur Planung einer ganzen Stadt mit Flugfeld und ausgedehntem Industriequartier im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums.
Von Berlin nach Karlsruhe
Als Eiermanns Berliner Zeit im April 1945 mit der Flucht nach Buchen im Odenwald, der Heimatstadt seines Vaters, endete, war er ein bekannter Architekt. Die funktionelle und propagandistische Einbindung einiger seiner Arbeiten in die nationalsozialistische Politik und Kriegswirtschaft blieb in der Regel ausgeblendet. Dies dürfte umso leichter gefallen sein, als Eiermann - anders etwa als Peter Behrens - keine öffentlichen Prachtbauten entworfen hatte. Das sichtbarste Zeichen von Eiermanns deutschlandweiter Anerkennung war die schnelle akademische Karriere, die sich gleich nach Kriegsende mit Angeboten aus Weimar, Berlin, Darmstadt, Hannover und Karlsruhe anbahnte. Im April 1947 wurde Eiermann als «Persönlichkeit grösster praktischer Bauerfahrung auf dem Gebiete der modernen Baumethoden, zugleich aber regster geistiger Lebendigkeit und Verknüpfung mit allen andern kulturellen Strömungen unserer Zeit» nach Karlsruhe berufen. Dorthin verlegte er 1948 auch sein Büro, das er bis 1965 gemeinsam mit seinem Berliner Mitarbeiter Robert Hilgers betrieb. Eiermann blieb bis in die sechziger Jahre hinein die dominierende Persönlichkeit der Architekturfakultät. Dank ihm wurde Karlsruhe zum Zentrum der modernen Architekturlehre in Deutschland. Seine Schüler sind zahlreich. Einer der heute berühmtesten, Oswald Mathias Ungers, erwarb schon 1950 das Diplom; danach ging er eigene Wege.
Was moderne Architektur nach dem politischen Neuanfang sein und leisten sollte, hat Eiermann, der eigentlich die Praxis der theoretischen Grundlegung vorzog, in den Jahren um 1950 mehrfach bekundet: als Teilnehmer der Darmstädter Gespräche, als Mitarbeiter der damals renommiertesten deutschen Architekturzeitschrift «Baukunst und Werkform» oder auch in Provinzblättern, wo er über den «Wiederaufbau auf dem Lande», die Notwendigkeit einer Bodenreform oder die Schweizer Wanderausstellung «USA baut» schrieb. Eiermann verstand sich als Garant der «Kontinuität der Moderne», einer Moderne, die jetzt auch für Humanität, Völkerverbindung, Freiheit und Demokratie stand.
Bis Anfang der fünfziger Jahre blieb die Industriearchitektur Eiermanns wichtigste Domäne. 1951 wurde mit der Taschentuchweberei in Blumberg im Südschwarzwald einer seiner konstruktiv und in der architektonischen Gestaltung innovativsten Bauten fertig gestellt. Mit Blumberg und anderen Bauten dieser Jahre trug Eiermann massgeblich zum Anschluss der jungen Bundesrepublik an die internationale Moderne bei. Erstmals blickte das Ausland wieder wohlwollend auf Deutschland. Die Schweizer Architekturzeitschrift «Werk» rechnete die Blumberger Fabrik 1952 «zum Besten, was Westdeutschland seit dem Kriege an Bauten hervorgebracht hat». Heute zählt das frühe Lob indessen nicht mehr viel: Die hervorragend proportionierte Halle mit der Wellasbestzement-Fassade steht seit 1995 leer und ist in ihrem Bestand akut gefährdet.
Meister der Stahlarchitektur
Mit der «Wirtschaftswunderzeit» wurde der Verwaltungs- und Geschäftshausbau zu Eiermanns täglichem Brot. Die Führung auf diesem Gebiet musste er sich in Deutschland nur mit Paul Schneider-Esleben teilen. Eiermann, dem architektonische Ordnung und die «knappe Form» als Äusserungen von Bescheidenheit und Rücksichtnahme galten, entwickelte sich zum Meister der an Mies van der Rohe geschulten Stahlarchitektur. Dem «formlosen Beton» und den plastisch-expressiven «Experimenten» Le Corbusiers oder Hans Scharouns setzte Eiermann Formstrenge und die Visualisierung der betont schlanken Konstruktionen entgegen.
Zu seinen Markenzeichen wurde die beim Warenhaus Merkur in Reutlingen 1952/53 erstmals realisierte zweite Fassadenschicht aus Umgängen, Gestängen und Sonnenschutzvorrichtungen, die auch grosse Bauten leicht und elegant erscheinen lässt. Mit Eiermanns Namen sind aber auch die uniformen Fassadenschürzen aus keramischen Wabenelementen verbunden, die zum ungeliebten Signet der Horten-Kaufhäuser wurden. Aus Eiermanns Büro stammen letztlich nur zwei der später zahlreich wiederholten «HortenWaben»: das Warenhaus Horten in Heidelberg (1958-62) und sein Stuttgarter Gegenstück (1951-60), für dessen Bau Eiermann den Abriss von Erich Mendelsohns Inkunabel der modernen Kaufhausarchitektur, des 1928 eröffneten Schocken-Kaufhauses, hinnahm.
Umgang mit dem Baubestand
Was Eiermann bei Mendelsohn Überwindung gekostet hatte, fiel ihm bei einem Monument des Kaiserreichs nicht schwer: Die Ruine der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gab er in seinen Wettbewerbsentwürfen von 1956/57 mit voller Überzeugung zum Abriss frei. Doch wo der Geldwert keine Rolle spielte, konnte der Symbolwert seine ganze Kraft entfalten. Während die Kritik in Stuttgart ins Leere gelaufen war, führte sie in Berlin zu einer Korrektur der Bauaufgabe. Infolge der öffentlichen Proteststürme schrieb der Bauherr schliesslich den Erhalt der Turmruine vor. Um diese herum gruppierte Eiermann die vier Einzelbauten von Kirche, Sakristei, Kapelle und neuem Turm auf gemeinsamem Podest zu einem sorgfältig austarierten Ensemble, das nicht nur dem westlichen Zentrum einen Fixpunkt gab, sondern auch der Stadt ein neues Wahrzeichen. Einen eigenen Ausdruck entfalteten die aus wabenartigen Betonelementen aufgebauten Aussenwände der Kirche. Während die Wabenfassaden der Kaufhäuser die Aufgabe hatten, die ungestalteten Aussenwände zu kaschieren, sind sie bei der Gedächtniskirche wie auch bei Eiermanns kleinem Meisterwerk der Matthäuskirche in Pforzheim (1952-56) als diaphane Wände zwischen die sichtbare Skelettkonstruktion gespannt. In den fünfziger und sechziger Jahren umfasste Eiermanns Planungsradius das gesamte Bundesgebiet. Darüber hinaus gelangte er zwar kaum je, sein Renommee aber überstrahlte die Landesgrenzen weit. Dies verdankte er nicht zuletzt jenen Projekten, die er als Architekt der Bundesrepublik verwirklichen konnte - allen voran der zusammen mit Sep Ruf ausgeführten Pavillongruppe auf der Weltausstellung in Brüssel und dem 1958-64 realisierten Kanzleigebäude der Deutschen Botschaft in Washington.
Die über dunklen Sockeln gleichsam schwebenden gläsernen Würfel in Brüssel wurden zum Symbol des demokratischen Deutschland, das sich 1958 erstmals wieder im Kreis der «freien Welt» präsentieren durfte. Als «demokratische Architektur» verstand Eiermann auch das mit mehreren amerikanischen Preisen ausgezeichnete Washingtoner Botschaftsgebäude, dessen langgestreckter Baukörper sich wie ein Hochseedampfer in das abfallende Terrain schiebt. Was Eiermann als Gegenbild zur «alten machtverkündenden Vertikalströmung» verstand, stellte Ungers dreissig Jahre später wieder in Frage: Er gestaltete die benachbarte, 1995 eingeweihte Botschafterresidenz als klassizistische «Säulenbotschaft».
Eiermann blieb auch in den Jahren des boomenden Betonbaus ein Meister der Stahlarchitektur. Die Bauten seiner letzten Lebensjahre waren bereits in ihrer Entstehungszeit Klassiker. So erscheint es nur folgerichtig, dass er noch kurz vor seinem Tod als Nachfolger Mies van der Rohes in den Orden Pour le Mérite gewählt wurde. Dass sich Klassik immer auch mit Innovation und geradezu spielerischer Leichtigkeit verbinden konnte, führte Eiermann zuletzt mit den erst postum fertig gestellten Olivetti-Türmen vor. Sie gehören immer noch zum Besten, was das in letzter Zeit nicht sehr Eiermann-freundliche Frankfurt - man erinnere sich an den Abriss von Eiermanns Hochtief-Gebäude im letzten Jahr (NZZ 12. 9. 03) - den an Architektur Interessierten zu bieten hat.
Neue Zürcher Zeitung, Sa., 2004.09.25
verknüpfte AkteureEiermann Egon
![]()