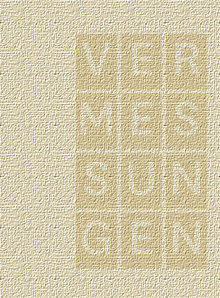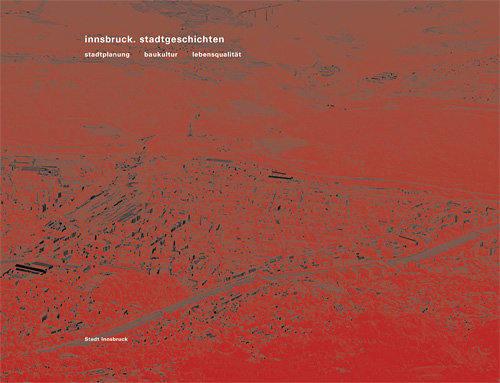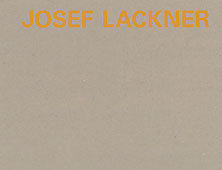Sprache als Hintergrund
Hermann Czech und seine Architektur jenseits des Materials
Hermann Czech und seine Architektur jenseits des Materials
»Die ›Funktion‹ ist dem Entwurf nicht vorgegeben, sondern immer erst im Entwurf vermittelt. Vorher ist sie nicht da; wie Raum und Konstruktion wird sie erst durch die Architektur geschaffen. Ja, das eigentliche künstlerische Material der Architektur ist nicht der Baustoff, die Konstruktion, die skulpturale Form, nicht einmal der Raum oder das Licht – es ist das Verhalten von Menschen.« Hermann Czech (2003)
Hermann Czech ist Architekt, er plant seine Bauten mit den Mitteln der Architektur, aber eigentlich entwickelt er sie auch aus der Welt der Sprache und der Grammatik des Alltagslebens. Ein wesentliches Merkmal seiner Projekte besteht darin, dass er die Begriffe und die Rhetorik des einfachen Lebens als wichtiges »Material« und Ausgangspunkt ansieht. Er entwickelt Konzepte auf Basis einer langen Auseinandersetzung mit der Sprache der/über Architektur, entlang der Begriffe und ihrer Bedeutungen. Diese innerarchitektonische »Welt« überprüft er durch die so genannten Konventionen, die er zuerst beobachtet und analysiert, um sie adaptieren und leicht verändern zu können. Doch Czech »zitiert« nicht, sondern übersetzt diese Erkenntnisse in »neue«, zeitgenössische Architektur. »Der Gegenstand der Architektur ist nicht das architektonische Objekt. Das Thema der Architektur ist zunächst der genutzte Raum, die definierte und strukturierte Leere im und am Objekt; und diese Leere ist weiters vermittelt durch eine persönliche, soziale und historische Sicht – durch eine Individualität. Das Thema der Architektur ist also immateriell. Gegenstand der Architektur ist der architektonische Gedanke.« (Czech)
Hermann Czech ist kein Revolutionär, er erhebt nicht den Anspruch innovativ oder avantgardistisch zu sein, will nicht die Grenzen der Architektur ausreizen. »Ich bin nicht jemand, der Formen erfindet oder Konzepte im Kopf zusammenverdichtet, sondern jemand, der von den vielen Vorbedingungen lebt.« (Czech)
In diesem Sinne arbeitet er kontinuierlich an architektonischen Gedanken, da er komplexe, präzise und vor allem mehrschichtig »funktionale« Lösungen entwirft. Er entwickelt seine Projekte nicht aus der materiellen Welt, sondern über den Umweg der Sprache und des darin gespeicherten »Wissens« über die symbolischen Bedeutungen der Baustoffe und ihrer »Funktionalität«. Eigentlich interessiert er sich nicht für die Materialien an sich, da er sie »nur« – je nachdem – für »etwas« verwendet, sie der Sprache und der Idee des Entwurfs unterordnet. Er spielt mit den Materialien und ihren Bedeutungen, »erlaubt« sich Verfremdungen, Täuschungen und Irritationen, um letztendlich jene atmosphärische »Selbstverständlichkeit« und konzeptionelle Stringenz zu erreichen, die einen als Nutzer zuerst beeindruckt und dann in Ruhe lässt. Diese Haltung kennt kein echt oder falsch, folgt nicht vordergründig Überlegungen zur Materialgerechtigkeit und lügt teilweise, was das Zeug hält, weil sie letztendlich an einem bestimmten und stimmigen Ergebnis interessiert ist. »Ich kenne bis heute nicht viel mehr als fünf Holzarten und die reichen mir. Im Palais Schwarzenberg habe ich bei der Bar das Holz nur nach den Kriterien von hell und dunkel ausgesucht. Mich interessiert die Holzart nicht, sondern nur gewisse Eigenschaften, nämlich die Farbe und ob sie hart oder weich ist.«
Czech nimmt die Architektur wörtlich, hin und wieder wortwörtlich. Dabei folgt er einem Ansatz von Theodor W. Adorno, der 1963 Folgendes formulierte: »Der Funktionalismus ist eine unverlierbare historische Stufe der Architektur. Andererseits erleben wir jetzt seine Austrocknung, Sterilität. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus, ohne hinter den Funktionalismus zurückzugehen? Der Begriff der Phantasie, die sozusagen obendrein dazukommt, ist unzureichend. Man kann nur über die Sachlichkeit hinaus, indem man noch sachlicher ist.«
Dieses »Noch-sachlicher-Werden« interpretiert Czech als Bewegung zur Sache selbst, zur Funktion von Architektur, zu ihrer verborgenen Sprache, der Architekturgeschichte als Material sowie zu den Bedürfnissen der Nutzer an sich: eben zu ihrer Grammatik. In diesem Sinne scheut er nicht davor zurück, in die Debatte über Architektur Argumente für die Trivialisierung ihrer Ästhetik einzubringen, also auch banale und »un-schöne« Lösungen gelten zu lassen.
Aus diesen Überlegungen heraus wird auch der Widerspruch – die ästhetische wie materielle Inkommensurabilität – akzeptiert und in den Entwurfsprozess integriert. Ohne Anspruch auf eine durchgängig »schöne« Gestaltung öffnet sich damit die Architektur zu einem regellosen und ideologiefreien System, das »Strukturen von Argumenten« (Czech) zu folgen sucht. Diese Grundhaltung führt auch zur Einsicht, »dass trotz Einhaltung aller Regeln ein totes Werk entstehen und ein lebendiges Werk allen Regeln widersprechen kann«. (Dieses Zitat bezieht sich eigentlich auf die »Regeln« von Christopher Alexander.) Denn das Einhalten von Regeln erzeugt noch keine Stimmigkeit, bestenfalls Richtigkeit, und der Regelbruch zieht unter Umständen ein spannendes Ergebnis nach sich. In diesem Sinne fungieren Regeln für Czech als Grenzen, die zu dehnen ihm Freude bereitet, ohne jedoch in ein »naives« Verhalten zu verfallen. Wichtig erscheint Czech vor allem, dass man die Sprache der Gestaltung den Bedingungen und nicht einem Stil anpasst. Im Begriff des Manierismus – der den Stilbruch pflegt, ohne stillos zu sein – versucht er diesen Ansatz zu verdeutlichen.
»Der Manierismus ist eine Haltung der Intellektualität, der Bewusstheit; und außerdem ein Sinn für das Irreguläre, Absurde, das die jeweils aufgestellten Regeln durchbricht. Der Manierismus ist der begriffliche Ansatz, die Wirklichkeit auf der jeweils erforderlichen Ebene zu akzeptieren. Er erlaubt jene Offenheit und Imagination, auch unerwartete Fremdprozesse in Gang zu setzen und zu ertragen. Eine Architektur der Partizipation ist nur auf der Basis eines Manierismus möglich.« (Czech)
Diese Trivialisierung von Theorie und Materialeinsatz auf höchstem Niveau widerspricht jedoch den gängigen Vorstellungen der architektonischen Disziplin. In gewissem Sinne lebt Czech darin die Janusköpfigkeit der Moderne aus, da er sowohl die Kritik an der Moderne formuliert als auch gegen ihre Formalisierung anschreibt und -baut, um ihre Idee zu retten. Mit seiner Position spaltet er die ästhetische wie ideologische Gegenwart, indem er eine »eindeutig« moderne Haltung bezieht, sich formal scheinbar »hässlich« gibt, um mit ironischer Geste anzudeuten, weder noch zu sein.
zuschnitt, Mo., 2008.12.15
verknüpfte Zeitschriften
zuschnitt 32 Echt falsch