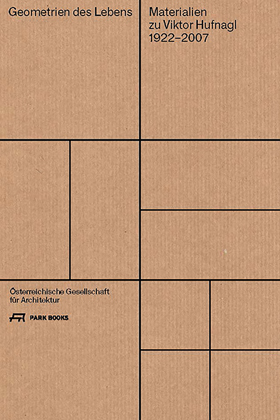Neue Häuser: Eine ungewöhnliche Lösung
Mit einem Planungsvorschlag des Wiener Architekten Robert Kraus und durch die Begeisterung der Hauseigentümerin entstand mehr Wohnraum...
Mit einem Planungsvorschlag des Wiener Architekten Robert Kraus und durch die Begeisterung der Hauseigentümerin entstand mehr Wohnraum...
Für eine Familie mit zwei Kindern wurde der Platz in einem Bungalow in der Wiener Korngasse zu knapp. Weil sich die Mieter im vorhandenen Ambiente jedoch ausgesprochen wohl fühlten, die Hanglage des Standortes genossen und den vorhandenen Naturraum mit Altbaumbestand sehr zu schätzen wussten, stellten sie Überlegungen an, wie sich diese denkbar guten Voraussetzungen mit einem Erweiterungsbau optimieren ließen. Für die Investition vonseiten der Besitzerin wurden im Gegenzug eine Erhöhung des Mietzinses wie auch die Übernahme einer Kostengarantie vereinbart.
Lose angedockt
In der Konzeption ist der Architekt von einer visuellen Trennung zwischen altem und neuem Baukörper ausgegangen. Die Substanz des Bestandes aus den Sechzigerjahren sollte nahezu unangetastet bleiben und mit einem eigenständigen Baukörper verbunden bzw. überbaut werden.
Kommt man von der Straßenseite, nimmt man sofort den am Dach des Bungalows angedockten Baukörper wahr. Getragen wird die sechs mal zwölf Meter große Holzkonstruktion mit vorgelagerter Terrasse von seitwärts auskragenden Stahlträgern, die im Dachfirst verankert sind. Eine „Haut“ aus horizontalen Zinktitanblech-Bändern unterstreicht den schwebenden Eindruck.
Der Anbau entwickelt sich aus dem bereits ursprünglich nordseitig gelegenen Teil des Eingangs, der nun direkt in einen zur Halle formulierten Raum von vier Meter Höhe mündet und durch seine ungewohnte Großzügigkeit überrascht. Hier liegt nicht nur die Nahtstelle zwischen Alt und Neu, sondern auch ein Bereich, der sich für die Familie zunehmend zum Ort des Empfangs, der Kommunikation und Repräsentation etabliert. Eine Betonwand-Scheibe mit runder Öffnung, parallel zur vollverglasten Nordfassade angeordnet, zieht sich bis an das Obergeschoß. Sie steht nicht nur für sich selbst als skulpturales Raumobjekt, sondern übernimmt auch die tragende Funktion für den darüberliegenden Bau. Die Erschließung des Obergeschoßes wird von der aus Glasfassade und Wandscheibe resultierenden Zwischenzone aufgenommen. Die Wandscheibe strebt nicht primär die physische Abtrennung an, sondern hat vielmehr in ihrer Transparenz die Gleichzeitigkeit verschiedener Raumfunktionen zur Folge.
Der Architekt bezieht sich in der Raumbildung auf das Prinzip der räumlichen Schichtung, ein Prinzip, das auch im ersten Stockwerk zum Tragen kommt.
Während das Erdgeschoß einen offenen Wohnraum mit Küche, Badezimmer und zwei Kinderzimmern aufnimmt, ist das Obergeschoß dem Rückzug der Eltern vorbehalten. Den Wohnvorstellungen entsprechend, folgt ein offenes Aneinanderreihen der Funktionsbereiche Arbeiten und Schlafen. Als Trennschicht ist ein Schrankraum aus Nussholz eingefügt.
Eine offene Wegführung leitet vom unteren Wohnbereich bis zur Terrasse im Obergeschoß. Sie ist gekennzeichnet durch Ausblicke und Durchblicke, den Übergang von Innenraum und Außenraum.
Ein wesentliches Merkmal in der Gebäudekonzeption ist die Einbindung der Topografie, des Grünraums und die Wahrnehmung der Tages- und Jahreszeiten. So konnte mit schlüssig eingesetzten Materialien und einer Sensibilität für das Raumgefüge für die Familie zusätzlicher Wohnraum mit hoher Wohnqualität verwirklicht werden.
Der Standard, Sa., 2003.01.18
verknüpfte Bauwerke
Wohnraumerweiterung