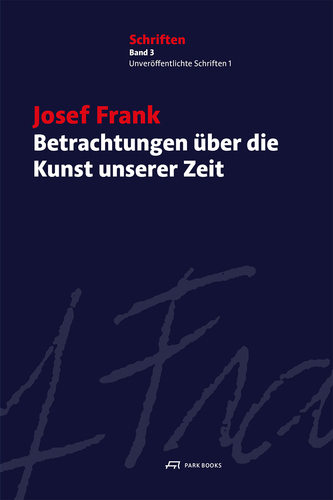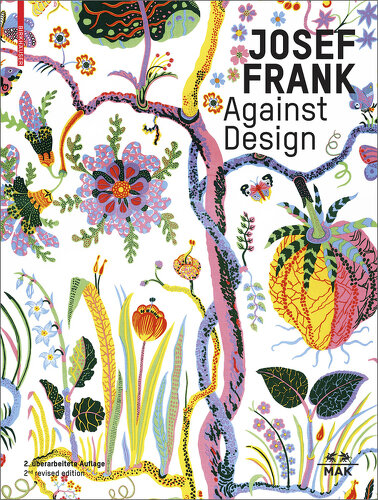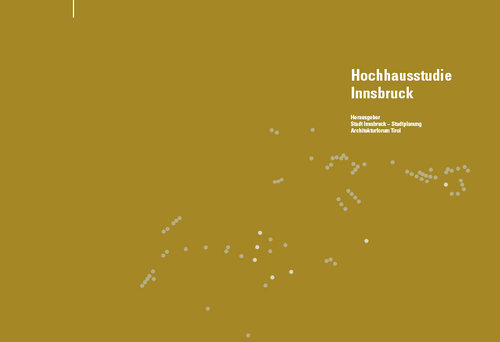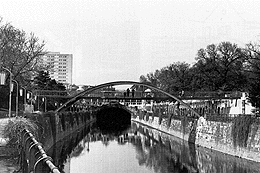Selbstkritik der Moderne
In seinem Essay „Mannerism and Modern Architecture“ von 1950 kommt Colin Rowe zu dem Schluß, die „moderne Architektur könnte möglicherweise Elemente enthalten,...
In seinem Essay „Mannerism and Modern Architecture“ von 1950 kommt Colin Rowe zu dem Schluß, die „moderne Architektur könnte möglicherweise Elemente enthalten,...
In seinem Essay „Mannerism and Modern Architecture“ von 1950 kommt Colin Rowe zu dem Schluß, die „moderne Architektur könnte möglicherweise Elemente enthalten, die dem Manierismus analog sind“1. Er entwickelt diese Erkenntnis zunächst an der Analyse der Ambivalenzen und Irritationen der Villa Schwob von Le Corbusier - insbesondere ihrer Straßenfassade - und dem Vergleich mit Fassaden des 16. Jahrhunderts.
Die Villa Schwob ist von Le Corbusier nicht in die Bände des Oeuvre complète aufgenommen worden, sie „steht offensichtlich nicht im Einklang mit seinen späteren Arbeiten; ihre Aufnahme hätte vielleicht das didaktische Gewicht der Sammlung beeinträchtigt“2. Rowe macht einen Unterschied zwischen frühen Werken der Moderne wie der Villa Schwob - oder auch „Bauten von Perret, Behrens, Adolf Loos“3 - und der Architektur der zwanziger Jahre. Aber auch solchen späteren, in der „Abstraktion“ fortgeschritteneren Werken schreibt er manieristische Kriterien zu: dem Bauhaus von Walter Gropius, dem Entwurf für ein Landhaus aus Backstein (1923) von Mies van der Rohe oder Le Corbusiers Gebäude der Heilsarmee in Paris (1929-33).
Der historische Manierismus legte es in der Sicht Rowes darauf an, die Vollendung der Hochrenaissance zu stören und den Zusammenbruch des Vertrauens in ihre theoretischen Programme vorzuführen. „Als eine Haltung der Vermeidung ist er im wesentlichen auf das Bewußtsein einer vorhandenen Ordnung angewiesen; als eine Haltung der Abweichung erfordert er eine Orthodoxie, innerhalb deren System er häretisch sein kann.“4 Rowe hat einige Schwierigkeiten, dem modernen Manierismus in analoger Weise eine vorgegebene Ordnung gegenüberzustellen, deren Auflösung betrieben wird. Da die manieristischen Züge bereits früh auftreten, verlegt er einen möglichen Bezugsrahmen der Orthodoxie schon ins 19. Jahrhundert, zu den Wurzeln der modernen Bewegung. Im Grunde läßt er die Frage offen. Wenn Robert Venturi die Kriterien von Ambivalenz und Störung, von Komplexität und Widersprüchlichkeit entwickelt, um sie einer heroischen, aber simplistischen Moderne gegenüberzustellen und diese damit zu überwinden5, so hat Rowe jedenfalls diese Kriterien bereits der Moderne selbst zugeschrieben.
Wie, wenn es einen zureichenden und einen unzureichenden Begriff der Moderne gäbe? Wenn die Moderne, die sich eben nicht wie die Renaissance das Auffinden und Darstellen einer den Dingen und dem Kosmos innewohnenden vorgegebenen Ordnung zum Ziel setzen kann, sondern die sich als Projekt, als freier Weltentwurf verstehen muß, in den verantwortlichsten Geistern zugleich das Problembewußtsein des Irrtums und der Fehlhandlung weckte?
Stil
Schon im Begriffskreis der Sachlichkeit sind historisch zwei Standpunkte enthalten: daß jedes Ding sich in seinem eigenen Sinnzusammenhang entfalten müsse - oder aber, daß nichts außer dem einmal erkannten Kanon zugelassen sei. Breitere Wirkung hat die plattere Version erzielt.6 Ein klassischer Aphorismus von Karl Kraus lautet:
„Adolf Loos und ich, er wörtlich, ich sprachlich, haben nichts weiter getan als gezeigt, daß zwischen einer Urne und einem Nachttopf ein Unterschied ist und daß in diesem Unterschied erst die Kultur Spielraum hat. Die andern aber, die Positiven, teilen sich in solche, die die Urne als Nachttopf, und die den Nachttopf als Urne gebrauchen.“7
Dieser Verzicht auf den gemeinsamen Leisten unterscheidet den modernen Standpunkt nicht nur vom Historismus, sondern auch von Jugendstil, Secession und Werkbund - und von allen Doktrinen bis heute. Adolf Loos schreibt 1898:
„Man will eine steinerne Kirche haben, gut, man geht zum Steinmetz. Man will eine Rohbaukaserne. Die macht der Maurer. Man will ein Stuckwohnhaus. Man gibt dem Stuccateur den Auftrag. Man will einen hölzernen Plafond im Speisesaal. Den macht der Zimmermann.
Ja aber - so wird man einwenden - wo bleibe denn dann die gleichartige künstlerische Durchbildung. Ich leugne die Nothwendigkeit einer solchen...“8
Wie hebt sich diese Fassung eines modernen Standpunkts von dem Schauder etwa Jürgen Joedickes ab, es könnte eine Gesellschaft geben, „die so schizophren ist, unterschiedliche Kriterien für das gleiche Problem - die Gestaltung der Umwelt - anzuwenden“9! Auch für Jürgen Habermas ist die „moderne Architektur [...] der erste und einzige verbindliche, auch den Alltag prägende Stil seit den Tagen des Klassizismus“.10
Aber die Kriterien des „Internationalen Stils“11 geben, bloß linear betrachtet, eben den unzureichenden Begriff der Moderne. Der zureichende Begriff der Moderne erfordert nicht nur, daß zu jedem Kriterium des „Internationalen Stils“ jeweils das Gegenteil denkmöglich ist, sondern auch, daß jedes Stilkriterium in verschiedenen Zusammenhängen völlig verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Wenn die Moderne sich nämlich nicht als Auffinden der Weltordnung versteht, kann ihre Bewährung nur im tatsächlichen Leben liegen. Die Kontroverse zwischen Loos und Hoffmann betrifft eben diesen Punkt: ist die Moderne bereits im modernen Leben - im Menschen mit den „modernen Nerven“ - angelegt oder muß sie als Stil von oben her entworfen werden? Im Wien der letzten Jahrhundertwende gab es Leute, die wunderschöne Sachen machen konnten: Klimt, Schnitzler, Hofmannsthal, Richard Strauss… Aber in derselben Stadt gab es Kokoschka, Karl Kraus, Schönberg, Freud, Wittgenstein - die vermitteln konnten, daß Kunst nicht so sehr mit Schönheit, sondern mit Wahrheit zu tun hat. Auch das ist Inhalt der Kontroverse Loos - Hoffmann: es geht um Wahrheit, um eine wirkliche Vernetzung mit einem Bild des Menschen und der Gesellschaft; bloße Schönheit ist geradezu verdächtig.
Stadt
Je dichter am Leben die Architektur bleibt, desto komplexer ist sie; „einfach“ kann sie nur werden, indem sie davon abhebt. Am deutlichsten abgehoben hat die Moderne des „Internationalen Stils“ vom Verständnis der Großstadt. Die Vorläufer- und Außenseiterrolle der Wiener Entwicklung hat die „funktionelle Stadt“ hier nie zum Tragen kommen lassen - zumindest nicht bis in die Nachkriegszeit. Aus dem Werk Otto Wagners spricht die genaue und realistische Vorstellung vom wirklichen großstädtischen Leben, das der Architekt nicht etwa zu „gestalten“, sondern an dem er sich zu bewähren hat. Die Kontroverse der Zwischenkriegszeit zwischen den „Super-blocks“, die die spätgründerzeitliche Großstadtvorstellung Otto Wagners fortsetzten und oft auch von Wagner-Schülern errichtet wurden, und der Siedlungsbewegung, die in Loos und Frank tragende Persönlichkeiten hatte, stellte nie die komplexe Metropolen-Vorstellung in Frage. Der wieder-erarbeitete Hintergrund dieser Stadtvorstellung der frühen Wiener Moderne trägt auch den urbanen Vorschlag von Friedrich Kurrent und Johannes Spalt aus dem Jahr 1964 für eine über die Donau greifende Doppelstadt Wien - und schließlich die städtebauliche Diskussion bis heute.
Vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, daß ein Paradigmenwechsel im Städtebau nicht vollzogen wird, indem man die Tapetenmuster der Lagepläne wechselt. „Man hatte sich schon darauf eingestellt, daß es zwischen der Rettung historischer Bausubstanz und der ästhetisch geleiteten Stadtreparatur keine weiteren Perspektiven mehr für die mit architektonischen Mitteln geführte Auseinandersetzung mit dem städtischen Raum geben würde. Die Dekonstruktion weckt da auf einmal neue Hoffnungen.“12 Wer freilich jeweils mit dem Bad das Kind ausschüttet, ist dazu verurteilt, ins nächste hineinzufallen.
Paradigmenwechsel im Städtebau bedeutet, den übergeordneten allgemeinen Strukturen nachzugehen, von denen die jeweils angemessene Lösung - ebenso wie alle bisherigen Lösungen - den besonderen Fall darstellt.13 Denn nichts soll verhindert werden; aber keine Errungenschaft soll verlorengehen. Diese Vorstellung einer „Architectura perennis“ - ein Begriff Joz?e Plec?niks - nimmt potentiell alle historische Architektur in die Moderne auf. Bei Josef Frank heißt es: „Unsere Zeit ist die ganze uns bekannte historische Zeit. Dieser Gedanke allein kann die Grundlage moderner Baukunst sein.“14
Warum soll denn das Projekt der Moderne gescheitert sein, wenn der Stil nicht haltbar ist? Adorno selbst hat doch gemeint, man könne über die Sachlichkeit hinaus, und zwar, indem man „noch sachlicher“ sei.15 „Noch sachlicher“ sein kann nur heißen: den komplexen Sachzusammenhängen, den Verästelungen der Gedankenreihe nachgehen, statt eine flache Disziplin durchzuhalten.
Partizipation
„Noch sachlicher“ sein heißt aber auch - Adorno fordert es ausdrücklich16 - dem „Konsumierenden“ - also dem Benützer - und seinen (wenn auch „falschen“) Bedürfnissen zum Recht zu verhelfen, den Widerspruch zwischen Rationalität und Humanität aufzulösen. Adorno läßt diesen Widerspruch auf der Stufe des Kompromisses stehen; und das gedankliche Rüstzeug zur Partizipation besteht weithin auch in der Auffassung, der Architekt müsse eben resignierend oder selbstlos auf den Anspruch verzichten, einen Ausdruck zu schaffen, um die Entfaltung und Verwirklichung der Nutzer zu ermöglichen.
Die Beschränktheit und Unwahrhaftigkeit dieses Ansatzes kann nur verlassen werden, indem die Rationalität des Entwurfs eben breit genug ist, um die Komplexitäten und Widersprüchlichkeiten der Partizipation aufzunehmen und auszutragen. Und wieso sollte dazu die Moderne nicht imstande sein, zu deren theoretischen Gegenständen seit der Romantik das Häßliche, Triviale, der Kitsch gehören?17 Eine Kultur der Partizipation ist nur auf der Basis eines Manierismus möglich - deshalb ist er zu wichtig, um ihn den Manieristen zu überlassen. Josef Frank schreibt 1931:
„Wer heute Lebendiges schaffen will, der muß all das aufnehmen, was heute lebt. Den ganzen Geist der Zeit, samt ihrer Sentimentalität und ihren Übertreibungen, samt ihren Geschmacklosigkeiten, die aber doch wenigstens lebendig sind.“18 Und weiter: „Deshalb wird die neue Baukunst aus dem ganzen Ungeschmack unserer Zeit, ihrer Verworrenheit, ihrer Buntheit und Sentimentalität geboren werden, aus allem, was lebendig und empfunden ist: Endlich die Kunst des Volkes, nicht die Kunst fürs Volk.“19
Rationalität bedeutet nämlich nicht bloß Abstraktion. Der oder die Entwerfende und Handelnde muß im Konkreten präzis sein; zu den architektonischen Ideen und Idealen muß die Logik und Moral des konkret erlebten Falles hinzutreten.
Wenn es kulturellen Fortschritt gibt, so kann er nur in Aufklärung bestehen. Dieses „Projekt“ kann nicht „scheitern“, wenn die Moderne auch die Unmündigkeit vor den selbst-geschaffenen Autoritäten aufhebt. Zeitgeistig mag diese aufklärerische und meinetwegen sogar moralische Haltung freilich auch nicht sein, die - vereinfacht - darin besteht, sich nicht blöd machen zu lassen und es auch bei anderen nicht zu versuchen.
newroom, So., 1995.10.01