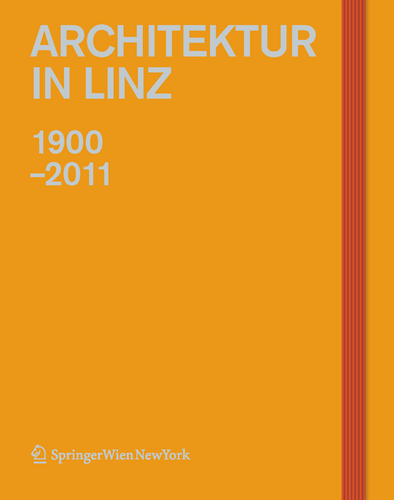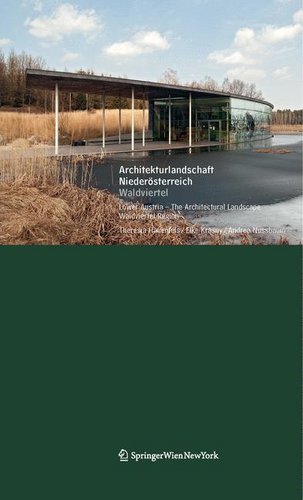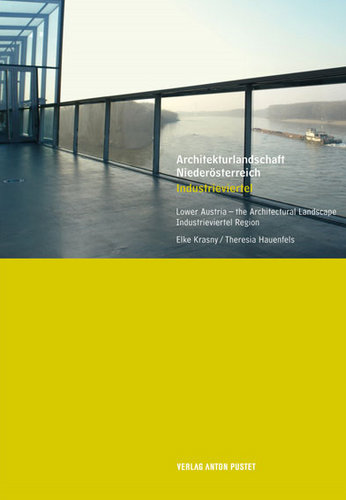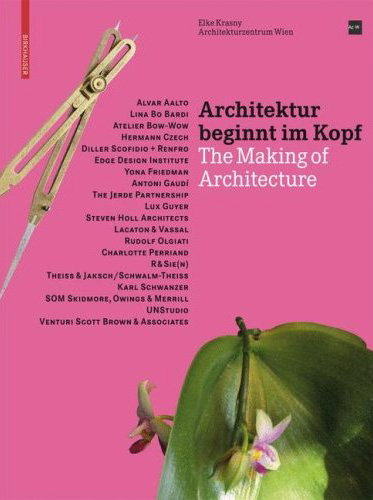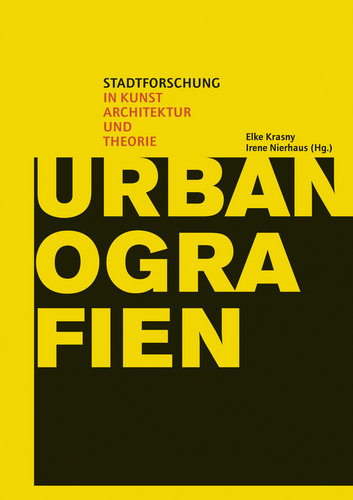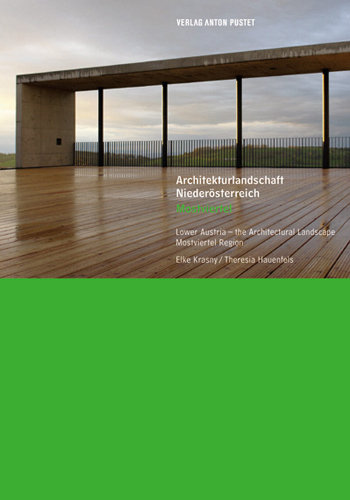Elke: Uns interessiert der Umgang mit dem vielschichtigen Erbe dessen, was aus der Schreber- und Siedlerbewegung in Wien gewachsen ist. Die Zukunft dieser...
Elke: Uns interessiert der Umgang mit dem vielschichtigen Erbe dessen, was aus der Schreber- und Siedlerbewegung in Wien gewachsen ist. Die Zukunft dieser...
Elke: Uns interessiert der Umgang mit dem vielschichtigen Erbe dessen, was aus der Schreber- und Siedlerbewegung in Wien gewachsen ist. Die Zukunft dieser Orte ist ein Hot-Topic. Aufgrund bestimmter gesetzlicher Veränderungen – jetzt schon wieder mit einem zeitlichen Abstand – kann man zumindest Vermutungen anstellen, was das perspektivisch für ein Stadtganzes bedeutet. Wie geht Stadt mit etwas um, das – wenn man es zeithistorisch betrachtet – eine von den BürgerInnen dieser Stadt vor vielen Jahren erkämpfte Ressource ist?
Reinhard: Natürlich ist es ein Verlust von Artenvielfalt, wenn Obst- und Gemüsegärten, die es in den 1980er-Jahren ohnehin nicht mehr flächendeckend gegeben hat, final Zierrasen, Thujen und Swimmingpool weichen, aber das würde ich als das geringere Problem sehen. Das Erschütternde daran ist eher die extreme Dimension der Umwidmung in ganzjährig bewohnbare Kleingärten, was seit 1992 nach einer Gesetzesänderung möglich ist. Nach 15 Jahren waren von 35.000 Kleingärten bereits 20.000 widmungsrechtlich umgewandelt in dauerhaftes Wohnen. Die Stadt Wien ist in Zeiten, in denen schon längst klar war, dass das frei stehende Einfamilienhaus zumindest für die Großstadt kein sinnvolles Modell ist, auf die unbegreifliche Idee gekommen, 20.000 Einfamilienhäuser erstens einmal zuzulassen und zweitens dann auch noch zu fördern und die Grundstücke zu Spottpreisen zu verkaufen.
Sonja: Was ist das gravierendste Problem dieser Entwicklung?
Reinhard: Die bestimmende Konstante in der Entwicklung jedes Siedlungsraums ist das Grundstückseigentum. Dass man im ausgehenden 20. Jahrhundert diesen Schatz für die Stadtentwicklung, nämlich große zusammenhängende Grünflächen, die noch dazu in der Hand der Stadt Wien waren, aufsplittet in 20.000 oder 35.000 EigentümerInnen à 250 m², war eine rein populistische Entscheidung gegen jede fachliche Vernunft. Neben allen raumplanerischen Folgen ist das eine massive Verschleuderung von öffentlichem Eigentum. Da gab es von Anfang an völlig widersinnige Diskontierungen, also eigentlich das Gegenteil des üblichen Handelsprinzips, das doch normalerweise lautet: Am Anfang verlange ich den vollen Preis, und wenn ich sehe, das geht schlecht, dann werde ich billiger.
Sonja: Ja, hier läuft es andersrum. Als Anreiz für den Kauf gibt es einen Preisnachlass vom Verkehrswert, der in Abhängigkeit zum Umwidmungszeitpunkt steht. Drei Jahre nach der Außenvermessung, drei Jahre nach der Umwidmung oder ein Jahr nach der Innenparzellierung gibt es 45 % Nachlass. Nach Ablauf des ersten Jahres nach diesem jeweiligen Zeitraum wird der Preisnachlass auf 30 %, im nächsten Jahr auf 20 % und wieder ein Jahr später auf 10 % gesenkt.
Reinhard: Stadtstrukturell ist das sehr fatal: Es wurden strategisch entwickelbare Gebiete, die der Stadt gehörten, auf eine Vielzahl privater Kleineigentümer verteilt. Dadurch entsteht eine Siedlungsstruktur, die man nie wieder revidieren kann. Die harmlosere Variante wäre gewesen, den KleingärtnerInnen ein Baurecht einzuräumen, solange die Pacht ihrer Kleingärten noch läuft – was natürlich auch eine Schnapsidee ist. Sie hätten dann Einfamilienhäuser hinstellen können, die vielleicht 50, 60 Jahre, bis der Pachtvertrag ausläuft, Bestand gehabt hätten. Die Zeiten, in denen Gebäude für über 100 Jahre errichtet werden, sind ohnehin vorbei.
Sonja: Wie kam es dazu?
Reinhard: Die Stadt hat ihre Entscheidung damit erklärt, dass man widmungstechnisch nachvollziehen wollte, was ohnehin schon längst Realität war, nämlich dass in manchen Kleingärten auch gewohnt wird. Ist das der Sinn von Stadtplanung? Ein anderes Argument war, dass man eine Alternative zum Abwandern ins grüne Niederösterreich bieten wollte.
Sonja: Es wird kolportiert, dass die Stadt Wien mit der Gesetzesnovelle von 1992 Wohnraum schaffen wollte, weil man – fälschlich – geglaubt hatte, die Leute ziehen alle in ihre Kleingartenhäuser und ihre Wohnungen in Wien werden frei. Das hat allerdings kaum funktioniert, weil man einfach beides behalten hat. Dabei entstand 1988 – also vier Jahre vor der Novelle – das sogenannte Kleingartenkonzept, das eigentlich das Gegenteil von dem verlangte, was dann vier Jahre später passiert ist: eine deutliche Unterscheidung von Kleingarten- und Siedlungsgebiet, eingeschränkte Bebaubarkeit etc. Man fragt sich, welchen Grad an Verbindlichkeit solche Konzepte haben?
Reinhard: Null. Die Wiener Stadtplanung wurde in den frühen 1990er-Jahren zum Selbstbedienungsladen der Politik.
Elke: Was bedeutet das für die Stadt? Es gibt eine Stadt, die hat aus einer gewissen historischen Gewordenheit heraus die Ressource eines Grüngürtels. In dem ist auch Aufenthalt ein Teil davon, aber eben nicht als Daueraufenthalt durch alle vier Jahreszeiten. Aufgrund dieser gesetzlichen Veränderung legt man dann zwei Parzellen zusammen und schon wird das immer größer. Diese Fläche kann man aus der Mikroposition der einzelnen Personen, die dort leben, betrachten, aber man kann sie auch noch einmal von weiter weg betrachten – was heißt das, dass sie überhaupt existiert? Oder was bedeutet es, wenn sie nicht mehr da ist? Oder wenn man sie verhüttelt?
Reinhard: Was es an Verlust für die Bevölkerung bedeutet, kann ich nicht einschätzen. Für mich als Stadtbenutzer ist der Verlust weniger einer an öffentlich zugänglichen Grün- und Erholungsflächen als ein ästhetischer, weil fast alles enorm hässlich ist, was dort entsteht. Mein Eindruck ist, dass viele Kleingartenvereine ohnehin schon vorher bestrebt waren, diese Grünräume möglichst abzuriegeln.
Sonja: Ich war kürzlich am Hackenberg in Wien 19 unterwegs – dort gab es einen jahrelangen Umwidmungsstreit, denn fast die Hälfte der BewohnerInnen stimmte gegen die Umwidmung in ganzjähriges Wohnen. Auch die AnrainerInnen haben massiv versucht, das Gebiet als Naherholungsgebiet zu erhalten. Wenn man nun dort spazieren geht, sieht man erschreckende Entwicklungen. Es werden unzählige Meter lange Schneisen in die Kleingartensiedlung geschlagen, die dann von Developern bebaut werden. Überall hängen Transparente, die auf die Grausamkeiten architektonischer Natur verweisen, die entstehen werden. Und das Absurde daran sind die Preise: Die Häuser kosten zwischen 500.000 und 1.000.000 Euro!
Elke: Das ist überhaupt nicht mehr leistbar. Das Hackenberg-Beispiel ist interessant, wenn man bedenkt, dass diese Flächen ja irgendwann einmal aus einer ganz bestimmten Krisensituation heraus erkämpft wurden. Danach gab es eine Art Verfestigungszustand, in dem über Jahrzehnte Rechte ersessen wurden. Aber ich glaube, wir befinden uns schon auf einer nächsten Stufe: Die Developer entdecken diese Gebiete und die Begehrlichkeiten sind geweckt. Es verschwinden die Dinge, die konstitutiv wichtig waren.
Sonja: Das Kleingartengebiet wird zu einer hochpreisigen Siedlung ... Laut den Gemeinderatsprotokollen zur Umwidmung am Hackenberg war die Begründung der SPÖ für ihre Ja-Stimme, dass man die KleingärtnerInnen unterstützen will, die auch über ein kleines Stück Grün verfügen möchten und nicht das große Geld haben, um sich ein Grundstück anzuschaffen – im Grunde braucht man aber wohl in Zukunft das große Geld dafür.
Elke: Was können Leute tun, die alle diese Dinge nicht haben, weder den Zugang zu den Ressourcen noch das reale Kapital, um Teil eines Kleingartens zu werden, aber das Bedürfnis haben zu gärtnern – wo können die ihr Territorium finden?
Reinhard: Wir haben 220.000 Gemeindebauwohnungen, was eine immense sozialpolitische Manövriermasse ist. Ob die Wohnsituation überall zufriedenstellend ist, sei dahingestellt, aber – verglichen mit anderen europäischen Großstädten – ist das Wohnen in Wien noch immer relativ gut leistbar.
Elke: Bleiben wir ganz konkret beim Mikrokosmos am Hackenberg. Man kann an allen fünf Fingern abzählen, dass die HackenbergerInnen nicht alle dort bleiben werden. Das könnte man auch als einen Gentrifizierungsprozess im Kleingarten bezeichnen. Das Territorium ist entdeckt worden, die Frage der Investition wird eine andere – ich investiere nicht mehr mein Leben und meine Zeit, sondern ich zahle nur mehr Schulden ab, um dort zu wohnen. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen informeller Bauweise, die sich über ein Leben spannt, und dem Abzahlen von Schulden für ein neu erbautes Einfamilienhaus vom Developer.
Reinhard: Das ist eine interessante Sichtweise, die aber aus stadtplanerischer Sicht keine so große Rolle spielt. Für die Stadtplanung ist es fürs Erste egal, ob dort eine Investorenvilla oder die Do-it-yourself-Baumax-Hütte steht. Im Endeffekt handelt es sich ja in keinem der beiden Fälle um sozial schwache Schichten. Und wenn sie noch richtige KleingärtnerInnen waren, dann betrifft der Verlust „nur“ ihren Zweitwohnsitz – das heißt, es geht um keine Verdrängung vom Wohnstandort.
Elke: Viele von denen, die sich diese Selbstbaumethode über die Jahrzehnte noch leisten konnten, können sich eine Abzahlung nun nicht mehr so einfach leisten. Ich glaube, dass das einen ganz großen Unterschied macht. Aber die Frage bleibt ja trotzdem: Wo siehst du als Planer in einer Stadt, die sich jetzt derart zu verändern beginnt, einen Raum fürs Gärtnern?
Reinhard: Ich bin nicht der Meinung, dass man als Städter Anspruch auf einen Garten hat. Man hat sehr wohl Anspruch auf hohe Wohnqualität, die auch ein Substitut für einen Garten beinhalten sollte, sei es in Form einer Terrasse, einer Gemeinschaftsterrasse vielleicht, eines Balkons oder was auch immer. Und natürlich besteht ein Anspruch auf eine hohe Qualität des öffentlichen Raums, befestigt und grün. Darauf ja, aber auf ein eigenes Stück Wiese? Das geht sich allein rechnerisch nicht aus. Ich sehe darin auch nicht den Sinn einer Großstadt im 21. Jahrhundert angesichts der Bevölkerungsprognosen, die wir haben. Aber natürlich sollten Gärten, die historisch gewachsen sind, vor allem da, wo die Stadt ohnehin an natürliche Grenzen stößt, etwa in Richtung Wienerwald, beibehalten, mitunter sogar geschützt werden.
Elke: Ich glaube, dass das Recht auf ein Einfamilienhaus und das Recht auf Gärtnern zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Ich bin nicht sicher, ob ich dem zustimmen würde, dass man als Städter keinen Anspruch auf das Gärtnerische hat – in dem, was Stadt ist und was Stadt kann.
Reinhard: Das soll und kann Stadt schon ermöglichen, aber ich sehe die zwingende räumliche Koppelung zwischen dem Wohnen und dem Gärtnern nicht. Das kann auch gemeinschaftlich und bzw. oder an anderer Stelle stattfinden. Man könnte in den Außenbereichen zeitlich befristet Gartenland zur Verfügung stellen, dazu gibt es noch genug Flächen! Ganz Rothneusiedl steht sozusagen zur Verfügung.
Sonja: Aber ist nicht das Gärtnern auch ein sehr zeitspezifischer Moment? Der Wunsch zu gärtnern ist ja nicht zu jeder Zeit gleich hoch, oder? Neu ist auch, dass die Leute im Kleingarten immer jünger werden, das zeigen aktuelle Studien.
Elke: Jede Schule macht heute ihre Gartenprojekte. Das ist in der Zwischenzeit fast schon eine pädagogische Kunst geworden, den Garten zu ermöglichen. Es ist ja nicht nur der Ort, an dem gegärtnert wird, sondern es ist auch die Zeit, in der gegärtnert wird.
Reinhard: Also wem das Gärtnern ein so zentraler Lebensinhalt ist, für den stellt sich die Frage, ob er nicht am Land glücklicher wird. Ich denke, dass viele urbane Menschen keinen eigenen Garten brauchen und gern innerhalb der gründerzeitlich strukturierten Stadt leben.
Elke: Ich möchte noch etwas anderes fragen. Du hast am Anfang darüber gesprochen, dass die Kleingärten eine unglaubliche Ressource der Stadt sind. Sie sind großteils erschlossen und waren in einer Hand, sind das jetzt allerdings nicht mehr. Ich glaube, du hattest da etwas anderes im Kopf, als du von Ressource gesprochen hast. Was für eine Ressource ist das für dich? Was hast du da als Planer vor Augen?
Reinhard: Prinzipiell sollte Naturnähe auch in dicht bebauten Stadtteilen möglich sein. Man sollte die Verpflichtung zur Schaffung eines privaten Freiraums in die Wohnbauförderkriterien oder sogar in die Bauordnung hineinschreiben und diesen auch quantifizieren, beispielsweise mit 8 m² pro Haushalt. Das ist keinerlei Widerspruch zu Anforderungen wie Dichte und Urbanität, das sollte im Neubau problemlos möglich sein. Und wenn jeder im Neubau einen Freiraum hat und von den 8 m² dann 2 m² auf einen Pflanzentrog entfallen, dann ist das zumindest ein brauchbares Substitut für ein eigenes Fleckerl Erde zum Gärtnern. Wer mehr will, bemüht sich eben um die knappen Kleingärten am Stadtrand, die dann aber wirklich Kleingärten sein sollen. Und wer keinen bekommt oder noch mehr will, der kann immer noch irgendwo weiter draußen eine ihm entsprechende Wohnform suchen.
Elke: Was würdest du als Planer machen wollen, wenn du könntest?
Reinhard: In Wien fehlen die nötigen Instrumente, um prinzipiell mit Grundeigentum adäquat umzugehen. Andere Bundesländer haben bereits ganz erstaunliche Instrumente der Bodenmobilisierung. Natürlich umfasst das auch die Besteuerung oder Rückwidmung von gewidmetem, aber nicht genutztem Bauland – oder das Recht der öffentlichen Hand, gehortetes Bauland zu einem günstigen Preis anzukaufen. Da hat Wien keinerlei Gesetzgebung. Und bei den großen zusammenhängenden Grünflächen ist es umso wichtiger, dass eigentumsrechtliche oder vielmehr spekulative Aspekte bei entsprechendem Bedarf und standörtlicher Eignung einer geordneten Entwicklung nicht im Wege stehen, um dort effizient Infrastruktur hinlegen und konzertiert Städtebau betreiben zu können, anstatt mal hier, mal da etwas zu bauen.
Elke: Also du würdest diese Flächen für Städtebau nutzen?
Reinhard: Manche der Kleingartenanlagen langfristig ja! Natürlich ist es romantisch, wenn etwa in Tokio inmitten von Hochhäusern noch Reisfelder bestehen, aber für mich ist die Frage wesentlicher, was volkswirtschaftlich und stadtstrukturell sinnvoll ist. In dieser Hinsicht wäre es gut, wenn man besagtes Reisfeld irgendwann einmal einer städtischen Nutzung zuführen könnte.
Sonja: 1987 hat die MA 18 eine Studie herausgegeben, in der die Grünsysteme europäischer Großstädte miteinander verglichen wurden. Wien rühmt sich ja nach wie vor damit, so viele Grünflächen zu haben. Das Interessante war aber, das für die sehr große zweite der drei Zonen (die erste Zone umfasst das Stadtzentrum bis 5 km, die zweite Zone liegt 5 bis 10 km und die dritte Zone mehr als 10 km vom Stadtzentrum entfernt) die Werte sehr schlecht sind, weil es hier nur wenig zusammenhängende Grünflächen gibt. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann hättest du als Stadtplaner kein Problem damit, diese Flächen noch weiter zu reduzieren?
Reinhard: Die Frage für die Stadtplanung ist nicht nur, ob eine Veränderung für das konkrete Gebiet oder das unmittelbare Umfeld ideal ist, sondern ob es der Gesamtstadt oder sogar der ganzen Stadtregion dient. Das Stadtwachstum nicht in dieser von dir angesprochenen zweiten Zone unterzubringen, sondern an Standorten, wo weder die verkehrstechnische Erschließung noch die sonstige Infrastruktur vorhanden sind, hätte aus meiner Sicht wenig Sinn. Da bin ich für den Weg des geringeren Übels. Die langfristige Entwicklung von zentral gelegenen Kleingartenanlagen ist ja auch eine Frage des effizienten Einsatzes knapper öffentlicher Mittel und nicht nur romantisch zu sehen. Leider hat unsere Stadtregierung in den letzten 20 Jahren aber weder nach rationalen noch nach romantischen Gesichtspunkten agiert, sondern einfach nur sehr kurzsichtig. Es geht nicht darum, Grüninseln zuzubetonieren. Wenn man von einem Kleingartengebiet die Hälfte urban bebaut, wohnen in dieser Hälfte fünfmal so viele Leute, wie wenn man die einzelnen Hütten in Einfamilienhäuser umwandelt. Die andere Hälfte könnte man zu einem hochwertigen Freiraum für alle machen. Das wäre dann auch ein attraktiveres und nutzbareres Grünraumangebot für jene, die im Umfeld leben, als der größere vermeintliche Freiraum zuvor, wo man in Wirklichkeit aber bestenfalls durchspazieren konnte und über den privaten Thujenzaun hinweg mal einen Apfelbaum sah. Für mich ist das kein Schreckensszenario, eine rechnerisch, aber nicht funktional bestehende Grünfläche zu reduzieren und in diesem Zuge etwas Sinnvolleres daraus zu machen.
Elke: Das ist qualitativ ein ganz anderer Zugang als das Programm von 1992. Zuerst hatte man ein „koloniales Zeitmodell“, die Schrebergärten wurden auf einen langen Pachtzeitraum vergeben, so wie etwa Hongkong 100 Jahre lang eine britische Kolonie gewesen ist. Außerdem waren die Schrebergärten seit 1922 in der Sozialgesetzgebung verankert. Das Recht auf den Garten war somit Teil des sozialen Denkens des Funktionierens einer Stadt aus der Perspektive ihrer Gesetze. Das Gesetz von 1992 ist also ein Privatisierungsgesetz, kein Sozialgesetz, in dem Sinn, dass man einer Sozietät als Ganzes etwas Gutes tut, sondern es geht um die Stärkung von Privateigentum. Was müsste man jetzt tun, um dort hinzukommen, was du gerade skizziert hast?
Reinhard: Das ist realpolitisch inzwischen nicht mehr rückgängig zu machen. Da müsste man enteignen, deswegen halte ich das Kleingartengesetz von 1992 für ein Kapitalverbrechen. In dem Moment, wo man zusammenhängendes öffentliches Eigentum auf Tausende private Eigentümer aufsplittet, kann man jede weitere geordnete Entwicklung vergessen. Da ist es noch realistischer, dass die Stadtautobahnen in und um Wien einmal abgerissen werden oder nur noch Fahrräder darauf fahren dürfen, als dass in den ehemaligen Kleingärten noch einmal eine konzertierte Stadtentwicklung stattfindet.
Elke: Ich frage mich, was in den – unscharf – letzten zehn Jahren in vielen Städten der Welt passiert ist, wie aufgesetzt auch immer, denn vieles, wie Rooftop-Farming oder Vertical Farming, ist nur Kosmetik, was Versorgungslagen anbelangt. Das kann nie auffangen, was der gleichzeitig vor sich gehende Flächenfraß bewirkt. Wir haben hier ein bestimmtes Versprechen auf etwas, das sich so nicht einlöst. Es ist eine kulturelle Formation geworden, Stadt so zu denken, dass auch das, was man früher dem Land zugeschrieben hat, Teil der Stadt geworden ist. Du hast die Urbanisierung hervorgehoben und ich frage mich, ob das nicht längst Teil dessen geworden ist?
Reinhard: Ich sehe Grün und Beton nicht als Widerspruch. Prinzipiell gibt es wunderbare verdichtete Wohnformen, die stark durchgrünt sind. Ich halte nach wie vor Roland Rainers Gartenstadt für ein perfektes Modell. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man in Aspern bereits in der ersten Phase Großstadt bauen will. Warum wollen wir das über Jahrhunderte erfolgte Wachstum von Stadt, dem wir unsere Urbanität verdanken, nicht einmal an so einem Standort zulassen? Also eine Möglichkeit schaffen, dass sich Stadt wirklich entwickelt, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Das wäre eine spannende Strategie, dort mit einer durchgrünten Stadt zu beginnen, die einige Jahrzehnte so bleiben kann oder auch nicht, auch dichter werden kann. Solange Schrebergärten einfache Schrebergärten sind, brauchen sie keinen Kanal, keine Heizsysteme, keine großen Straßen oder sonstige Infrastrukturen, keine Schulen, Kindergärten, keine Nahversorgung, keine sozialen oder medizinischen Einrichtungen, dann sind sie einfach städtische Formen von Gartenland mit einer kleinen Hütte, sodass man im Sommer auch mal übernachten kann. Bei Bedarf könnte eine solche Fläche in einigen Jahrzehnten sinnvollerweise einer urbanen Stadtentwicklung weichen; und die leicht verlagerbare Funktion Kleingartennutzung – es hängt ja kaum Infrastruktur dran – könnte an einem anderen Teil des Stadtrands angesiedelt werden. Die Ressource, die du meinst, nämlich Gartenland, ist ja im Grunde überall verfügbar. Die Stadt nachhaltig auszubauen, ist hingegen nicht überall machbar, weil es auch um die Verkehrswege und die sonstige Infrastruktur geht. Das heißt, wenn wir Bevölkerungszuwachs wollen, müssen wir uns fragen: Wo ist der optimale Ort dafür? Wenn der optimale Ort einer ist, wo jetzt ein Kleingarten besteht, dann finde ich es vertretbar, den in einer gewissen Fristigkeit woandershin zu verlagern und dort zu bauen. Es geht nicht um das Beschneiden des Rechts oder Anspruchs oder Bedürfnisses nach Gärtnern. Wichtiger ist das Wo beim Wohnen, Arbeiten und Einkaufen und nicht beim Gärtnern.
Elke: Wohin verlagert man das? Was sind die zugrunde gelegten Paradigmen? In Havanna zum Beispiel war das Urban Farming lange eine Form der Krisenbewältigung (kein Öl, keine Schädlingsbekämpfung vorhanden; strenges Embargo von den USA; Absatzmärkte in den Geschwisterstaaten verloren). In der Doktrin der Stadtplanung war das die „Notlösung“. Das Urban Farming war zunächst informell und dann von oben flächendeckend organisiert, es war aber klar, dass es wieder verschwindet, wenn etwas Besseres kommt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis jetzt im Gesetzestext festgeschrieben wurde, dass die Organopónicos selber Teil einer stadtentwicklerischen Perspektive geworden sind. Das finde ich interessant. Wie lange kann es dauern, bis man begreift, dass etwas einen anderen Wert hat, als man ihm vorher beigemessen hat? Aber zurück zu den Kleingärten in Wien – ist nun hier durch die Privatisierung etwas passiert, das die Wertschätzung gegenüber der Ressource untergräbt?
Reinhard: Ja, diese Wertschätzung fehlt bei uns – das stimmt. Aber wenn wir jetzt Havanna außer Acht lassen, dann ist deine Position die einer breiter werdenden Soziogruppe, die das aus Leidenschaft macht und einfach haben möchte. Das ist legitim, aber da sind wir weit weg von einer Notwendigkeit, wie es in Havanna oder auch bei uns vor 100 Jahren der Fall war. Wenn ich es zugespitzt sagen darf: Das ist in Wien eher eine Lifestyle-Geschichte. Das ist zugegeben ein bisschen zynisch. Es ist eine Ausformung von Lebensqualität, die natürlich ihre Berechtigung hat. Aber dem eine breitere Bedeutung beizumessen ... Also dieser substanz- oder gesellschaftserhaltende Aspekt ist für mich beim Gärtnern in unseren Breiten einfach nicht da. Wir essen seit Jahrzehnten schon nicht mehr das, was unmittelbar vor unserer Haustür oder auch nur im Umland unserer Städte wächst.
Elke: Aber es gibt an vielen Orten Versuche, den Grüngürtel rund um die Stadt auch landwirtschaftlich für die lokale Nahversorgung zu nutzen.
Reinhard: Den Grüngürtel gilt es zu schützen, aber man muss auch daran denken, dass die Stadt wächst. Es ist für das Stadtwachstum ja nicht einmal Bevölkerungswachstum an sich notwendig, es genügt die ungebrochene Ausdehnung der Pro-Kopf-Wohnfläche.
Elke: Diesen Anspruch des Einzelnen finde ich sehr schwierig – sich in einer Art und Weise auszudehnen, die eine Gefräßigkeit annimmt und alles das, worüber wir jetzt sprechen, verunmöglicht. Also Freiräume, Grünflächen ...
Reinhard: Österreich hat seit 30 Jahren im Grunde dieselbe Bevölkerungszahl, wir haben allerdings unsere Siedlungsfläche – ich schätze einmal – um ca. 50 % ausgedehnt. Das ist der eigentliche Wahnsinn. Aber da ist kein Stadtplaner in der Lage, das zu ändern. Das ist ein gesellschaftliches Faktum und dem kann man nur gesellschaftspolitisch begegnen. Für gesellschaftlichen Wertewandel ist Stadtplanung nicht zuständig. Da müssen wir auf einer anderen Ebene diskutieren. Aber prinzipiell ist es positiv, dass Leute nicht mehr nur in Suburbia wohnen wollen, sondern wieder in die Stadt zurückkehren, dass die Städte – im Unterschied zu vor 20 Jahren – wieder wachsen. Da ist es mir lieber, wenn das Gärtnern hin und wieder verlagert wird, um die zuziehenden Menschen in urbanen Strukturen unterzubringen. Für mich ist das eine Frage der Abwägung des geringeren Übels.
Elke: Du hast vorhin von einer Halbierung der Fläche gesprochen. Leider ist das ja nur eine Fiktion, weil man nun aufgrund der Privatisierungen nicht mehr hinkommt. Aber dass man die Hälfte eines Kleingartengebietes in etwas verwandelt, was ein wienerisches Organopónicos sein kann und die andere Hälfte mittels Wohnbau verdichtet, klingt sehr interessant. Sonja hat aber richtig angemerkt, dass das genau in der Stadtzone stattfinden würde, die jetzt schon im internationalen Vergleich wenig Grün aufweist, obwohl die Stadt Wien immer dieses Bild der Grünheit vor sich selbst herträgt.
Reinhard: Mir fallen dazu immer die Pläne in der U-Bahn ein, die die unmittelbare Umgebung jeder U-Bahn-Station darstellen, in denen wirklich jede kleinste Verkehrsinsel oder jedes vom Stadtgartenamt gepflegte Tulpenbeet grün eingezeichnet ist – die pure Augenauswischerei. Zu der zweiten Zone, von der du gesprochen hast: Hier finde ich es tatsächlich sinnvoll, dass man verfügbare Ressourcen weiter bebaut. Wenn man vom klassischen Blockrand ausgeht, gibt es bei einer relativ effizienten Verdichtung vier Ebenen, um wertvollen Grünraum oder begrünbaren Freiraum zu schaffen. Das ist einmal der öffentliche Raum draußen vor dem Block, der von den Autos beherrscht wird – was aber nicht sein müsste. Das zweite Potenzial ist der Blockinnenbereich, geschützt, intim – hier sind ganz andere Nutzungsmöglichkeiten vorstellbar. Der Innenhof ist in Wien, leider auch aufgrund des Autos, im Neubau oft nur noch die Begrünung der darunter liegenden Tiefgarage. Das dritte sind die Loggien und Balkone – natürlich wäre hier viel mehr möglich als diese 4 m² kleinen, Satellitenschüssel tragenden Zellen. Und das vierte sind die Dachzonen. So gut wie jedes neue Haus hat ein Flachdach – man müsste dort nicht zwingend ein Penthouse platzieren. In Wien sind vor nicht allzu langer Zeit noch Wohnbauten errichtet worden, wo sich oben der Gemeinschaftsraum oder eine Dachterrasse für alle BewohnerInnen befanden. Ein wunderbares Beispiel ist die Sargfabrik: Was gibt es Schöneres als die Dachgärten dort? Die Sargfabrik zeigt im Grunde auf allen vier Ebenen, die ich jetzt angesprochen habe, was bei einer immensen Dichte trotzdem an Grünraumqualität möglich ist. Solange auf diesen Ebenen so viel unausgereizt bleibt, finde ich es als Stadtplaner eigentlich unverhältnismäßig, die Lösung für das Naturbedürfnis der StädterInnen für möglichst viele im Schrebergarten zu sehen. Es ist eine sehr spezifische Form, die in einer gewissen Quantität angeboten werden sollte, aber es ist vom Platz, vom stadtstrukturellen Gesamtgefüge und auch vom Bodenpreis her unrealistisch, das für Hunderttausende zur Verfügung zu stellen. Und wie schon gesagt: Ich sehe keinen Anspruch eines jeden Städters auf einen Kleingarten. Es gibt andere Formen, und ich glaube, dass die anderen Formen für viele einen ausreichenden Ersatz bilden könnten.
Sonja: Man kann also festhalten, dass auch die „Neue Siedlerbewegung“ auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung ist?
Reinhard: Auf jeden Fall! Das sind ja keine Gärten mehr. In der Luftaufnahme wird deutlich, wie dieses Siedlungsmodell aussieht: das frei stehende Einfamilienhaus und daneben der Swimmingpool. Im Übrigen leidet in den suburbanen Gebieten bereits die Grundwasserqualität darunter, dass jeder dreimal im Jahr das Chlorwasser seines Pools auslässt und in den Boden einbringt.
Sonja: Aber diese „Neue Siedlerbewegung“ scheint ja etwas zu sein, was die Stadt Wien intensiv betreibt.
Reinhard: Ja, seit 20 Jahren schon – im Grunde hat das Bernhard Görg mit „Wohnen im Grünen“ begonnen und Rudolf Schicker mit der „Neuen Siedlerbewegung“ fortgesetzt. Maria Vassilakou hat zumindest schon öffentlich deklariert, die Suburbanisierung innerhalb der Stadtgrenze nicht mehr weiter fortsetzen zu wollen.
Elke: Du hast vorher gesagt, grundsätzlicher Wertewandel ist nicht Aufgabe der StadtplanerInnen. Aber wenn man nun davon ausgeht, dass die Pläne in den U-Bahn-Stationen, die du ins Spiel gebracht hast, grundsätzliche Werthaltungen ausdrücken, heißt das nicht, dass die Stadtplanung sehr wohl zuständig ist für diese Form von quasi kartografischer Evozierung des Glaubens an spezifische Werte?
Reinhard: Zum einen stammen diese Pläne ja nicht von der Stadtplanung. Und zum anderen muss man schon unterscheiden zwischen der Stadtplanung als Apparat, als System, die hierzulande eine politikhörige ist, und der Stadtplanung als Disziplin mit all ihren Grundsätzen und Werthaltungen und Zielen. Das ist ja etwas ganz anderes.
Elke: Aber die politsche Planungshaltung inkorporiert diese Werte sehr wohl als ein Versprechen in ihre Mappings der Stadt, aber im Grunde genommen ist es nur die zugrunde liegende Narration. Man weiß ja nie, woher das kommt, dass dieses Versprechen immer perpetuiert wird. Man liest es, aber real ist es nicht so. Das heißt, die Propaganda war schon sehr stark. Ich glaube, man kann sich aus dieser Planungssicht nicht so leicht herausnehmen und sagen, die kulturellen Haltungen spielen da nicht herein. Man geht davon aus, Wien ist eine grüne Stadt und dann muss man sagen, de facto ist es nicht so. Man sitzt der Verlängerung einer Glaubwürdigkeitsbeschwörung auf.
Reinhard: Das beste Beispiel für diese Verlogenheit ist mein „Lieblingsplatz“ im 16. Bezirk – der Gutraterplatz. An so einem Platz gäbe es in Italien mindestens drei Kaffeehäuser und einfach Raum, eine für alle nutzbare Fläche. Hier ist es schon mal ein halbierter Platz, denn die Straße, auf der auch die Straßenbahnlinie 10 fährt, teilt ihn in zwei Hälften. Diese wären an sich auch noch schöne Plätze, aber wie sehen sie aus? Es gibt einen Gehsteig entlang der platzbildenden Bebauung und den Rest hat man – klassisch für Wien – einen halben Meter hochgepflastert und mit Bodendeckern begrünt, damit die Hunde nicht hineinscheißen. Man hat den Platz also einfach der Öffentlichkeit, jeder Nutzung entzogen, aber er ist rein formal zumindest grün. Das zeigt für mich die Unbeholfenheit und Kulturlosigkeit, die den Umgang mit dieser Stadt kennzeichnen. Und diese Plätze gibt es überall in Wien.
Hintergrund, Mo., 2012.07.30
verknüpfte ZeitschriftenHintergrund 53 Herr und Frau Schreber