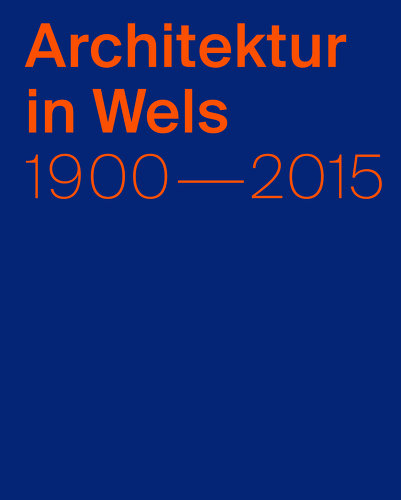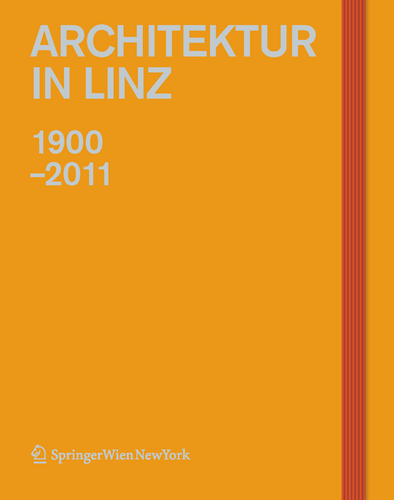„Daidalos“ für gebaute Zukunft in Altmünster, Haid und Feldkirchen
Mit rund 90 hochwertigen Einreichungen hat der von den OÖNachrichten initiierte Architekturpreis Daidalos heuer erneut bewiesen, dass er funktioniert und...
Mit rund 90 hochwertigen Einreichungen hat der von den OÖNachrichten initiierte Architekturpreis Daidalos heuer erneut bewiesen, dass er funktioniert und...
Mit rund 90 hochwertigen Einreichungen hat der von den OÖNachrichten initiierte Architekturpreis Daidalos heuer erneut bewiesen, dass er funktioniert und Sinn macht. Die Vielfalt der Projekte stellt ein umfassendes Abbild der oberösterreichischen Architekturproduktion dar.
Bei der genaueren Begutachtung traten die ursprünglich gewählten Einreichungskategorien Wohn-, Bildungs- und Kommunalbau für die Fachjury aber weitgehend in den Hintergrund. Stattdessen wurden in einem zweitägigen Juryprozess „zukunftsweisende und innovative Lebensorte“ prämiert. Alle drei Preisträger sind Schulen, jedoch weit mehr als normale Bildungsbauten. Gemeinsam haben sie ihren innovativen Charakter. Alle drei bieten Lösungen und Konzepte für unsere Gesellschaft im Wandel.
„Lehrer und Schüler haben mitgefiebert“, sagt die Wiener Architektin Hemma Fasch von Fasch & Fuchs, einem der drei ausgezeichneten Architekturbüros, im Rückblick auf einen jahrelangen Prozess. Die Anstrengungen aller Beteiligten haben sich ausgezahlt beim Schul- und Kulturzentrum in Feldkirchen/Donau. Ähnlich offene Schulen kennt man vor allem aus Skandinavien und Kopenhagen.
Die Entstehungsgeschichte begann 2005 mit der Umsetzung des Kulturzentrums und endet vorläufig mit dem Um- und Zubau für die Schule. In Summe ist eine lebendige Mischung entstanden, die dem 5000-Einwohner-Ort einen neuen Mittelpunkt schenkt. Konsequent nach Prinzipien des offenen Lernens konzipiert, erinnert im ganzen Komplex nichts an eine herkömmliche Schule. Gänge gibt es praktisch nicht. Stattdessen organisiert sich alles um den zentralen, über mehrere Geschoße reichenden Veranstaltungsort. Jeder Unterrichtsraum ist von außen einsehbar. Gegessen wird in der Aula und im Garten.
Dank der Überlagerungen und Offenheit kommt ein Gefühl von Kinder-Uni oder Campus auf. Diese Architektur bietet einen großartigen Rahmen für die neuesten Erkenntnisse der Pädagogik. Hier wurde von allen Beteiligten ein mutiger Schritt nach vorne gemacht.
„Eigentlich wie ein großer Bauernhof“, sagt Architekt Josef Fink spontan zum von ihm entworfenen Agrarbildungszentrum in Altmünster und bringt es in einem Satz auf den Punkt, warum es sich um einen Lebensort handelt: „Hier leben, lernen und arbeiten Schüler und Lehrer unter einem Dach und das in einer Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt“.
Das Architekturbüro Fink Thurnher sitzt in Bregenz, das Ergebnis ist so etwas wie ein Vorarlberger Wissenstransfer. Das Gebäude wurde bereits mehrmals ausgezeichnet: Für seine Nachhaltigkeit, als „Lernwelt“, für die vorbildhafte Bauherrenschaft und nicht zuletzt als Holzbau. 2007 aus einem Wettbewerb hervorgegangen, errichteten die Architekten ein zukunftsweisendes Bauwerk. Der Passivhausstandard und die hohen Anstrengungen um ökologische Kriterien verstehen sich bei den Vorarlbergern fast schon von selbst. Eine Solaranlage auf dem Dach bereitet Warmwasser auf, eine Hackschnitzelanlage spendet Wärme, es gibt eine Photovoltaikanlage, mechanische Be- und Entlüftung gekoppelt mit Wärmerückgewinnung. Gedämmt wurde mit Schafwolle und Zellulose, und für die WC-Spülungen wird Regenwasser verwendet.
Der ganze Bau ist von Holz dominiert. Das kann bald einmal zu viel werden, hier aber nicht, weil die eingesetzte heimische Weißtanne in unterschiedlichsten Formen, hochwertig und meist unbehandelt verarbeitet wurde. Alles wirkt so gar nicht wie in einer Schule, sondern hell, angenehm und wie in einem guten Hotel.
„Es ist von Anfang an ein Miteinander gewesen“, betont der Vorchdorfer Architekt Raimund Dickinger (Dickinger und Ramoni in Vorchdorf und Innsbruck) und fügt noch gleich eine dringende Bitte an Bauherren an: „Lasst’s die Architekten ein bissl galoppieren, dann kommt was Besseres raus.“ Bei der Landwirtschaftlichen Fachschule Ritzlhof in Haid durften sie das offensichtlich.
Herausragende Lernwelt
Diese landwirtschaftliche Schule ist Ausbildungsstätte und zum Teil Wohnort für 600 Schüler. Der bereits mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnete Zubau duckt sich zurückhaltend und elegant ins Gelände. Ein unterirdischer Gang verbindet ihn mit dem denkmalgeschützten Bestand. Ein Atrium und Mehrzwecksaal bilden den zentralen Innenhof. Unterrichtsräume, Bibliothek, Foyer und Garderobe ordnen sich gut übersichtlich drumherum.
Der Sockel ist aus Sichtbeton, alles darüber wurde aus Holz gebaut. Die Erscheinung ist entsprechend filigran und schlicht wie ein Pavillon. Alles ist sehr hell, Farbe wurde in dem von Holz dominierten Bau nur sparsam eingesetzt. Der Ausblick in die Landschaft und umgekehrt die Einblicke in die Schule prägen die Raumstimmung. Insgesamt ist das scheinbar Unmögliche gelungen: Eine herausragende und trotzdem ganz diskrete Lernwelt.
OÖNachrichten, Mo., 2014.12.01
verknüpfte Auszeichnungen
OÖN Daidalos-Architekturpreis 2014