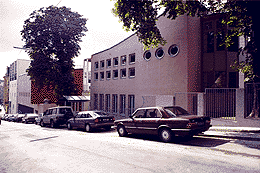1996 drehte der Schauspieler, Regisseur und Autor Paulus Manker die TV-Dokumentation „Alles ist Architektur: Porträt Hans Hollein“, hier bei Aufnahmen vor Holleins Vulkanmuseum in der Auvergne.
1996 drehte der Schauspieler, Regisseur und Autor Paulus Manker die TV-Dokumentation „Alles ist Architektur: Porträt Hans Hollein“, hier bei Aufnahmen vor Holleins Vulkanmuseum in der Auvergne.
Vergangenen Montag wurde Hans Hollein, Architekt, Künstler, Designer und Denker, in Wien zu Grabe getragen. Der Schauspieler Paulus Manker hielt die Abschiedsrede für seinen Freund. Ein Auszug.
Hohe Gitter, Taxushecken, Wappen, nimmermehr vergoldet. Knarrend öffnen sich die Tore. Auf dem glatt geschornen Rasen liegen ziemlich gleiche Schatten. Zweige wölben sich zur Kuppel. Zweige neigen sich zur Nische. Also spielen wir Theater, spielen unsre eignen Stücke, frühgereift und zart und traurig. Die Komödie unsrer Seele, unsres Fühlens heut und gestern. Böser Dinge - hübsche Formel. Manche hören zu, nicht alle, manche träumen, manche lachen. Manche essen Eis. Nelken wiegen sich im Winde, hochgestielte weiße Nelken, wie ein Schwarm von weißen Faltern. Und ein Bologneserhündchen bellt verwundert einen Pfau an.
Das ist ein Gedicht über das Belvedere von Hugo von Hofmannsthal. Das Belvedere - wo Hans Hollein aufgewachsen ist. Gegenüber, an der Ecke zur Prinz-Eugen-Straße. Das Belvedere war sein erstes architektonisches Erlebnis. Kein schlechter Einstieg für ein Architektenleben. Der große Teich hatte es ihm angetan. Warum? Weil unter dem Teich Wiens Funkleitzentrale für die Flugabwehr untergebracht war.
„Wir graben uns auch in die Erde“, lautete einer von Holleins frühen Texten über die Zukunft der Architektur (1965): „Alles, was nicht an der Oberfläche sein muss, kann in der Erde verschwinden, um so kostbares freies Land für die Menschen zu bewahren. So nähern wir uns der Zeit der vollkommen geschlossenen Umgebung, oberirdisch, unterirdisch, ober Wasser und unter Wasser, wie sie heute schon in Polarstationen, künstlichen Inseln im Meer, Flugzeugträgern, vorausgeahnt sind, autarke Einheiten, die überleiten zur Station, zur Stadt im Weltraum. Diese Einheiten werden auch mobil sein können, wir haben das mobile Haus, wir werden mobile Städte haben.“
Was Hollein seit je faszinierte: Die Größe, die Weite, Amerika. Er studierte in Chicago bei Mies van der Rohe und in Berkeley; und er unternahm mehrmals Autofahrten von New York an die Westküste, nur um das für einen Europäer unbekannte Gefühl der grenzenlosen Weite, des stundenlangen Geradeausfahrens zu erleben.
In Europa können Sie nicht sieben Stunden geradeaus fahren, da kommt nach zehn Minuten spätestens eine Kurve, und nach drei Stunden kommt ein anderes Land mit einer anderen Sprache. In Amerika nicht. Die Faszination des Technischen, die Weite, die Weltraumfahrt: Das waren seine Propheten. Als er 1966 für das Kerzengeschäft Retti am Kohlmarkt den amerikanischen Reynolds Award bekam, konnte er sich aussuchen, was er sich in Amerika anschauen wollte. Er wünschte sich Cape Canaveral, die Raketenabschussbasis, dort vor allem das Rocket Assembly Building, den damals größten gebauten Innenraum der Architektur.
Retti war 1965 Holleins erster Auftrag, ein winziges Geschäft auf nur vierzehn Quadratmetern, eine kostbare und präzise Metallschachtel aus Aluminium und Spiegel. Mit Retti schuf er ein gebautes Manifest. Er hat bei der nur drei Meter breiten Fassade die Tür noch einmal fast auf Schlitzbreite verschmälert, so schmal es nur ging, um beim Eintreten in den kleinen Raum doch noch das Gefühl der Öffnung, der Weite zu erzeugen. Er musste das Projekt mehrere Male einreichen, es gab Debatten, ob man es nicht überhaupt ganz abreißen soll - na, Wien eben. Für diesen Laden, der ungefähr 450.000 Schilling Herstellungskosten hatte, bekam er den mit 25.000 Dollar dotierten Reynolds Award. 650.000 Schilling: Mehr als der ganze Retti gekostet hatte. Das überzeugte die Leute: Wenn der Hollein dafür 25.000 Dollar kriegt, na gut, dann lassen wir's stehen.
Neue Schule des Sehens
Als der Mensch sich vom Boden erhob, fing er an zu bauen. Er schichtete ein paar Steine auf. Schlug einen Pfahl ein. Grub ein Loch. Architektur begann. An heiligen Stellen setzte er kultische Zeichen, er baute sakrale Gebilde. Er markierte Brennpunkte menschlicher Aktivitäten. Die Stadt entstand. Stadt ist die ureigenste Schöpfung des Menschen. Sie ist die Verkörperung seines Wollens, seiner Wünsche, seiner geistigen Kraft und Macht. (Hollein 1963)
Die Verbindung von Wohn- und Kultstätten, von oben und unten, ließ in Hollein früh den Wunsch nach einer Architektur wachsen, die durch eine Vielzahl von Wegen, Treppen und Rampen zur Landschaft für alle wird. Er realisierte sich diesen Wunsch 1982 in Mönchengladbach und passte sein Museum für moderne Kunst so präzise in einen Berg ein, dass es wie eine Abfolge geschwungener Reisterrassen aussieht. Dieser Weltklassebau ist eine fließende Folge von Raumerlebnissen, mit Sackgassen und Treppen, Durchblicken und Einblicken.
Hollein wollte keine lineare Aufreihung der Räume, sondern eine Fülle überraschender Rundgänge, die nicht von museumspädagogischen Vorgaben bestimmt sind, sondern frei, anarchisch, fantasievoll. Dieses Plädoyer für eine völlig neue Schule des Sehens begründete eine völlig neue Form von Museumsarchitektur. Hollein wurde dafür mit dem Pritzker-Preis, dem Nobelpreis für Architektur, ausgezeichnet.
Ein kongenialer Mitstreiter wie der Museumsdirektor von Mönchengladbach fehlte ihm beim Guggenheim- Museum in Salzburg. Für seinen Wettbewerbsbeitrag erhielt er 1990 zwar den ersten Platz, aber sein bahnbrechender Entwurf wurde nicht gebaut, er wurde vom Salzburger Landeshauptmann verhindert. Schade. Sträflich. Dieses unterirdische Felsmuseum hätte auch Österreich die Chance gegeben, ein wirkliches Jahrhundertprojekt zu verwirklichen.
Hier fand Hollein erst spät einen Bauherrn, der sich bedingungslos zu ihm bekannte: Bürgermeister Helmut Zilk setzte in der Manier des aufgeklärten Absolutismus das Haas-Haus am Wiener Stephansplatz durch. Bei einer Preisverleihung sagte Hollein einmal: „Danke für die Auszeichnung, aber ich möchte als Architekt nicht nur für das Ansehen Österreichs etwas tun, sondern auch für das Aussehen.“ Beim Haas-Haus ist ihm das wahrlich gelungen.
Traum und Wirklichkeit hieß eine Ausstellung, in der Hollein die Zeit um 1900 zelebrierte. Aber es ist unmöglich, Traum und Wirklichkeit in dieser Stadt zu trennen, Fantasie und Realität als Gegensätze zu sehen. Was ist wirklich? Was ist Traum? Sigmund Freud gibt darauf Antwort - und Hans Hollein. Er entlarvt die Unzuverlässigkeit der Realität. Er verfremdet, täuscht, transformiert, schockiert, verwundet.
2002 baute er in der Auvergne das Vulkanmuseum: ein dramatisch inszenierter Abstieg zum Mittelpunkt der Erde, wie in Dantes Inferno. Wie ein versunkener Ozeanriese gräbt sich das Museum ins Erdinnere, am Fuße des Puy de Dome, auf 1000 Metern Höhe, inmitten erloschener Vulkane. Man steigt 45 Meter hinab in den Abgrund, in unterirdische Zonen, in einen Krater, in den Lavastrom hineingebaut, durch tropische Gärten und vulkanische Untergangsszenarios, um am Ende aus dem Inferno wieder ans Tageslicht zu treten. Indem Hollein mit seinem Gebäude unter die Erde wandert, nähert er sich auch der Zone des Todes an.
Transformationen nannte er Mitte der 1960er-Jahre eine Reihe von Collagen, in denen technische Objekte in die Landschaft montiert wurden. Ein Flugzeugträger etwa, der wie eine utopische Arche Noah in der unberührten Natur gestrandet zu sein schien, als ganze Stadt, ein Rolls-Royce-Kühlergrill oder ein Kaffeeservice, als monumentale Gebäude deklariert. Das Große und das Kleine sind keine Gegensätze mehr, nur Eckpunkte eines unbegrenzten Reichtums an Variationen des Maßstabs.
So einen Flugzeugträger ließ er Mitte der 90er-Jahre in Frankfurt am Main stranden: Sein Museum für Moderne Kunst wirkt, als sei ein Objekt aus seinen Fotomontagen unerklärlicherweise in der Stadt vor Anker gegangen und dringe in Keilform in das urbane Gewebe ein, um ihm eine geistige und visuelle Wunde zuzufügen. Hollein war ein Schamane und todbringender Erzähler, der einschnitt und durchbohrte und sich daran begeisterte, dem Körper der Stadt Dolchstöße zuzufügen.
Gleichzeitig mit den Transformationen befasste er sich mit der Frage autarker Minimalräume und definierte Raumkapseln und Raumanzüge als perfekte Behausungen. Als er auf der Biennale in Paris nur einen Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung bekam, beschloss er: „Ich stelle eine Telefonzelle auf und rüste sie als minimale Behausung aus, ich habe in dieser Zelle die wichtigsten Dinge fürs Leben und Überleben angeordnet. Wenn ich nicht mehr lebe, kann ich diese Zelle als Sarg verwenden.“
Wandler zwischen Welten
Wir müssen die Architektur vom Bauen befreien! war sein Credo. oder Architekten müssen aufhören, nur in Bauwerken zu denken! und Alles ist Architektur - der berühmte Satz von 1967. Hollein war immer Künstler und Architekt, ein Wandler zwischen den Welten. Gebautes sollte ästhetischen, sogar kultischen Ansprüchen genauso genügen wie Gemälde, Skulpturen, Gralskelche oder Monstranzen.
Ich war immer der Meinung, Hollein sollte Mozarts Zauberflöte ausstatten. Aber er machte überhaupt nur einmal, vor fast 35 Jahren ein Bühnenbild, für Schnitzlers Komödie der Verführung am Burgtheater - der Beginn unserer Freundschaft. Viele seiner Bauten sind eigentlich Bühnenbilder von einem Meister der architektonischen Inszenierung. Er führt immer vor Augen, dass es bei Architektur nicht nur um Funktionalität geht, sondern um das sinnliche Verstehen von Räumen, um Farben, Formen, Proportionen, Materialien. Um Fühlen, Hören, Riechen. Im Grunde war Hollein ein Funktionalist. Nur wehrte er sich immer gegen den zu eingeschränkten Funktionalismusbegriff, der sich primär auf physische Phänomene beschränkt und auf quantifizierbare Aspekte des Bauens. Quadratmeter, Lichteinfall, Kubikmeter, Lux, aber keinerlei Rücksichtnahme auf psychologische Erfordernisse, psychische Funktionen. Es geht in der Architektur um das Überleben. Das Überleben während des Lebens und das Überleben nach dem Leben, nach dem Tod. Das waren für ihn die zwei Grundinitiativen, Architektur zu machen: Dass Architektur auf der einen Seite etwas Rituelles, Sakrales ist, auf der anderen Seite ein Mittel zur Erhaltung der Körperwärme. Zwischen diesen zwei Polen entwickelte sich durch Jahrtausende das Bauen zur Architektur.
1972 inszenierte Hollein im Österreichischen Pavillon auf der Venedig-Biennale einen klinisch weißen Raum mit Objektsymbolen für die Stationen des Lebens von der Wiege bis zur Bahre: Werk und Verhalten. Leben und Tod. Alltägliche Situationen. Im Innenraum Bett, Stuhl, Tisch. Durch die enge Pforte in der durchbrochenen Wand ein Holzsteg hinaus zum Kanal. Dort lag, aufgebahrt unter einem weißem Zeltdach, eine verschnürte menschliche Gestalt. Unter diesem Katafalk war ein Floß mit einem leeren weißen Stuhl vor Anker gegangen.
Floß und Pfahlbau bildeten die architektonischen Zeichen für das Ende einer Lebensreise. Der Zugang zwischen Tod und Leben, zwischen Licht und Finsternis ist typisch für alle positiven Riten des Totemismus: Der Tod ist Höhepunkt des Lebens und wird in der Gemeinschaft durch das Opfer und durch das Errichten von Totems wachgehalten. Hans Hollein erschuf neue Kultobjekte: Todessehnsüchte, Todesängste, Todesfreuden. Was die Architektur fast verlernt hat, stellte er neu zur Diskussion: Die Auseinandersetzung mit der Krankheit, der Wunde, dem Tod.
„Aufbauen - und Aushöhlen“: Seit seinem Studienaufenthalt in Chicago war er fasziniert von Wolkenkratzern, vom Errichten von Signalen. Gleichzeitig aber auch vom Eingraben, von der Raumgewinnung im Felsen oder Erdreich. In dieses Erdreich haben wir heute eine Grube gegraben, um Hans Hollein selbst hineinzulegen.
Ich möchte zum Schluss noch einmal auf Hugo von Hofmannsthal kommen. Ich habe das Gedicht ein wenig paraphrasiert. Als Gruß an Hans, als Ausblick, als „Belvedere“, als ein Willkomm in eine andere Welt: Tiefe Gruben, hohe Türme. Häuser, immer mehr vergoldet. Säle neigen sich zur Nische. Banken wölben sich zur Kuppel. Hoch, am Haas-Haus, tönen Geigen und Trompeten, und sie scheinen den Gedanken eines Architekten zu entströmen, der rings schmunzelnd auf dem Dache sitzt - und zeichnet. Schöner Dinge - krasse Formel. Seines Fühlens heut und gestern, die Komödien seiner Seele. Türme wiegen sich im Winde, hoch gestählte gläserne Türme, wie ein Schwarm von weißen Falken. Und Hans Hollein schaut verwundert seine Stadt an.
![]()