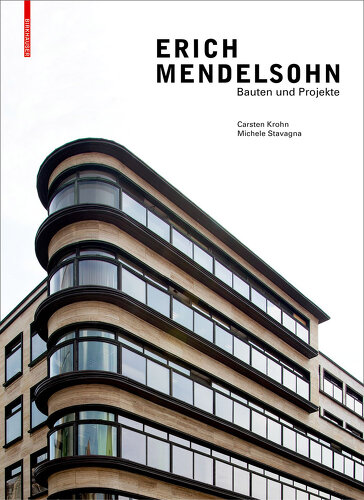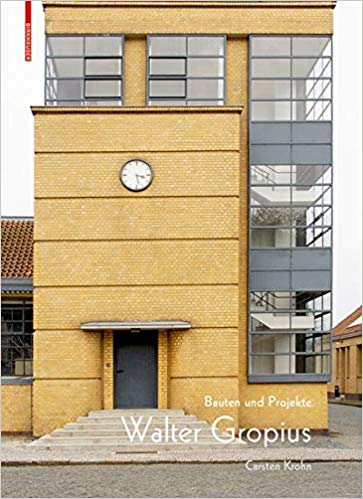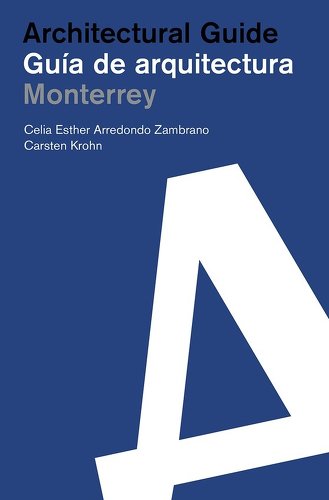Vor einem Jahr, am 4. Juli 2004, wurde der Grundstein zum höchsten Haus auf Ground Zero gelegt. Seither scheint der Wurm in dem von Daniel Libeskind und David Childs geplanten Freedom Tower zu stecken. Nun präsentierten sie einen neuen Entwurf, der einen weiteren Schritt hin zum architektonischen Niedergang markiert.
Vor einem Jahr, am 4. Juli 2004, wurde der Grundstein zum höchsten Haus auf Ground Zero gelegt. Seither scheint der Wurm in dem von Daniel Libeskind und David Childs geplanten Freedom Tower zu stecken. Nun präsentierten sie einen neuen Entwurf, der einen weiteren Schritt hin zum architektonischen Niedergang markiert.
Die Würfel schienen gefallen. Kaum jemand zweifelte mehr an der Realisierung des Freedom Tower, als vor einem Jahr, am 4. Juli 2004, auf Ground Zero der Grundstein für das höchste Gebäude New Yorks gelegt worden war, dessen Planung damals schon eine Milliarde Dollar verschlungen hatte. Wer inzwischen allerdings für den Entwurf verantwortlich zeichnet, ist nicht mehr ganz einfach zu beantworten. Auf der einen Seite wird David Childs genannt, der eine führende Position bei SOM einnimmt, einer gigantischen Architekturfirma mit einer Vielzahl von Projekten in fünfzig Ländern. Auf der anderen Seite steht Daniel Libeskind. Nachdem sein Masterplan für Ground Zero und sein ursprünglicher Entwurf des Freedom Tower 2003 zur Ausführung bestimmt worden waren, verlegte er sein Büro von Berlin nach New York.
Kompromissentwurf
Über den komplexen Entscheidungsprozess, in welcher Form der symbolische Ort, auf dem einst die Twin Towers von Minoru Yamasaki standen, gestaltet werden soll, sind mittlerweile mehrere Bücher verfasst worden - inklusive Libeskinds Autobiografie. Darin beschreibt er, wie er den Ideenwettbewerb gewann: «Das plötzliche Interesse der Medien war einfach überwältigend und die Begeisterung unfassbar. Es war der 27. Februar 2003, und mein Leben hatte sich für immer verändert.» Was dann jedoch folgte, bezeichnet seine Frau, die ihn auch managt, als Krieg. In einer Auseinandersetzung mit Childs, mit dem er schliesslich den Entwurf des Freedom Tower überarbeiten sollte, insistierte er: «Es ist mir wichtig, dass die Spitze eine Form aufweist, die an die Freiheitsstatue erinnert. Und ich will, dass der Turm 1776 Fuss hoch wird, damit das Gebäude für etwas Bedeutungsvolles steht, für die Unabhängigkeitserklärung.» Worauf Childs, laut Libeskind, erwidert habe: «1776 - ein schreckliches Datum! Für mich steht 1776 für eine Kriegserklärung. Und willst du noch was wissen? Ich glaube, deine Besessenheit von der Freiheitsstatue ist eine persönliche Marotte. Ich glaube, das Ganze hat nichts mit Architektur zu tun.» Childs stellte schon damals klar, er würde «die ganze Baustelle übernehmen». Immerhin hatte SOM ursprünglich für den Wiederaufbau einen Direktauftrag von Larry Silverstein erhalten, dem Investor, welcher sechs Wochen vor dem 11. September 2001 das World Trade Center gepachtet hatte.
Der überarbeitete Kompromissentwurf der beiden Rivalen sah schliesslich einen sich nach oben verjüngenden Wolkenkratzer aus Stahl und Glas vor, der nur zu etwa drei Vierteln ausgebaut werden sollte, da Büroräume an diesem Ort ab einer bestimmten Höhe als unvermietbar gelten. So erschien der computersimulierte Turm wie ein nicht ganz gefülltes Gefäss, wobei von Libeskind nur die Idee eines asymmetrischen, bekrönenden Glaszackens übrig blieb. Die «New York Times» spekulierte, dass die gewaltige kristalline Glasspitze möglicherweise nicht ausgeführt werde, da noch nicht alle technischen Probleme gelöst seien. Auch Childs Anteil am Entwurf war nicht unumstritten. So hat ihn ein ehemaliger Student auf Schadenersatz verklagt, da er dessen Entwurf kopiert haben soll.
Libeskinds Masterplan sieht zwar noch weitere Hochhäuser vor, die sich spiralförmig um den Freiraum gruppieren, in den sich zukünftig die Fussabdrücke der alten Zwillingstürme als Mahnmal einprägen sollen. Ein Bedarf für diese Gebäude, für die sich Silverstein die Architekten Norman Foster, Jean Nouvel und Fumihiko Maki wünscht, ist jedoch nicht absehbar. Auch wenn Libeskind euphorisch die Entscheidung für Santiago Calatravas unterirdischen Bahnhof mit seiner leichten, sich wie gefaltete Hände öffnenden Dachkonstruktion (NZZ 6. 2. 04) lobt, schliesst eines der Bücher über die Ground-Zero-Planung mit dem Fazit, dass dieser Entwurf aufgrund seiner Symmetrie Libeskinds Masterplan gestalterisch ruiniere. - Der Stadtplaner Peter Marcuse von der Columbia University setzt in seiner Kritik an Libeskinds Masterplan für Ground Zero grundsätzlicher an. Es handle sich dabei nicht um eine Frage von Architektur, sondern von Programm, bemerkte er, da man eine derart gigantische Masse an Bürofläche nicht anders als unmenschlich planen könne.
Probleme und Projekte
Nachdem die New Yorker Polizei eine Anfälligkeit des Turmes für Autobomben bemerkt hatte, beschlossen der Bürgermeister und der Gouverneur von New York den Planungsstopp. Während potenzielle Mieter absprangen, forderte Donald Trump den Wiederaufbau der zerstörten Zwillingstürme, denn die offizielle Planung sei von «Eierköpfen» entworfener «architektonischer Schrott» (vgl. NZZ 21. 5. 05). Hier stellte sich die Frage, was die gestalterische Kompetenz von Architekten im Tauziehen um finanzielle und politische Interessen noch zählt. Mittlerweile war auch das ursprünglich vom jungen Landschaftsarchitekten Michael Arad geplante Memorial auf Ground Zero durch Unklarheiten, wer es nun planen und ausführen soll, in Gefahr. Die Situation jedenfalls erschien der «New York Times» jüngst so bedrohlich, dass sie erklärte, Ground Zero sei «architektonisch dem Untergang geweiht».
Auch wenn vieles unklar bleibt, scheint doch eines sicher: Es muss möglichst bald gebaut werden, denn Monat für Monat zahlt Silverstein eine Pacht von etwa 10 Millionen Dollar. Deshalb haben sich nun Childs und Libeskind ein weiteres Mal zusammengerauft und am 29. Juni ein neues Modell für den Freedom Tower enthüllt, das mit seinem 60 Meter hohen, mit Stahlplatten verkleideten Sockel aus Beton, der den Turm vor Angriffen schützen soll, noch banaler wirkt als alle vorangegangenen Entwurfsvarianten. Dank einer von Childs nun durchgesetzten Symmetrie erinnert das neue Projekt an einen der beiden Twin Towers, wobei der von Libeskind so sehr geforderte Anklang an die Freiheitsstatue auf eine simple Antennenspitze reduziert wurde. So bleibt von Libeskinds ursprünglicher Vision, die einen asymmetrisch verdrehten Turm über einem parallelogrammförmigen Grundriss vorsah, nur noch die Höhe von 1776 Fuss. Kurz: Der Entwurf wirkt gewöhnlich - erstaunlich gewöhnlich, angesichts der unzähligen Architekturvisionen für diesen Ort. Er markiert eine weiteren Schritt hin zum architektonischen Niedergang.
Neue Zürcher Zeitung, Fr., 2005.07.01
verknüpfte BauwerkeGround Zero - Neubebauung
![]()