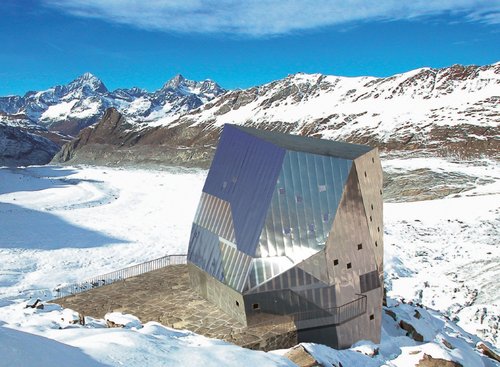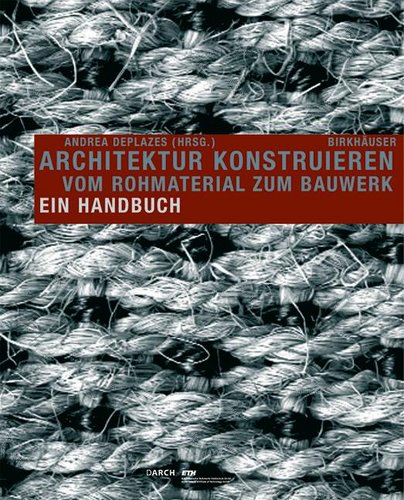Das duale Bildungssystem hat bisher in der Praxis funktioniert. Welche Auswirkungen die Bologna-Reform auf die Ausbildung der Architekten hat und was dies für die Zukunft für die Berufsbefähigung und Registrierung bedeutet, erläutern der Vorsteher des Departements für Architektur an der ETH, Andrea Deplazes, und Sacha Menz, Vorsitzender der Unterrichtskommission D-ARCH. Die Unterschiede zwischen der universitären Lehre und derjenigen der Fachhochschule sollen dabei bestehen bleiben.
Das duale Bildungssystem hat bisher in der Praxis funktioniert. Welche Auswirkungen die Bologna-Reform auf die Ausbildung der Architekten hat und was dies für die Zukunft für die Berufsbefähigung und Registrierung bedeutet, erläutern der Vorsteher des Departements für Architektur an der ETH, Andrea Deplazes, und Sacha Menz, Vorsitzender der Unterrichtskommission D-ARCH. Die Unterschiede zwischen der universitären Lehre und derjenigen der Fachhochschule sollen dabei bestehen bleiben.
Wie haben Sie die Bologna-Reform umgesetzt?
Deplazes: Wir haben das Verdikt der Bologna-Reform dazu genutzt, eine Studienreform durchzuführen. Das hat dazu geführt, dass wir auf ein ‹1+2+2›-Modell umgestellt haben. Das ursprüngliche Studium von vier Jahren, das jetzt insgesamt fünf Jahre dauert, wurde also auf drei Jahre Grundlagenausbildung (Bachelor) komprimiert und mit zwei Jahren Master-Studium (inkl. Thesis-Semester) ergänzt. Das erste Jahr mit dem Grundkurs und die folgenden beiden Jahre Aufbaukurs enthalten alle obligatorischen Fächer und Vorlesungen, obwohl wir überzeugt sind, dass eine vollständige Ausbildung zum Architekten grundsätzlich fünf Jahre dauert. In den ersten drei Jahren müssen die Studenten zusätzlich ein halbes Jahr Praktikum absolvieren. Der Master beinhaltet ein weiteres halbes Jahr Praktikum, ist im Unterschied zum Bachelor aber sehr frei gehalten und mit wenigen obligatorischen Fächern belastet, denn die Idee ist, dass man sich sein Curriculum selbst zusammenstellen kann. Am Schluss bieten wir dann aber einen einheitlichen Master of Architecture and Urban Design an, denn egal, ob sich jemand mehr auf Theorie, Städteplanung oder Technologie stützt, für alle ist der Entwurf obligatorisches und durchgängiges Programm. Die Architekturausbildung ist und bleibt auf das holistische Verständnis der Architektur vom einzelnen Projekt bis zum Städtebau und die Fähigkeit zu konzeptionellem und integrativem Denken und Handeln ausgerichtet.
Was kann der Architekt ETH Bachelor nach seinem Abschluss machen?
Menz: Wir begreifen den Bachelor/Master als ganzheitliches System. Die Basis des Bachelors ist ein interdisziplinäres Arbeiten, was gleichzeitig auch die Stärke der ETH ist, denn wir können ein breites Spektrum an Disziplinen anbieten. Dies ist der wesentliche Unterschied zwischen der universitären Ausbildung und derjenigen der Fachhochschulen. Der zweite Unterschied ist derjenige der Forschung: Es gibt zum einen Grundlagenforschung, wie sie zum Beispiel das ETH-Studio Basel betreibt, und die spezialisierte angewandte Forschung, also zum Beispiel Entwicklung neuer technischer Systeme, die an den Fachhochschulen allerdings auch bearbeitet werden.
Sind bei der Interdisziplinarität die Bauingenieure mitgemeint?
Menz: Das kann man leicht beantworten, auch wenn das alles noch nicht in Stein gemeisselt ist, denn die Qualität einer Schule ist ja auch, dass sie sich wandeln und den veränderten Bedingungen anpassen kann. Momentan ist es so, dass wir Bautechnologie und Bautechnik sowie Konstruktion nahe am Entwurf verankert haben.
Deplazes: Ganz konkret haben wir zwei Tragwerksprofessuren am Institut für Hochbautechnik, wir arbeiten zudem mit dem Institut für Baustoffkunde und Baukonstruktion zusammen, das am Departement der Bauingenieure platziert ist, und über die Bauphysikprofessur haben wir auch die entsprechenden Bereiche an der Empa inne. Das Departement für Architektur
ist eine vielgliedrige Angelegenheit, keine Monokultur. Man kann darum nicht von Spezialistentum sprechen, sondern von der hinreichenden Vollständigkeit...
Was ist der Unterschied zur Accademia di Architettura Mendrisio oder der EPFL?
Deplazes: Warum es drei verschiedene Schulen sind, hat politische und geografische Gründe. Warum wir das tun, was wir tun, hängt damit zusammen, dass unsere Hochschulausrichtung über lange Zeit geprägt und gefestigt wurde. Im Unterschied zu den amerikanischen Hochschulen ist der Architekt noch ein Architekt in der Praxis. In den USA ist er nur noch in der Innenarchitektur tätig. Dort richtet sich das Interesse an den Universitäten folglich dann eher auf die Theorie oder zum Beispiel Computing. Vor diesem Hintergrund sind wir natürlich bestrebt, unsere Position auch international weiter auszubauen. Mit Lausanne verbindet uns die Schwester ETH. Die Architekturabteilung der EPFL, das ENAC, ist in sich jedoch ganz anders gegliedert als das Departement für Architektur. Wir haben eine Kollaboration mit den Ingenieuren, sind aber keine so genannte ‹School›. Beim ENAC, der Abteilung für Architektur, Ingenieur- und Umweltwissenschaften der EPFL, liegen die Gewichtungen anders, dort ist der Ingenieurbereich breiter. Unser Departement, das bis vor kurzem das grösste an der ETHZ war, hat jetzt
rund 1430 Studierende. Das sind fast so viele wie in Lausanne, Mendrisio und allen Architektur-FH zusammengenommen.
Ist denn der Bachelor überall gleich, das heisst ein Übertritt in den Master einer anderen Uni unproblematisch?
Menz: Nein, jede universitäre Schule macht das auf ihre Art und Weise. Dies ist ein grosser Vorteil der Schweiz, denn auf sehr kleinem Raum haben wir drei kulturell unterschiedliche Hochschulen und damit ein anderes Denken. Die Konvention zwischen den Hochschulen ist, dass man zwischen ihnen wechseln kann, man akzeptiert gegenseitig seine Leistungen.
Deplazes: Es ist aber etwas anderes, wenn die Bachelor- Studenten aus dem internationalen Bereich kommen, da ist es entscheidend, welche Akkreditierung die Partnerschule hat. Es wird sicher so sein, dass es, wie teilweise schon bestehend, eine Art ‹idea league› geben wird, in der durch den Austausch und die Erfahrung der Übertritt einfacher sein wird. Schwieriger wird es bei Universitäten, die weniger Profil entwickelt haben und nicht bekannt sind. Da stellt sich dann die Frage, ob die Gleichwertigkeit vorhanden ist. Wenn nicht, werden wir Ergänzungen verlangen. Wir werden dies jedoch im Bachelor verlangen, damit nicht der Master-Kurs blockiert wird, nur weil noch Kurse nachträglich absolviert werden müssen. Das ist eine Sache des Einspielens, denn wir können jetzt viel theoretisieren, aber die ersten Master-Abgänger werden wir erst in drei Jahren haben, wir sind jetzt nämlich im zweiten Jahr Bachelor.
Mit den ETCS-Punkten hat man zwar ein gemeinsames Bewertungssystem, doch es ist wie bei der Währung, zum Beispiel dem Euro, bei der es darum geht, welche Kaufkraft in welchem EU-Staat man damit hat. Das ist ein politisches Problem, denn die Politiker haben dieses Problem so weit gar nicht zu Ende gedacht, das muss jetzt geschehen, und da müssen die Schulen mitreden. Deswegen ist es wichtig, welche Akkreditierungsstellen es gibt. In Deutschland ist zum Beispiel eine offizielle Akkreditierungsstelle benannt worden. Die Frage stellt sich sofort: Inwiefern hat diese zentrale Stelle die Kompetenz zur Beurteilung der Studienqualität im In- und Ausland?
Menz: Der Bachelor ist ein schulischer Abschluss, nicht ein Berufstitel. Wenn man die Schule vorzeitig verlässt, hat man wenigstens einen Schulabschluss. Der MasterAbschluss ist jedoch eine Akkreditierung auf schulischer Ebene. Diejenigen, die den Master-Abschluss haben, müssen beim Eintritt in die Berufslaufbahn unterstützt werden, indem sie sich im Register eintragen lassen können. Heute haben unsere Abgänger, die im Ausland arbeiten wollen, einige Schwierigkeiten zu überwinden. Das REG, Register für Architekten und Ingnieure, soll die Triagenfunktion übernehmen, um die Qualifizierung von Master-Abschlüssen im EU-Raum zu regeln.
Sie sprechen von Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung. Letztere beansprucht auch die FH für sich. Wie sieht die Zukunft aus?
Deplazes: Dass wir jetzt versuchen, Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung zwischen den Unis und den FH aufzuteilen, liegt daran, dass mit der Bologna-Reform etwas aufgebrochen worden ist, das vorher selbstverständlich war. Im Grundsatz ist das unsinnig und nur insofern zu verstehen, als die Profile der Schulen zuhanden der Schulpolitik geklärt sein wollen. Vorher wusste man noch genau, was die HTL sind und können und wollen. Je nach Argumentation hat man das eine oder andere Vorurteil hochstilisiert, beispielsweise dass die ETH-Absolventen kopflastig seien und keinen Nagel einschlagen könnten - Aussagen, die so platt noch nie haltbar waren.
Jetzt sind durch die Struktur des dualen Bildungssystems die Fachhochschulen unter Druck geraten. Bei uns ging es mehr darum, die bestehenden Studiengänge in einem neuen Gefäss zu überprüfen. Die FH werden jedoch plötzlich an Systemen gemessen, die die Universitäten schon lange etabliert haben. Das heisst, sie müssen die Struktur Master/Bachelor einführen, was die Studienzeit an den FH markant verlängert, und gleichzeitig noch forschen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage nach der Grösse der Studiengänge und den Ressourcen, die dafür freigemacht werden können. Daraus ist ein Problem entstanden, das bei den FH zur Flucht in spezifische Profilierungen geführt hat, mit manchmal abenteuerlichen Curricula. Sie sind aus einer Qualitätssituation in eine Unsicherheitssituation geworfen worden. Man muss hier einmal deutlich sagen, dass wenn man das duale Bildungssystem in der Schweiz weiterhin behalten will, man auch die beiden Schultypen sinnvoll weiterentwickeln muss - mit der Betonung auf sinnvoll. Holzschnittartige Lösungen lassen sich zwar prächtig kommunizieren, führen aber voll an den Bedürfnissen der Schulen vorbei. Das duale Bildungssystem will ja den gymnasialen Bildungsweg oder den Weg der Berufslehre und der Fachhochschule fördern.
Daraus folgt aber auch, dass das duale System nicht unterlaufen werden darf, indem die Kreuzung Matura - Bachelor FH - Master ETH zum Programm gemacht wird.
Menz: Warum sollen wir uns künstlich auf einen Bereich beschränken? Es gibt ja die Diskussion, ob die FH eher den Bachelor anbieten sollen und die ETH den Master - wenn man damit die Kompatibilität meint, dann bin ich dagegen, denn damit wären die FH der Vorhof der ETH und das duale Bildungssystem wäre in Frage gestellt. Eine Gefahr wäre, wenn es zu einer Vermischung kommen würde und die Fachhochschulen dazu gedrängt würden, zu Mini-ETH zu werden.
Wenn man die Bürostruktur in der Schweiz anschaut, stellt man fest, dass es ein ausgewogenes Mittel an Mitarbeitern gibt, die einen FH- oder universitären Abschluss haben. Das ist offensichtlich etwas, was in der Praxis sehr geschätzt wird. In Deutschland beispielsweise ist das anders. Hier weichen viele Studierende durch die Zulassungsbedingungen an den
deutschen Universitäten an die FH aus. Die ursprüngliche Idee der FH wird dadurch aufgeweicht. Deswegen braucht es eine klare, aber kluge Differenzierung in der Schweiz.
Deplazes: Was bei den ETH dazukommt, sind die Graduate Schools. Dies wird in Zukunft grösseres Gewicht haben. Die Frage ist hier noch, wann und wie Doktoratsstudierende ihr Studium antreten. Für die FH hingegen wäre es eine grosse Chance, berufsbegleitende Master of Advanced Studies anzubieten, weil hier sowieso eine Spezialisierung stattfindet. Das, was wir in fünf Jahren an Architektur ausbilden können, ist ja nicht das Maximum, sondern das Gegenteil, es ist das minimal Notwendige, um eine Architekturausbildung überhaupt seriös und gerade hinreichend vollständig durchzuführen. Alles, was darüber hinausgeht, muss man im Nachtrag machen. Auch der SIA beispielsweise ist ja an der Frage des Life-long Learning höchst interessiert.
Welche Neuerung gibt es gegenüber früher, oder ist es der alte Wein in neuen Schläuchen?
Deplazes: Wir haben festgestellt, dass in der Praxis die Komplexität der Zusammenarbeit zugenommen hat. Die Studierenden können nicht automatisch das, was sie in den Fachbereichen der Institute in Vorlesungen erwerben, in die eigene Entwurfarbeit einbringen - beziehungsweise weil die Komplexität hoch ist, hat man die Tendenz, die verschiedenen Ebenen zu vereinfachen, indem man weglässt, was man nicht verinnerlicht hat. Wir möchten dem entgegenwirken, weil das interdisziplinäre Verstehen der Zusammenhänge überhaupt eine Voraussetzung für das Entwerfen ist.
Menz: Wir haben deswegen ein Programm ins Leben gerufen: Entwurf mit integrierten Disziplinen (E+I). Ein Entwurfsprofessor, der normalerweise die Semesteraufgabe stellt, muss in Zukunft mit einem oder zwei Fachprofessoren zusammenarbeiten, um bestimmte Schwerpunkte mit in den Entwurf zu integrieren. Wir machen das zwar nicht wie in der Praxis, wo alle möglichen Anliegen auf einen einpreschen, sondern wir versuchen, quasi einen architektonischen Flugsimulator einzubauen, um den Studierenden ein gezieltes Training mit Schwerpunkten anzubieten, wie man mit solchen Fragen umgehen kann. In den ersten sechs Semestern müssen die Studierenden drei integrierte Entwürfe machen, im Master sind dann alle Entwürfe integriert. Das heisst, mindestens eine Disziplin ist zusätzlich dabei. Was wir ausserdem noch hinzugefügt haben, ist das neunte Semester (also das vor dem Masterentwuf) als Schwerpunktsemester. Das könnte dann auch das Sprungbrett in die Graduiertenkollege sein und zu selbstständigeren Arbeiten bzw. mehr freien Semesterarbeiten der Studierenden führen.
Deplazes: Wir wünschen uns am Ende eigentlich gute Autodidakten. Man muss die Studierenden mit Begabung animieren und begeistern. Das geht natürlich nicht bei allen 1430 Studierenden, wenn man es bei der Hälfte schafft, hat man schon viel erreicht.
Was sind die Vor - und Nachteile des neuen Systems?
Deplazes: Die interne Studienreform, die wir im Rahmen des Bologna-Prozesses auslösen konnten, bringt uns letzlich mehr als der eigentliche Bologna-Prozess. In den zwei Bachelor-Jahren haben wir allerdings festgestellt, dass der Druck enorm zugenommen hat. Wir hoffen, dass damit nicht die talentiertesten Studierenden, die vielleicht nicht immer auch die robustesten sind, auf der Strecke bleiben. Wir wollen nicht durch Überforderung demotivieren. Der Vorteil aber ist, dass wir nach drei Jahren Leute mit einer soliden Grundausbildung haben und dass die Master-Studierenden vom universitären Studium profitieren können, denn das war früher nicht so, es war ziemlich verschult. Die Frage ist, ob jemand, der drei Jahre mit Wissen überhäuft wird, nachher mit der Freiheit umgehen und das Gelernte kreativ im Master umsetzen kann.
verknüpfte Zeitschriftentec21 2006|23 Bachelor/Master