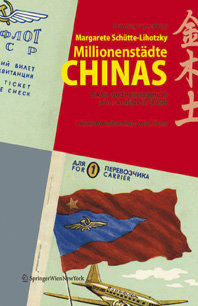Übersicht
Publikationen
Artikel 12
Eine Kämpferin für Freiheit und Komfort
Die Wiener Architektin und Widerstandskämpferin Margarete Schütte-Lihotzky hat mehr geleistet als nur diese eine, verhasste „Frankfurter Küche“ zu bauen. In der Sowjetunion wirkte sie etwa an dutzenden Wohnbauten und auch Stadtplanungskonzepten mit.
Die Wiener Architektin und Widerstandskämpferin Margarete Schütte-Lihotzky hat mehr geleistet als nur diese eine, verhasste „Frankfurter Küche“ zu bauen. In der Sowjetunion wirkte sie etwa an dutzenden Wohnbauten und auch Stadtplanungskonzepten mit.
„Jetzt seien Sie doch bitte nicht albern!“, soll sie mal einen netten Aufseher bei einer Ausstellungseröffnung im Museum für angewandte Kunst abgemahnt haben, als er der mittlerweile weit über 100-Jährigen einen Sessel vor die Füße stellte. „Schaue ich wirklich so alt aus, dass ich die 20 Minuten nicht mehr derstehen kann? Ich bitte Sie, tun sie das weg!“
Margarete Schütte-Lihotzky, 1897 in Wien geboren, ist eine Galionsfigur der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Sie war mit Adolf Loos und Bruno Taut befreundet. Sie plante tausende Wohnungen, entwarf unzählige Wohn- und Einrichtungstypen, arbeitete in Deutschland, in Russland, in der Türkei, in Bulgarien, in den USA und auf Kuba.
Im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen entwickelte Margarete Schütte-Lihotzky, die im Alter von nur 21 Jahren ihren Studienabschluss an der Wiener Kunstgewerbeschule machte, von Anfang an einen intensiven Kontakt zu den Menschen, zum Proletariat.
Kurz nach ihrem Studium fuhr sie nach Holland und betreute dort Wiener Arbeiterkinder, die nach dem Ersten Weltkrieg in der Stille der Deiche Erholung finden sollten. Der Dialog mit dem Gegenüber würde sich durch ihr gesamtes OEuvre ziehen.
Ab 1921 arbeitete sie für die erste gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft der Kriegsinvaliden Österreichs. Sie wirkte unter anderem an der Planung der Reformsiedlung „Eden“ mit und entwickelte in dieser Zeit ein Interesse für die scheinbar kleinen und nichtigen Bereiche des Wohnens. Schütte-Lihotzky entwarf Möbel, beschäftigte sich mit der industriellen Serienproduktion und widmete sich verstärkt jenem Raum der Wohnung, der sie bis an ihr Lebensende klischeehaft verfolgen würde: der Küche.
In ihren Frankfurter Jahren entwickelte sie eine ergonomische Einbauküche der kurzen Wege und wenigen Handgriffe. Rund 10.000-mal wird die von ihr konzipierte Küche im sozialen Massenwohnbau Frankfurts eingebaut. „Ewig Küchen, die sind mir schon beim Hals herausgehangen!“, erzählte sie später einmal in einem TV-Interview.
Zeit in der Sowjetunion
1927 heiratete sie ihren Frankfurter Architekturkollegen Wilhelm Schütte, mit dem sie in die Sowjetunion auswandert und dort dutzende Wohnbauten und Kindereinrichtungen plant, ja sogar Stadtplanungskonzepte für Nowosibirsk, Magnitogorsk und Moskau entwickelt.
Und dann der Zweite Weltkrieg. Nachdem die Kommunistin und brennende Widerstandskämpferin nur knapp der Todesstrafe entging, landete sie 1941 im Frauenzuchthaus Aichach.
Nie wieder sollte es ihr gelingen, in Österreich Fuß zu fassen; nicht als ehemaliges Mitglied der KPÖ. Erneut verließ sie Wien, floh ins Ausland, nach Sofia, Peking, New York, Havanna, Berlin. Erst in den späten 1960er-Jahren kehrte die Pensionistin wieder zurück zu ihren Wurzeln, suchte sich eine kleine Wohnung im fünften Bezirk und blieb dort bis zu ihrem Lebensende. Erst im hohen Alter wurde der großen Tochter öffentlicher Respekt zuteil.
Küchenexplosion
Wenige Monate vor ihrem Tod lud Schütte-Lihotzky eine Gruppe von Schüler(inne)n und Studierenden zu sich nach Hause, um aus ihrem Leben zu erzählen. Vorsichtig wagte der Autor dieser Zeilen die Frage, wie es denn sei, als Architektin immer nur auf ein einziges Projekt reduziert zu werden. Weit kam er nicht. Kaum waren die beiden Worte „Frankfurter“ und „Küche“ gefallen, explodierte die 103-Jährige und schlug ihm um die Ohren: „Ich habe in meinem Leben sehr viel mehr gemacht als nur das. Wenn ich gewusst hätte, dass alle immer nur davon reden, hätte ich diese verdammte Küche nie gebaut!“
„Sie waren so elegant“
Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). Eine der bedeutendsten Architektinnen des 20. Jahrhunderts hat mit Adolf Loos zusammengearbeitet, im Widerstand gegen Hitler gekämpft und ist zeitlebens Kommunistin geblieben.
Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). Eine der bedeutendsten Architektinnen des 20. Jahrhunderts hat mit Adolf Loos zusammengearbeitet, im Widerstand gegen Hitler gekämpft und ist zeitlebens Kommunistin geblieben.
Eine fensterlose, aus Fichtenbrettern gezimmerte Bude steht im 20er Haus. Die Installation „Oktober 1810 ...“ ist der Beitrag von Christine und Irene Hohenbüchler für die Ausstellung „Aspekte/Positionen“. Drinnen, an den Wänden der rätselhaften Holzhütte, sind beschriftete Blätter angebracht, die an die Bedeutung des Widerstandes gegen den Austrofaschismus und den Nationalsozialismus erinnern. Auf einem der Blätter ist zu lesen: „1941: 22 Jänner. Margarete Schütte-Lihotzky und Erwin Putschmann werden zusammen in einem Wiener Cafe verhaftet. Die Verhaftung löste eine 9 Monate dauernde Welle von Polizeirazzien und Festnahmen aus. 536 Verdächtige werden gefangen.“
Das Kaffeehaus Viktoria am Schwarzenbergplatz, in dem Putschmann und Schütte-Lihotzky verhaftet wurden, gibt es nicht mehr. Der Gestapospitzel, der die Verhaftungswelle auslöste, hieß mit Decknamen „Ossi“. Dass er es war, der die KP-Gruppe verraten hatte, erfuhr Schütte-Lihotzky in der Untersuchungshaft auf eine bemerkenswerte Weise: Die Mitteilung war in die Aluminiumbecher eingeritzt, mit denen die Gefangenen in den Einzelzellen mit Trinkwasser versorgt wurden - eine Nachricht, die bei den Gestapoverhören einen lebensrettenden Vorteil brachte. Vielleicht war es dieser Information zu verdanken, dass Margarete Schütte-Lihotzky, die mit der Todesstrafe rechnete, bloß zu 15 Jahren Kerker verurteilt wurde.
15 Jahre Kerker für 25 Tage im Widerstand - nur so lange hatte sich die Architektin nach ihrer Rückkehr aus dem türkischen Exil im nationalsozialistischen Österreich aufgehalten. In ihrem 1994 erschienenen Buch „Erinnerungen aus dem Widerstand“ beschreibt sie die folgende Szene: Unterwegs im grünen Heinrich fragte sie der Gerichtsaufseher Steiner, wo ihr Prozess stattfinde. „Berliner Volksgericht, zweiter Senat“, antwortete Schütte-Lihotzky. „O je!“, seufzte Steiner und versuchte sie gleich zu trösten, indem er ihr den Hinrichtungsvorgang schilderte: „Das Ganze dauert nur sieben Sekunden. Nach dem Krieg kriegen Sie dann ein Denkmal.“ In der Nacht vor ihrem Prozess, am 22. September 1942, stellte Schütte-Lihotzky aus Papierstücken Lockenwickler her, um ihre Frisur herzurichten und dem Blutrichter auch durch ihr Äußeres zu zeigen, dass es der Gestapo nicht gelungen war, sie zu brechen. Als Margarete Schütte-Lihotzky 1997 von Manfred Nehrer, dem Künstlerhaus-Präsidenten, gefragt wurde, was sie sich zum hundertsten Geburtstag wünsche, antwortete sie: „Ein schönes Kleid.“
Als ich Margarete Schütte-Lihotzky kennen gelernt habe - das war 1978 -, war sie in Österreich noch eine Persona non grata. Der Grund: Sie war Kommunistin geblieben, sogar eine aktive. Wer ihr Buch liest, ihre Erinnerungen an die zahlreichen Mithäftlinge und hingerichteten Freunde, dem wird es kaum schwer fallen, dies zu begreifen. Harald Sterk, Kunstkritiker der Arbeiterzeitung, für die ich damals kleine Ausstellungsberichte zu schreiben begann, fragte mich einmal, ob ich nicht mit ihm Grete Lihotzky besuchen möchte, zu der er gerade gehen wollte. Frau Schütte-Lihotzky war sehr freundlich, mehr an uns als an unseren Fragen interessiert. Es war ein seltsames Gefühl, mit einer Architektin zu sprechen, die Adolf Loos, Josef Frank, Ernst May, Le Corbusier, Bruno Taut und viele andere Heroen der klassischen Moderne persönlich kannte. Nur: Über sie wollte sie nicht sprechen. Sie wollte über Herbert Eichholzer sprechen, den talentierten Architekten aus Graz, der ebenfalls aus der Türkei nach Österreich zurückgekehrt und 1943 hingerichtet worden war. Für ihn wollte sie Anerkennung erreichen.
Gern sprach Schütte-Lihotzky über die Architektur in der Sowjetunion, ungern hingegen über die politische Situation dort. Das Scheitern der radikalen architektonischen Moderne, wie sie die Entscheidung Stalins, den Formalismus zu verbieten und einzig den sozialistischen Realismus zu erlauben, umschrieb, hielt sie für unabdingbar. Für den Erfolg des Konstruktivismus hätten noch viele Voraussetzungen gefehlt, vor allem die bevorzugten Baustoffe Eisen und Glas. Ähnlich wie der aus dem Exil nach Wien zurückgekehrte Architekt Ernst A. Plischke war auch Schütte-Lihotzky darüber verbittert, dass sie, von einigen Ausnahmen abgesehen, von der sozialistischen Wiener Stadtverwaltung keine Bauaufträge erhielt. Ganz im Unterschied zu den ehemaligen NS-Architekten, die - wie etwa Franz Schuster - mit Aufträgen und Ehren überhäuft wurden. Wohl aus diesem Grund sprach sie über ihre Wiener Jahre nicht gern. Man hatte sie boykottiert.
Ich war dabei, als Margarete Schütte-Lihotzky das nach ihrem Entwurf 1932 errichtete Doppelhaus in der Wiener Werkbundsiedlung zum ersten Mal in ihrem Leben sah. Aus irgendeinem Grund, vielleicht wegen meines böhmisch-kommunistischen Akzents, vielleicht, weil ich Emigrant war, mochte sie mich. Während unseres dritten oder vierten Besuchs in ihrer Wohnung in der Franzensgasse passierte etwas, was Sterk überraschte: Frau Lihotzky stimmte meinem Vorschlag zu, mit uns nach Lainz zu fahren und die Siedlung in der Hermesstraße, die sie gemeinsam mit Adolf Loos 1922 entworfen hatte, zu besichtigen. Ich holte das Auto, und wir fuhren gleich hin. Unterwegs schlug ich vor, wir könnten, weil es am Weg lag, die Werkbundsiedlung besichtigen. Gute Idee, sagte Frau Lihotzky, sie hätte die Siedlung noch nie gesehen. Als ich sie auf ihr Doppelhaus ansprach, erzählte sie, dass sie die Pläne aus Moskau geschickt hatte, wohin sie mit der ganzen Architektengruppe um Ernst May aus Frankfurt am Main 1930 übersiedelt war. Nach dem Krieg, als sie nach der Befreiung aus dem Kerker im bayerischen Aichach zurück nach Wien gekommen war, hatte sie andere Sorgen.
In der Werkbundsiedlung, in der Woinovichgasse 2-4, trafen wir eine Bewohnerin, die uns ihr Haus bereitwillig zeigte. Jetzt würde sie es auch nicht anders machen, sagte Frau Lihotzky nach der Besichtigung. In der Hermessiedlung beim Lainzer Tiergarten, die sie 1922 gemeinsam mit Adolf Loos entworfen hatte, hatten wir wieder Glück. Wir fanden ein Haus, das Einzige übrigens, das noch weitgehend im Originalzustand erhalten geblieben war.
Mit der Frau, die das Haus mit ihrem Mann selbst errichtet hatte, entwickelte sich ein überaus interessantes Gespräch über zwei Fehlgriffe des genialen Architekten Adolf Loos. Die eine betraf die Stiege zum Schlafzimmer im Dachgeschoss. Loos bestand darauf, die Stiege vom Vorzimmer in das Wohnzimmer zu verlegen. Mit dem Resultat, dass die Bewohner die Stiege mit Brettern zunageln mussten, damit die überaus kostbare Wärme des einzigen Ofens im Wohnzimmer nicht ins Schlafzimmer unter dem Dach auswich. Die zweite Fehlplanung war das Doppelfenster aus Eisenprofilrahmen, das bis auf einen kleinen Ausschnitt nicht geöffnet werden konnte und das fest verglast wurde, so dass die mit der Zeit innen schmutzig gewordenen Scheiben bis zum damaligen Tag nicht geputzt werden konnten.
Dann sagte die Siedlerin, die etwa so alt war - um die achtzig - wie die Architektin: „Ich kann mich an Sie gut erinnern, Frau Baumeister. Und an Herrn Loos auch. Sie waren beide so elegant.“ Frau Lihotzky antwortete: „Jetzt sind wir beide elegant.“ Und was das Fenster anlange, bald würde sie Loos wieder treffen und es mit ihm besprechen. Ich war dabei und hatte kein Tonaufnahmegerät mit.
Architektin eines Jahrhunderts
Am Leitgedanken der Moderne, durch Bauen eine bessere Welt zu schaffen, hat Margarete Schütte-Lihotzky stets festgehalten und bis zuletzt an ihren Ideen...
Am Leitgedanken der Moderne, durch Bauen eine bessere Welt zu schaffen, hat Margarete Schütte-Lihotzky stets festgehalten und bis zuletzt an ihren Ideen...
Am Leitgedanken der Moderne, durch Bauen eine bessere Welt zu schaffen, hat Margarete Schütte-Lihotzky stets festgehalten und bis zuletzt an ihren Ideen weitergearbeitet. Am vergangenen Dienstag, dem 18. Januar, ist die Zeitzeugin der Moderne in Wien kurz vor ihrem 103. Geburtstag gestorben. Die am 23. Januar 1897 geborene Tochter eines Wiener Staatsbeamten schloss 1920 ihr Architekturstudium an der k. u. k. Kunstgewerbeschule - der heutigen Hochschule für angewandte Kunst - als erste Architektin Österreichs bei Oskar Strnad ab. Ihr Interesse für Wohnsiedlungen bewies sie gleich darauf in einem Wettbewerb für eine Schrebergartenanlage am Wiener Schafberg. Adolf Loos wurde auf sie aufmerksam und ermutigte sie zur Mitarbeit im Planungsbüro des Österreichischen Verbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen. Erste standardisierte Kernhaustypen für Siedler entstanden hier, die seriell produziert und individuell erweitert werden konnten. Das Wohnen und die Rationalisierung der Hauswirtschaft wurden zu zentralen Themen in ihrem Schaffen.
In Frankfurt am Main, damals ein Zentrum des funktionalen Städtebaus, hatte sie sich ab 1926 im Team des Baurats Ernst May im Hochbauamt mit Typengrundrissen für die Wohnungen des neuen Frankfurt befasst. Sie entwickelte die «Frankfurter Küche» als ein nach detailgenau bemessenen Arbeitsabläufen konzipiertes Haushaltssystem, das die Trennung der Funktionen in die Innenraumgestaltung hinein fortsetzt. Als 1927 auf der Werkbundausstellung in Stuttgart-Weissenhof ein Plattenwohnhaus des Hochbauamtes mit einer solchen Küche ausgestattet wurde, erregte dies international Aufsehen. Erstmals wurde die Hausarbeit von einer Frau neu definiert, die Küche als Teil einer geschickten Wohnungsplanung begriffen, die die Frau weitmöglichst von der Hausarbeit entlasten sollte. Auf der CIAM-Ausstellung «Die Wohnung für das Existenzminimum» 1929 in Frankfurt zeigte sie Lösungen für Kleinstwohnungen im Reihenhaus und schlug alternativ zu den von der Stadt Frankfurt vorgesehenen Ledigenheimen Einliegerwohnungen für alleinstehende Frauen in den Siedlungen vor, um Frauen nicht zu isolieren. Eine Zentralwäscherei wurde nach ihrem Entwurf in Praunheim, Kojenschulküchen in 14 Berufsschulen realisiert. An der Werkbundausstellung in Wien beteiligte sie sich 1930 mit zwei «Typenhäusern kleinster Art».
Im gleichen Jahr ging sie mit Wilhelm Schütte, mit dem sie seit 1927 verheiratet war, und anderen Architekten des Neuen Bauens in die Sowjetunion, um am Aufbau der neuen Industriestädte in Sibirien mitzuwirken. Die Frankfurter Küche war für die dort geplanten Wohnungen vorgesehen. Forthin widmete sich die Architektin dem Bauen im pädagogischen Kontext, entwarf Kindereinrichtungen für Magnitogorsk und Schulen für Makeewka in der Ukraine. 1936 musste sie angesichts der Stalinschen Säuberungsaktionen gegen Ausländer Russland verlassen und kam über Umwege nach Istanbul, wo Bruno Taut ihr eine Stelle in der Akademie der schönen Künste vermittelt hatte. Sie begann für den österreichischen Widerstand zu arbeiten, trat 1939 der damals illegalen KP bei und wurde während einer geheimen Mission in Wien 1941 an die Gestapo verraten und als kommunistische Widerstandskämpferin zum Tode verurteilt. Durch einige glückliche Umstände und den Einsatz ihres Mannes von der Türkei aus konnte ihre Haftstrafe auf 15 Jahre Zuchthaus reduziert werden. In ihren Memoiren, die sie 1985 unter dem Titel «Erinnerungen aus dem Widerstand 1938-1945» veröffentlichte, macht sie auf die Existenz des österreichischen Widerstands aufmerksam.
Für die Architekturabteilung des Stadtbaudirektors von Sofia erarbeitete sie 1946 eine «Entwurfslehre für Kindergärten und Kinderkrippen» und baute auf dieser Grundlage Kinderanstalten in Maitschin Dom, Rassanska und Samokov - die ersten überhaupt in Bulgarien. Nur zwei Aufträge erhielt die erfahrene Spezialistin für Kinderbauten nach ihrer Rückkehr 1948 nach Wien von offizieller Seite - die Planung eines Kindergartens am Kapaunplatz (1950-52) und eines Kindertagesheims in der Rinnböckstrasse (1961-63). Die Gründe sind in ihrer Mitgliedschaft in der KP und anderen linken Institutionen zu sehen, was in der Zeit des kalten Krieges ihre berufliche Karriere nicht unbedingt förderte. Öffentliche Aufträge erhielt sie aus China, aus Kuba, wo sie für die Unterrichtsministerien als Beraterin für Kinderbauten tätig war. Sie baute nach 1945 zusammen mit Wilhelm Schütte eine österreichische CIAM-Gruppe auf. Gemeinsam mit ihm realisierte sie zwei Wohnanlagen und 1953-56 als letztes gemeinsames Projekt das Druckerei- und Redaktionsgebäude des Globusverlages in Wien. Für die Bauakademie der DDR überarbeitete sie 1966 ein Baukastensystem für Kindergärten, das allerdings nicht ausgeführt wurde.
Die Ehrungen in ihrer Heimat kamen spät: 1980 mit dem Preis des Jahres für Architektur der Stadt Wien, 1989 mit der Ehrendoktorwürde der TU Graz. Den Österreichischen Staatspreis für Wissenschaft und Kunst lehnt sie 1988 ab, weil er ihr vom damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim verliehen worden wäre. Die IKEA- Stiftung würdigt 1989 ihre Pionierleistungen in Einrichtungsfragen, denn es war ihr 1920 aufgestellter Plan einer «Warentreuhand» zur Versorgung der Siedler mit erschwinglichen Möbeln, der nach 1945 der schwedischen Firma als Vorbild diente. Auch andere ihrer Entwicklungen wurden inzwischen Allgemeingut: etwa die Pavillonkonzeption im Kindergartenbereich oder die Einbauküche, die auf ihre Entwürfe der «Frankfurter Küche» zurückgeht. Darüber hinaus sind ihre Überlegungen und Forderungen, besonders im Hinblick auf die berufstätige Frau, bis heute aktuell geblieben.
Bauen für ein ganzes Jahrhundert
Sie hat bei Adolf Loos studiert und eine weltberühmte Küche entworfen.
Sie hat bei Adolf Loos studiert und eine weltberühmte Küche entworfen.
Sie hat den Nazis Widerstand geleistet und ist von der jungen Republik als Kommunistin geächtet worden. Sie ist beinahe 103 Jahre alt geworden und erst am Ende ihres Lebens wiederentdeckt worden. Wer wird schon über hundert?
Margarete Schütte-Lihotzky starb am Dienstag an den Folgen einer Grippe.
Bauen für die Unterprivilegierten
Margarete Schütte-Lihotzky zählte zu den Unbequemen in diesem Land. Sie hat sogar ihren konsequenten Weg des Nonkonformismus perfektioniert. Am 23. Jänner...
Margarete Schütte-Lihotzky zählte zu den Unbequemen in diesem Land. Sie hat sogar ihren konsequenten Weg des Nonkonformismus perfektioniert. Am 23. Jänner...
Margarete Schütte-Lihotzky zählte zu den Unbequemen in diesem Land. Sie hat sogar ihren konsequenten Weg des Nonkonformismus perfektioniert. Am 23. Jänner 1897 geboren war sie die erste Absolventin der Architekturklasse an der Wiener Kunstgewerbeschule unter Oskar Strnad. Als Architektin - nicht als Architekt, wie sie selbst stets betonte - hat sie sich Zeit ihres Lebens theoretisch und praktisch mit dem Bauen für die weniger privilegierten Schichten beschäftigt. Und als KPÖ-Aktivistin hat sie gegen alle Spielarten des Faschismus gekämpft, wobei sie im Dritten Reich nur knapp der Ermordung entgangen ist.
Mit einer solchen Haltung gegenüber dem Leben und dem Bauen war es kein Wunder, dass die gebürtige Wienerin erst spät jene Anerkennung gefunden hat, die ihr im internationalen Rahmen zustand. Erst 1993 wurde ihr im Museum für Angewandte Kunst eine erste Werkschau gewidmet und dort wurde auch die „Frankfurter Küche“ rekonstruiert, welche Schütte-Lihotzky für die Siedlungen der Main-Metropole in den 20er Jahren entworfen hatte.
Friedrich Achleitner hat Schüttes Hinwendung zum Bauen einmal als „ethischen Realismus“ bezeichnet. Realistisch war die Methode der Erfassung der Bedürfnisse der Benützer ihrer Bauten, ethisch war ihre Einstellung gegenüber dem Planungsziel. Denn die Brecht'sche Frage nach dem „Wem nützt die Architektur“ hat Schütte-Lihotzky mit ihrem Gesamtwerk klar beantwortet: den betroffenen Menschen.
Das Besondere der Architektur von Margarete Schütte-Lihotzky lag im präzisen, aber auch subjektiven Entwerfen für Menschen, getragen von einem ausgeprägten sozialem Gewissen. Damit unterschied sich Schütte von den Vertretern einer funktionalistischen Moderne, die eine Auflösung der Architektur in der Synthese aller Naturwissenschaften verfolgten. Darüber hinaus war ihr der Geltungsdrang und das Glamour-Design einiger Star-Architekten vollkommen fremd.
Der aufklärerische Glaube an die Fähigkeit des Individuums, die Welt zu verändern, hat sie ihr Leben lang begleitet und ihren Lebensweg bestimmt. Nachdem im Deutschland des aufkeimenden Faschismus das Arbeiten immer schwieriger, folgte sie dem Frankfurter Planungsstadtrat Ernst May ins Kurzzeit-Hoffnungsland der Modernen Architektur, in die Sowjetunion, wo ihre Kindergärten - eine wichtige Bauaufgabe für Schütte - durch den Krieg zerstört wurden.
1938 ging sie dann auf Anregung von Bruno Taut an die Bauakademie in Istanbul, wo sie für die illegale KPÖ tätig wird. Im Dezember 1940 reist sie nach Wien, um mit dem österreichischen Widerstand Kontakt aufzunehmen, wird aber verraten und verbringt die Jahre bis Kriegsende in einem bayrischen Gefängnis, wo sie von den Amerikanern befreit wird.
Wieder in Wien hatte sie im Klima des Kalten Krieges kaum Chancen Bauaufträge zu erhalten. Sie engagiert sich für die CIAM, jener Vereinigung der wiederstarkten Moderne, und kann dann für die KPÖ am Höchstädtplatz einen heute zerstörten Teil des Globus-Verlagshauses realisieren.
Kleine Aufträge für Kindergärten der Gemeinde Wien folgen, wobei sie ihr Pavillon-System verwirklichte. Eine letzte Miniatur ihrer architektonischen Fähigkeiten skizzierte sie in ihrer Wohnung in der Wiener Franzensgasse, die auf kleinster Fläche räumlichen und sinnlichen Reichtum ausstrahlte, den kaum ein Besucher vergessen konnte. Österreichs erste Architektin erlag fünf Tage vor ihrem 103. Geburtstag einem Herzversagen.
Die Doyenne ist tot
Grete Schütte-Lihotzky, Österreichs Pionierin der sozialen Architektur, ist kurz vor dem 103. Geburtstag gestorben.
Grete Schütte-Lihotzky, Österreichs Pionierin der sozialen Architektur, ist kurz vor dem 103. Geburtstag gestorben.
Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Die Presse“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()