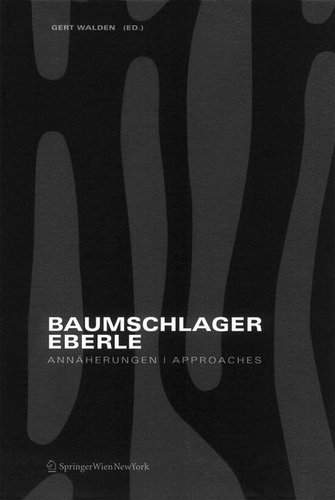Büroräume sind mehr als nur banale Gehäuse für den Arbeitsalltag. Sie schaffen jene Atmosphäre, in der sich Kreativität entfaltet und Leistungs- fähigkeit gesteigert wird. Voraussetzung: das Engagement von Architekten und Bauherren. Ein österreichisches Kaleidoskop von Gert Walden
Büroräume sind mehr als nur banale Gehäuse für den Arbeitsalltag. Sie schaffen jene Atmosphäre, in der sich Kreativität entfaltet und Leistungs- fähigkeit gesteigert wird. Voraussetzung: das Engagement von Architekten und Bauherren. Ein österreichisches Kaleidoskop von Gert Walden
Aus der Not eine Tugend machen, zählt zu den Herausforderungen, denen sich in Österreich viele Architekten stellen müssen.
Ein sanierungsbedürftiger Bürobau aus der Wirtschaftswunder-Ära und die aktuellen Wiener Brandschutzbestimmungen waren für Elsa Prochazka Voraussetzungen, die sie zur einer eleganten architektonischen Lösung inspiriert haben. Die alten Stahlträger wurden mit feuerhemmenden „Packungen“ verkleidet, welche das Innere orchestrieren.
Mit diesen Bauelementen wird die Beleuchtung der Computerarbeitsplätze gesteuert: für ausreichende Helligkeit sorgt das Oberlicht, für genügend Schatten sorgen eben jene Gipskartonverkleidungen der Stahlträger. Das sinnvolle Spiel mit den plastischen Wandteilen erlaubt auch eine präzise Lichtführung - je nach Himmelsrichtung - in den unterschiedlichen Büroräumen.
Auftraggeber: Coca Cola,
Wien, Triester Straße 91, 1998/1999
Architektin: Elsa Prochazka, Wien Foto: Spiluttini
Die jungen Architekten Susanna Wagner und Andreas Lichtblau haben im kleinen Gleisdorf ein kleines
Bürogebäude realisiert. Und dennoch ist mit Hilfe ihres Konzepts ein großes, ein Qualitätsprodukt entstanden. Das Gebäude weist gegenüber konventionellen Häusern eine Energieersparnis von 75 Prozent auf, ohne jedoch wie eine düstere Dämmstoffbox zu erscheinen.
Im Gegenteil: mit den großflächigen Glasfassaden erhalten die Mitarbeiter Ausblick auf die angenehme Umgebung. Der flexible Grundriss bietet außerdem die Möglichkeit, große Räume, Einzelzimmer und natürlich das Chefbüro zu disponieren. Anstelle des architektonischen Purismus wird hier auch das Wertvolle des verwendeten Materials und damit die Bedeutung der Räume für die Benützer hervorgehoben. Seidig glänzende Spachtelmasse, Beton und Glas müssen nämlich kein Gegensatz sein.
Auftraggeber: Wirtschaftstreuhand KG Pilz & Rath, Gleisdorf, Steiermark 1998
Architekten: Susanna Wagner und Andreas Lichtblau, Wien Foto: Margherita Spiluttini
Ein prominenter und international renommierter Bauherr aus Vorarlberg, der die richtige Beleuchtung für Großobjekte
zum Firmenziel hat, engagierte zwei Architekten, die über das „Ländle“ und Österreich hinaus ihre Kompetenz festigen konnten.
Ziel der gemeinsamen Bemühungen: das Werk II von Zumtobel auf einen bau-und arbeitstechnisch aktuellen Stand zu bringen. Carlo Baumschlager und Dietmar Eberle, die übrigens den Wiener Flughafen erweitern werden, haben eine neue Infrastruktur für die Bürotätigkeit in der alten Fabrik geschaffen, die sich nicht nur sehen, sondern auch - für die Mitarbeiter - täglich und sehr positiv erleben lässt.
Die Leistung der Architekten ist da nicht nur in der Adaption des Bestehenden begründet, sie bewirkt jene nur schwer zu beschreibende Atmosphäre, die das Denken, die schöpferische Leistung verstärkt. Gemeinsam Arbeiten bedeutet hier auch eine Reduktion der räumlichen Hierarchien. Großzügige Flächen, wenige bauliche Hemmschwellen und Transparenz, wo sie notwendig ist, unterstützen den Eindruck von Unbeschwertheit, von lockerem Umgang am Arbeitsplatz. Und trotzdem fehlt nicht eine gewisse alemannische Nüchternheit, die jede optische Aufregung tunlichst vermeidet.
Auftraggeber: Zumtobel, Dornbirn, 1998/1999
Architekten: Carlo Baumschlager und Dietmar Eberle, Lochau Foto: Günter Lazina
Viel unterschiedlicher könnten die Büroräume von Jean Nouvel in Bregenz
und dem zweiten Beispiel internationaler Büro-Baukunst in Österreich, dem Haus der Klagenfurter Hypo-Alpe-Adria nicht sein. Der Kalifornier Thom Mayne verzichtet bewusst auf die Schaffung kontemplativer Arbeitssituationen. Er setzt ganz klar, ganz dramatisch auf Raumwirkungen, denen sich die Benützer nur schwer entziehen. Hier zischen schräge Fenster vor dem Schreibtisch im Chefsekretariat in die Höhe, dort sitzen die untergeordneten Mitarbeiter, um der schönen Fassad' willen auch tagsüber im Dunklen. Klare Erkenntnis: Karrierestreben wird auch durch die Architektur gefördert.
Als Vorbild für die systematische Lösung von Problemen zeitgemäßer Arbeitsplatzgestaltung ist der Bau von Thom Mayne denkbar ungeeignet. Vielmehr ist das Haus als gebaute Aussage des Architekten zu verstehen, der hier seine „individuellen“ Räume realisieren konnte.
Auftraggeber: Hypo-Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt 1999
Architekt: Thom Mayne, Los Angeles Foto: Walden
Am billigsten ist die gebaute Schachtel, weil sie größtes Volumen mit geringster
Außenfläche vereinigt. Aber lässt sich in einer solchen Box menschenwürdig arbeiten? Architekt Josef Lackner hat beim Büro der Jenbacher Werke gezeigt, dass es möglich ist.
Der gebaute Kubus mit vierzig Metern Seitenlänge wird durch vier Lichtzisternen ausreichend erhellt. Reflektoren und eine durchgehende Öffnung nach außen hin bilden dazu die blendfreie Gesamtbeleuchtung. Im Obergeschoss hat dazu jeder Mitarbeiter „sein“ persönliches kleines Fenster. Dem jeweiligen Bedarf entsprechend, lässt sich auch die Möblierung verändern.
So können Arbeitssituationen für Teams oder Einzelne disponiert werden. Wie bei der Beleuchtung hat Lackner bei der Materialwahl auf Unterschiede geachtet. Textilien reichen vom Boden bis an Fenster, das Holz der Möbel kontrastiert mit dem Stahl der Tragkonstruktion - behaglich und klar zugleich.
Auftraggeber: Jenbacher Werke,
Tirol 1992
Architekt: Josef Lackner, Innsbruck
Foto: Lackner
Wer diese Arbeitsräume verlässt, ist selber schuld. Im Bürohaus der Bregenzer Interunfall-Versicherung - von Frankreichs
Star-Architekten Jean Nouvel geplant - wird dem wahren Luxus gefrönt: dem puren Raum. Und der ist mehr als reichlich vorhanden. Hier kann sich auch der mittlere Angestellte wie ein Chef fühlen, weil sein Büro schlichtweg über die Dimension dafür verfügt. Gleichzeitig wird mit der Größe ein zweiter teuerer Kostenfaktor unserer Zivilisation bewältigt - die Stille. Aber die Architektur bietet mehr.
Nouvel hat eine Stadt in der Stadt entworfen. Mit Ausblicken, mit Transparenz, mit einem Vorplatz und der durchgrünten Halle, welches das Klima des Hauses optimiert. Allein die geschwungene Decke in dieser Halle vermittelt einen Erlebniswert ähnlich jenem großer technischer Bauwerke. Nouvel begnügt sich nicht nur mit einer indifferenten baulichen Transparenz am Arbeitsplatz, die das Gefühl des Verlorenseins üblicher Büropaläste entstehen lässt. Er führt eine diskrete Blick-Regie. Nach außen hin filtern blechverkleidete Blumenkisten die Wahrnehmung, während die Glasscheiben zwischen den Stahlträgern der Halle wieder größere Sichtfenster öffnen, sodass von jedem Büroraum aus der Blick durch das gesamte Gebäude geboten wird. Der individuelle Maßstab wird artikuliert, Distanzen festgelegt, Räumlichkeit geschaffen.
Auftraggeber: Interunfall-Versicherung, Bregenz 1999
Architekt: Jean Nouvel, Paris Foto: Walden
Der Standard, Fr., 2000.09.15