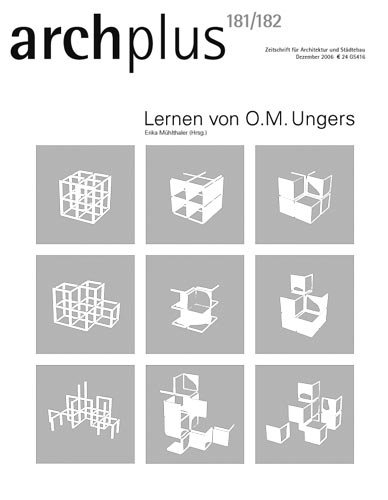Editorial
Mit der Umstellung des Architekturstudiums auf Bachelor und Master ist die Architekturlehre in den letzten Jahren wieder verstärkt zum Thema geworden. Was bei den Diskussionen immer wieder erstaunt, ist, dass der Systemwechsel kaum als Chance wahrgenommen wird, das vor sich hindümpelnde Lehr- und Lernkonzept grundsätzlich in Frage zustellen und nach Impulsen für eine Neuausrichtung der Architekturausbildung zu suchen. Strukturen statt Inhalte wurden über Jahre hinweg diskutiert, bis sich alle erschöpft eher der Bestands- als der Zukunftssicherung zuwandten. Dabei gab es in den 50ern und 60ern gerade in Deutschland interessante Entwicklungen (hfg/Ulm, Ungers/Berlin), die maßgeblich waren und eine internationale Ausstrahlung besaßen. An diese Traditionen anzuknüpfen und sie weiterzuentwickeln wäre eine Zukunftsaufgabe. An dem besonderen Beispiel der Berliner Lehrzeit Oswald Mathias Ungers’ möchte archplus einen Beitrag zur Diskussion leisten und sie zugleich aus dieser Geschichtsvergessenheit herausführen.
Mit der kommenden archplus 181/182 „Lernen von O. M. Ungers“ setzen wir nach archplus 179 „Oswald Mathias Ungers. Berliner Vorlesungen 1964/65“ die Auseinandersetzung mit dessen Lehrkonzept fort. Während die Berliner Vorlesungen den theoretisch-methodischen Ansatz seiner frühen Lehrtätigkeit aufzeigen, gibt das kommende Heft einen zu den Vorlesungen komplementären Überblick über seine praktisch-schöpferische Lehrauffassung, die in unzähligen Projekten und vor allem in den berühmten „Veröffentlichungen zur Architektur“ ihren Ausdruck fanden. Die als Anthologie konzipierte Ausgabe (Gastredaktion: Erika Mühlthaler) gibt erstmals einen vollständigen Überblick über alle Publikationen des Ungers-Lehrstuhls an der TU Berlin der 60er Jahre. Mit Staunen erinnert sich Rem Koolhaas in seinem Beitrag noch heute daran, wie er Anfang der 70er die kurz VzA genannten Hefte in einem Berliner Buchladen entdeckte.
Warum in kurzer Folge zwei Ausgaben zu Ungers? Es geht uns ausdrücklich nicht um einen wie auch immer gearteten Personenkult. Vielmehr ermöglicht es die unvergleichliche Materialsammlung beider Ausgaben, sich von einer Zeit inspirieren zu lassen, in der die intellektuelle Offenheit Maßstab für eine ganze Generation war. Die unglaublich positive Resonanz auf die Berliner Vorlesungen, die innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind und nun in einer zweiten korrigierten Fassung aufgelegt wurden, hat uns dazu ermutigt, diese fast in Vergessenheit geratene Periode weiter aufzuarbeiten. Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Martin Luce mit Carolin Kleist
Inhalt
11 Architektur oder Revolution* / Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Martin Luce, Carolin Kleist
12 Chronologie / Erika Mühlthaler
15 Lernen von O.M. Ungers / Erika Mühlthaler
22 Haus Belvederestraße / Oswald Mathias Ungers
30 Berufungsvortrag / Oswald Mathias Ungers
46 Fragen und Antworten / db Deutsche Bauzeitschrift
48 Umfrage zur Architektenausbildung / Oswald Mathias Ungers
51 Vorwort Berlin 1995 / Oswald Mathias Ungers
52 Köln-Zollstock Grünzug Süd / Oswald Mathias Ungers
58 Berlin-Lichterfelde 4. Ring / Oswald Mathias Ungers
61 Im Gespräch mit Jürgen Sawade* / Erika Mühlthaler, Jürgen Sawade
63 Im Gespräch mit Joachim Schlandt / Erika Mühlthaler, Joachim Schlandt
68 Berliner Geschichte(n) / Rem Koolhaas
70 Symposion 1964 / Oswald Mathias Ungers, Fritz Eggeling
74 Wochenaufgaben 1965 - VzA 01 / Oswald Mathias Ungers, Eckhart Reissinger, Ulrich Flemming
82 Without Rethoric - VzA 02 / Peter Smithson
84 Team X Treffen - VzA 03 / Oswald Mathias Ungers, Ulrich Flemming, Hartmut Schmetzer, Arnulf Rainer, Aldo van Eyck, Herman Hertzberger, Hans Hollein, Jerzy Soltan, John Voelcker, Stefan Wewerka
86 Schnellstraßen und Gebäude - VzA 04 / Oswald Mathias Ungers, Volker Sayn
88 Großformen im Wohnungsbau - VzA 05 / Oswald Mathias Ungers, Ulrich Flemming, Hartmut Schmetzer
90 Schwarze Architektur - VzA 06 / Oswald Mathias Ungers, Arnulf Rainer, Stefan Wewerka
92 Kristallpalast - VzA 07 / Oswald Mathias Ungers, Ulrich Flemming
94 Plätze und Straßen - VzA 08 / Oswald Mathias Ungers, Volker Sayn, Eckhart Reissinger
96 Gutachten Ruhwald - VzA 09 / Oswald Mathias Ungers, Guido Ast
98 Wohnen am Park - VzA 10 / Oswald Mathias Ungers, Volker Sayn
102 Rupenhorn / Oswald Mathias Ungers, Gisa Rothe
103 Bauten der Havellandschaft / Gisa Rothe
104 Städtebauliche Untersuchung Paderborn - VzA 11 / Oswald Mathias Ungers, Michael Wegener
108 Verkehrsband Spree - VzA 12 / Oswald Mathias Ungers, Jörg Pampe, Rolf Eggeling
110 Verabschiedung der Diplomanden 1967 / Oswald Mathias Ungers
112 Beitrag zur Planetarisierung der Erde - VzA 13 / Oswald Mathias Ungers, Volker Sayn
115 Bindungen / Michael Wegener
118 Studenten-Unruhen* / Oswald Mathias Ungers, Anrisse
122 Architekturtheorie - VzA 14 / Oswald Mathias Ungers, Jörg Pampe
124 Entwürfe für eine Gesamtoberschule - VzA 15 / Oswald Mathias Ungers, Joachim Schlandt, Bernd Robert Jansen
126 Die Wuppertaler Schwebebahn - VzA 16 / Oswald Mathias Ungers, Adolf Neunhäuser, Ulrich Flemming, Volker Sayn
128 Wohnungssysteme in Stahl - VzA 17 / Oswald Mathias Ungers, Dieter Frowein, Horst Reichert, Jürgen Sawade
132 Ithaca, N.Y. - VzA 18 / Oswald Mathias Ungers, Stephen Katz, Uwe Evers
134 Wohnbebauungen - VzA 19* / Oswald Mathias Ungers, Gisa Suhr
140 Mies van der Rohe - VzA 20 / Oswald Mathias Ungers, Alison Smithson, Peter Smithson, Peter, Jörg Pampe
142 Schnellbahn und Gebäude - VzA 21 / Oswald Mathias Ungers, Bernd Kraneis, Hartmut Schmetzer, Ulrich Flemming
146 Wohnungssysteme in Großtafeln - VzA 22 / Oswald Mathias Ungers, Michael Wegener, Joachim Schlandt, Heinrich Busse, Heinrich, Falk Dürr, Frank Pasche
148 Die Wiener Superblocks - VzA 23 / Oswald Mathias Ungers, Joachim Schlandt, Ulrich Flemming
150 Wohnungssysteme in Raumzellen - VzA 24 / Oswald Mathias Ungers, Heidede Becker, Ulrich Flemming
152 Berlin 1995 - VzA 25 / Oswald Mathias Ungers, Uwe Evers
154 Blocksanierung und Parken - VzA 26 / Oswald Mathias Ungers, Claas Corte, Uwe Evers, Horst Reichert, Jürgen Sawade
156 Berliner Brandwände - VzA 27 / Oswald Mathias Ungers, Jürgen Sawade, Jörg Pampe
158 Lysander / Oswald Mathias Ungers, Tilman Heyde, Stephen Katz
162 Gotham City / Oswald Mathias Ungers, Arthur Ovaska
170 Designing and Thinking with Images... / Oswald Mathias Ungers
172 Urban Villa / Oswald Mathias Ungers, Hans Kollhoff, Arthur Ovaska, Liselott Ungers
174 Urban Garden / Oswald Mathias Ungers, Arthur Ovaska, Liselotte Ungers, Hans Kollhoff
176 Stadt in der Stadt / Oswald Mathias Ungers, Liselotte Ungers, Peter Riemann, Hans Kollhoff, Rem Koolhaas