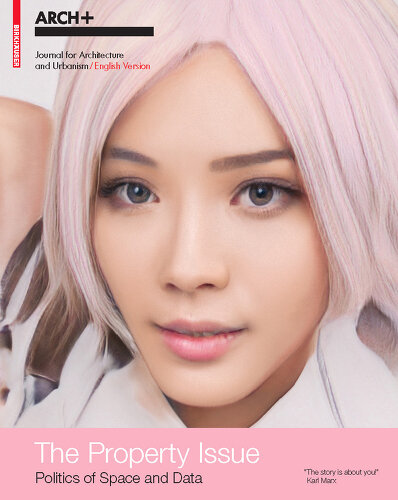Anh-Linh Ngo: Sie sind als Zeitschriftengestalter mit Titeln wie brand eins, Kid’s wear oder zuletzt 032c bekannt geworden. Darüber hinaus sind Sie in...
Anh-Linh Ngo: Sie sind als Zeitschriftengestalter mit Titeln wie brand eins, Kid’s wear oder zuletzt 032c bekannt geworden. Darüber hinaus sind Sie in...
Anh-Linh Ngo: Sie sind als Zeitschriftengestalter mit Titeln wie brand eins, Kid’s wear oder zuletzt 032c bekannt geworden. Darüber hinaus sind Sie in ganz unterschiedlichen Disziplinen zuhause, mit Apart haben Sie früh in Ihrer Laufbahn selber eine Zeitschrift gemacht, Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich zudem auf Kunst, Fotografie, Werbung sowie Strategie- und Branding-Beratung für Firmen. Ihr Büro funktioniert eigentlich wie eine Agentur. Wie gehen Sie mit diesen Unterschieden um?
Mike Meiré: Ich habe für mich erkannt, dass ich einer transversalen Kultur angehöre, die sich quer zur funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft bewegt. Ich stelle mich aktiv diesem Zerfließen und dem Ineinanderfließen der kreativen Disziplinen. Wir erleben heute das Phänomen, dass Mode, Design, Musik, Architektur zusammenkommen und man daraus etwas Eigenes generieren kann. Als Gestalter befinde ich mich in der paradoxen Situation, dass ich eher kuratiere als gestalte. brand eins als Wirtschaftszeitschrift macht mir großen Spaß, weil wir es geschafft haben, Wirtschaft als elementare Kraft der Gesellschaft anders als gewohnt zu vermitteln. Ich arbeite da seit vielen Jahren mit einer Redaktion zusammen, die manchmal richtig „hardcore“ redet, man merkt, dass es ihnen um Aufklärung geht. Bei Kid’s wear haben wir es mit einer anderen visuellen und inhaltlichen Kultur zu tun, die ganz andere Schwingungen produziert. Zuletzt kam 032c dazu, wo es um so unterschiedliche Felder wie Politik, Fashion, Kunst und Design geht. Ich achte bei Anfragen für die Gestaltung einer Zeitschrift sehr darauf, aus welchem kulturellen Bereich diese kommt, und im Falle von Arch hat mich das Thema Architektur sofort angesprochen.
ALN: Wie ist Ihr Verhältnis zur Architektur?
MM: Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass sich meine Interessen um die drei Begriffe Spirit, Speed und Space drehen. Das ist eine alberne Alliteration, aber diese Formel umreißt ganz gut, worum es mir bei den unterschiedlichen Aufgaben geht: die Haltung, die hinter den Inhalten steht, das Tempo, das diese Inhalte im kulturellen Kontext brauchen, wobei es die ganze Bandbreite von Be- und Entschleunigung umfasst, je nach dem, was richtig ist. Und nicht zuletzt habe ich gespürt, dass ich extrem sensibel gegenüber Räumen reagiere. Ich glaube daran, dass Räume durch ihre physische Präsenz unser Denken beeinflussen, das ist für mich das Interessante an Architektur. Der freie Raum hier in der Factory regt mich zum freien Denken an. Wenn man immer in kleinen Nischen sitzt, dann denkt man vielleicht auch immer in kleinen Nischen. Man sagt ja, dass wir zuerst unsere Häuser formen, dann formen sie uns ...
ALN: Winston Churchill: „We shape our buildings; thereafter they shape us.“
MM: Genau. Ich glaube, dass das zum Teil stimmt. Ich habe es gemerkt, als ich in Tokio war und das Prada-Gebäude von Herzog & de Meuron besucht habe. Ich dachte, ich würde das Gebäude kennen, weil ich es in unzähligen Publikationen gesehen habe. Aber wenn man physisch anwesend ist, dann ist das etwas ganz anderes. Das Gleiche passiert in der Kunst, man kennt die Abbildungen, aber wenn man im Museum vor den Bildern steht, entwickeln sie eine Aura. Ich glaube, dass Räume deshalb für mich wichtig sind, weil sie der real fassbare Kontext für eine Empfindung sind. Leider sind wir in Deutschland ganz gut in mittelmäßiger, uninspirierter „Telekomarchitektur“. Das Problem mit mittelmäßiger Architektur ist ja nicht, dass sie hässlich ist. Es ist vielmehr, dass wir um diesen Raum der Möglichkeiten beraubt werden, der uns daran erinnert, welches Potential in uns Menschen schlummert. Darin sehe ich auch die wahre Pflicht der Architektur, sie ist ein physisches Momentum, das uns kurz aus der effizient funktionierenden Alltagsstruktur entrückt. Wir haben allerdings zu wenige moderne, zukunftsorientierte Räume, die uns diese mögliche Erfahrung vermitteln.
ALN: Sie sprechen damit ein tiefgreifendes Problem an, das mit der spezifisch deutschen Auseinandersetzung mit der Moderne zu tun hat und weit in die Nachkriegszeit zurückreicht, wie es Thilo Hilpert in seinem Beitrag „Land ohne Avantgarde“ analysiert hat. Was mir jedoch auffällt, ist, dass Sie den Begriff modern sehr häufig benutzen. Was bedeutet es für Sie, modern zu sein? Ich frage auch deshalb, weil es das Selbstverständnis von Arch berührt. Wir sehen uns im Sinne von Habermas als Teil einer unvollendeten Moderne, wobei Moderne als Bewegung, als Projekt, an dem es zu arbeiten gilt, und nicht als Stil zu verstehen ist. Otl Aicher, der lange Zeit das Erscheinungsbild von Arch bestimmt hat, sprach von einer „anderen Moderne“. Es gibt also ganz unterschiedliche Konnotationen. Was heißt es heute, modern zu sein angesichts großer antimoderner Tendenzen in der Gesellschaft?
MM: Ich denke, es ist wichtig, sich zu vergewissern, woher man kommt. Ich habe mich sehr früh, vielleicht mit 17, für das Bauhaus interessiert. Ich habe versucht, diese Ideen mit meiner eigenen Zeitschrift Apart in die Gegenwart zu überführen. Modern zu sein bedeutete für mich damals, dass ich mir eine eigene Kultur schaffen kann, eine Kultur, in der ich meine eigene Typografie entwickle, meine eigene Zeitschrift mache, in der ich über Dinge berichte, die mich interessieren. Wenn man es verallgemeinern will, so geht es letztlich um Architektur, also darum Räume zu bauen, eine Welt zu erschaffen, in der man sein eigenes „Theatrum“ gestaltet, wobei alles von einer nach vorne gerichteten DNA durchzogen ist.
Ich habe allerdings irgendwann gemerkt, dass ich in dem „Bauhaus-Gebäude“ gefangen war. Vor allem in den 80ern, als ich mir das Diktat auferlegt habe, nur mit einer Schrift, mit der Neuen Helvetica, zu arbeiten. Es ging nicht darum, mich zu disziplinieren. Es ist nur manchmal hilfreich, wenn man sich in seinen Möglichkeiten limitiert, gerade wenn man glaubt, man sei kreativ. Innerhalb dieser selbst gesteckten Limitierung kann man dann versuchen, Überraschungen zu produzieren. Man denkt dann nicht mehr über den Wechsel einer Schrift nach, sondern eher darüber, ob man groß oder klein schreibt, die Schrift mittig, links- oder rechtsbündig setzt, was man mit dem Spacing, was mit dem Durchschuss macht.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Das war eine gute Schule, aber ich habe auch gemerkt, dass es eine Sollbruchstelle braucht, und diese Sollbruchstelle ist der moderne Aspekt der heutigen Zeit. Ich glaube, heute modern zu sein bedeutet, die Sollbruchstelle auszuhalten. Es ist die Erkenntnis, dass das Leben nicht nach einer Agenda funktioniert. Modern benutze ich im Sinne von progressiv. Wir leben schließlich nicht von der Vergangenheit, sondern von der Zukunft. Dennoch müssen wir zurückschauen, weil wir eine Herkunft haben. Aber diese Herkunft unterliegt immer einer Transformation. Ein gutes Beispiel aus der zeitgenössischen Kunst ist die Neo-Moderne, die diesen Rückgriff auf die Moderne wagt, aber eigentlich implizit das Scheitern dieser Utopie zum Thema macht. Ruinöse Malerei nennt beispielsweise der Maler Alexander Lieck seine Bilder, die sich auf die konstruktive Avantgarde bezieht. Er benutzt die Moderne als Matrix der Vergangenheit, um darüber wieder andere Schichten zu legen.
ALN: Was können wir durch den Rückblick lernen? Dieses Heft ist ja ein solcher Rückblick, der in die Zukunft gerichtet ist.
MM: Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir heute zurückblicken und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können. Ich glaube, dass Leute wie Otl Aicher in ihrem zeitlichen Kontext eher die Aufgabe hatten, Qualität sichtbar zu machen. Sie sind aber manchmal Opfer ihrer eigenen Ideologie geworden, weil sie Dinge zu sehr manifestieren, festschreiben wollten. Im Gegensatz zu früher muss man heute nicht mehr Qualität sichtbar machen. Es geht heute eher darum, eine Haltung auszudrücken. Denn wir orientieren uns heute mehr an Haltungen, die selbstverständlich mit einer Qualität gekoppelt sein müssen, aber man muss sie nicht mehr rein formal betrachten. Deshalb arbeite ich in unterschiedlichen Stilen, immer aus dem Kern einer Sache heraus, und das nenne ich „Ästhetik für Substanz“. Ich glaube, als Gestalter befindet man sich heute in der Rolle eines Agenten, der spüren muss, für welche Unternehmung es welcher kulturellen Codes bedarf, die es dann zu visualisieren gilt. Allerdings ist das Produkt nur dann glaubwürdig, wenn diejenigen, die den Inhalt machen, sprich die Redaktion, tatsächlich diese Kultur auch ein Stück weit nachvollziehbar leben kann. Wenn das zutrifft, hat man als Gestalter dann das Glück, etwas zu produzieren, das kulturelle Relevanz besitzt.
ALN: Vielleicht bedarf es einer gewissen Radikalität, um kulturelle Relevanz zu erzeugen. Damit sind wir bei der Frage angelangt, die Sie vorhin kurz angeschnitten haben und die wir in diesem Heft implizit behandeln, nämlich warum seit geraumer Zeit im Bereich der Architektur, ganz anders als in der Kunst, kaum relevante Impulse von Deutschland ausgegangen sind. Diese Situation spiegelt sich in der Medienlandschaft wider. Wenn wir die Zeitleiste der „Radikalen Architektur der kleinen Zeitschriften 196X–197X“ in diesem Heft betrachten, dann fällt auf, dass im Gegensatz zu Ländern wie England, Italien, Spanien, Österreich, Amerika oder Frankreich, also Länder, die kontinuierlich wichtige Beiträge geliefert haben und liefern, in Deutschland eine solche Entfaltung an Publikationsformaten und Inhalten ausgeblieben ist. Arch bildet darin die einsame Ausnahme. Fern von jeglicher Arroganz kann man darin das Fehlen eines Diskurses ablesen, unter der die deutsche Architektur, aber auch Arch , strukturell leidet. Die Synopse zeigt symptomatisch das, was man als Radikalitätsdefizit im diskursiven Sinne nennen könnte.
Sie haben daran angeknüpft und ein Konzept erarbeitet, das Sie als „visuell konsequente Radikalisierung des Inhalts“ beschreiben. Wie sieht heute die „radikale Architektur“ einer kleinen Zeitschrift aus, Architektur im doppeldeutigen Sinne als Aufbau der Zeitschrift und als Architektur, die darin abgebildet wird.
MM: Es ist natürlich als Deutscher besonders schwierig, von Radikalisierung zu sprechen. Das kann schnell missverstanden werden. Aber ich denke, wir haben keine andere Chance. Wir leben heute in einer unglaublichen Marketingwelt. Ich habe in den letzten 20 Jahren hautnah mitbekommen, wie Marken aufgebaut werden, wie sie sich bestimmter kultureller Codes bemächtigen. Ich habe ja selbst meinen Teil dazu beigetragen. Wir sind aber an einem Punkt angelangt, wo man das Gefühl der Gleichmacherei nicht mehr loswird. Im Zuge der Globalisierung setzt sich so etwas wie ein internationaler Stil durch, ein geschmäcklerischer Minimalismus. Wenn ich heute von Radikalisierung spreche, dann meine ich das eigentlich eher im Sinne von Josef Beuys als Aufruf zur Alternative. Wir haben zu viel vom Ewiggleichen, was es braucht, ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und ich glaube, den kriegen wir in dieser weichgespülten Medienkultur nicht. Wir brauchen wieder eine bestimmte Form von Antiperfektionismus. Ich möchte nicht professionell sein, ich möchte stattdessen das Charismatische ausarbeiten. Ich versuche eher das radikale Moment darin zu definieren, dass es den Charakter des Andersartigen zulässt.
ALN: Was heißt das konkret für das Redesign?
MM: Nachdem wir die alten Hefte durchgesehen haben, habe ich mich gefragt, warum ich die Relevanz, die diese Zeitschrift inhaltlich in der Szene hat, nicht fühlen kann? Ich bin ja kein Typograf im klassischen Sinne wie Erik Spiekermann oder Neville Brody, aber ich hatte das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, dass die Rotis, die an sich eine wunderschöne Schrift ist, heutzutage eine solche Corporate-Typografie geworden ist, dass sie für mich unweigerlich nicht nach einer Alternative aussieht, sondern den Eindruck eines weiteren Corporate-Magazins vermittelt. Sie mag ursprünglich eine andere Intention gehabt haben, aber die Wahrnehmung hat sich gewandelt, so dass das Schriftbild der Rotis für Arch kontraproduktiv geworden ist.
Gerade in der heutigen Marketingwelt, in der Nischen besetzt werden, um nur ein weiteres Marketingprodukt zu kreieren, brauchen wir mehr denn je den Idealismus von einzelnen Überzeugungstätern, die eine Alternative anbieten. Ich habe auch deshalb spontan zugesagt, weil ich glaube, dass ich es bei Arch mit einer solchen Truppe von echten Überzeugungstätern zu tun habe, die so viel Idealismus und einen großen wichtigen Teil ihrer Lebenszeit dafür einbringen. Deswegen wollte ich bei dem Redesign von Arch wieder zurück zu den Wurzeln, aber nicht in einem nostalgischen Sinne. Vielmehr um an den Punkt anzuknüpfen, wo ein Bewusstsein, ein Sendungsbewusstsein aufgekommen ist, das sich in Form einer Zeitschrift verselbständigt hat. Die erste Ausgabe vor genau 40 Jahren in ihrem konsequenten Schwarz-weiß-Design mit dem klaren Arch Logo hatte die Form eines Manifestes. Ich sehe in Arch nicht nur Architektur, sondern auch den Archetyp, daher wollte ich wieder etwas Archetypisches schaffen, aber in einem heutigen Sinne, in der heutigen Zeit.
Die meisten Architekturzeitschriften sind heute hyperprofessionell gemacht, dadurch werden sie aber auch Opfer ihrer eigenen Professionalität in der Darstellung. Alles sieht super aus, fantastische Bilder, beste Geschichten, aber man kriegt gar nicht mehr mit, was das Anliegen ist. Dadurch wird alles redundant, ist nur noch Geräusch, wenn auch schönes Geräusch. Aber was ich wollte, um in dieser Metapher zu bleiben, ist, Arch durch die Gestaltung wieder zu seiner ursprünglichen Sprache zu verhelfen. Und deswegen wollte ich weg von den Rotis-Konditionierungen im Sinne eines Corporate-Magazins, um wieder deutlich zu machen, dass es hier um eine Form von Anarchie geht. Eine gewisse Rohheit, eine Ungeschliffenheit, die nicht vordergründig zu gefallen versucht. Mit brand eins habe ich so etwas wie eine klassische Schönheit des Feuilletons definiert, was mir nach wie vor wichtig ist, denn ich glaube weiterhin an die Kraft der Schönheit. Aber ich glaube auch, nachdem heute alles schön aussehen kann, wird diejenige Schönheit immer wichtiger, die sich erst auf dem zweiten Blick erschließt. Wenn man als Leser dieses Heft wirklich durchgearbeitet hat, wird man erkennen, wie wertvoll es geworden ist; durch die Aneignung entsteht so etwas wie eine Kostbarkeit. Man muss heute eher ein antizyklisches Gestaltungsverhalten an den Tag legen, das jetzt mit dem Label „Ugly“ versehen worden ist, aber um Hässlichkeit geht es gar nicht, sondern im Falle von Arch ist es dieses brutale Bekenntnis zum Inhalt.
ALN: Wie haben Sie dieses Bekenntnis in die Gestaltung übersetzt?
MM: Indem ich die Typo fast bis zum Rand ausgedehnt habe. Das heißt, ich möchte so wenig Weißraum wie möglich haben, weil jede Seite wichtig ist; deswegen muss die Seite von oben bis unten vollgeschrieben sein. Oder die Seiten müssen mit Bildern gefüllt sein. Ich bin davon überzeugt, dass schöner, ausbalancierter Weißraum heute von mündigen Lesern als Design-Geste gelesen wird. Und ich finde, jetzt ist mal Schluss mit Design. Wir brauchen erstmal wieder Aufrichtigkeit. Also keine Verschönerung, keine Make-up-Prozesse mehr, das meine ich mit „Ästhetik für Substanz“. Diese Substanz muss natürlich geliefert werden, und da gibt es nicht viele. Arch gehört zu den wenigen, die Substanz liefern. Dementsprechend macht es auch Spaß, das Ganze so umzudrehen, weil ich weiß, dass es nicht darum geht, Grauwerte zu strukturieren, sondern Dringlichkeit zu gestalten.
Arch ist aber auch kein Museum, wir schauen nicht nostalgisch zurück, daher bringen wir bewusst die vielen Faksimiles, die wir als Beweisführung für die These der radikalen kleinen Zeitschrift haben, nicht mit einem weißen Passepartout und stellen sie dadurch auf einen Sockel, sondern wir zoomen rein, wir sind respektlos im Umgang mit ihnen. Ich möchte diese vermeintliche Feinheit ausblenden, ich möchte, dass es wirklich into your face ist oder besser into your soul bzw. into your brain. Es muss also unmittelbar, direkt sein. Ich glaube, dass auch Architektur so funktionieren muss, sie darf nicht kalkuliert erscheinen. Beim Design habe ich zu häufig das Gefühl, dass alles bis ins Kleinste kalkuliert ist. Das Problem ist doch, dass heute alles einer Absicht folgt. Und diese Absicht wird vorgegeben, sie ist das Ergebnis eines Businessplans. Was ich wieder einfordere, ist Absichtslosigkeit.
ALN: Genauso hat Baudrillard Radikalität einmal definiert: „losgelöst von aller Bedeutung, aller Finalität, aller Kausalität“. Etwas, das über sich hinausweist, das nicht ein bestimmtes vorgegebenes Programm zu erfüllen oder die Realität widerzuspiegeln versucht. – Was hat es mit dem schwarzen Balken auf sich, der sich auf jeder Seite wiederholt?
MM: Der schwarze Balken, der oben auf der Seite steht, stellt ein solches radikales Moment dar. Man kann ihn irgendwie stilistisch lesen, aber er ist einfach eine Konstante, die sich ganz radikal oder stoisch über jede Seite durchquält. Es würde ja reichen, den Balken lediglich auf der ersten Seite einer Rubrik einzusetzen und dazwischen nicht zu wiederholen. Nein, er ist wie ein Stempel, wie ein Gütesiegel, noch mal drauf, noch mal drauf und noch mal drauf. Ansonsten ist die Gestaltung möglichst schwarz-weiß und ungeschönt, Dinge sind grob wie mit der Nagelschere freigestellt. Schließlich geht es nicht um Perfektion, auch nicht darum, einen Preis für die beste Lithografie zu bekommen, sondern es geht um einen Moment aufrichtiger Auseinandersetzung, darum, das Zeitschriftenmachen als eine Art Schöpfungsprozess zu zeigen. Und am Ende dokumentiert das Heft an sich diesen Findungsprozess, diese Auseinandersetzung. Wir knüpfen damit an jenen Moment an, als Menschen zusammenkamen, die nichts über das Magazinmachen wussten, aber wussten, sie mussten der Welt etwas mitteilen. Und dieses Gefühl, diese Dringlichkeit möchte ich im Design spürbar machen.
ALN: Diese Dringlichkeit umschreiben Sie mit dem Begriff des Manifestes. Sie sagten, Arch müsse die Sprache eines Manifestes sprechen. Nur wissen wir allzu gut, dass die Zeit des Manifestes vorbei ist. Stattdessen haben wir es heute mit „passiven Manifesten“ zu tun, wie es Rem Koolhaas während des Interview-Marathons formuliert hat. Diese Erkenntnis durchzog wie ein roter Faden viele Gespräche, die er und Hans Ulrich Obrist im Rahmen der Teilnahme von Arch am Zeitschriftenprojekt der documenta 12 geführt haben. „Passives Manifest“ heißt, dass es heute nicht darum geht, irgendeine Überzeugung oder Eingebung zu verkünden, sondern aus der sehr genauen Beobachtung der Wirklichkeit heraus Dinge so zu verdichten, dass sie den Charakter eines Manifestes annehmen.
MM: Das ist eine perfekte Beschreibung dessen, was wir wollten. Ein Manifest als hoch verdichtetes Angebot. Das Radikale dabei ist, dass wir es so verdichten, dass man die härtere Gangart spürt. Man kriegt heute ja praktisch jedes Design hinterher geworfen, alles ist verfügbar, deswegen hat der Biedermeier tausend Möglichkeiten, sich zu tarnen.
ALN: Damit sprechen Sie ein inhaltliches Problem der Medien an. Aber es gibt daneben auch eine medientheoretische Ebene, die wir im Heft mit dem Exkurs „Buchdruck“ beleuchtet haben. Die These lautet, dass, um es mit Victor Hugo zu sagen, „der menschliche Gedanke mit der Änderung seiner Form auch die Ausdrucksweise ändern werde.“ Das bedeutet, wenn sich die Medien, mit denen wir unsere Gedanken ausdrücken, ändern, unsere Art zu denken sich ebenfalls ändern wird. Wir haben den Bogen bewusst weit gespannt, angefangen bei der einschneidenden medientechnischen Revolution des Buchdrucks, über die 20er Jahre hin zu der Blüte der kleinen Zeitschriften in den 60er und 70er Jahren, die als eine Reaktion auf neue Möglichkeiten im Printbereich gelesen werden kann. Die Digitalisierung haben wir nicht behandelt, weil wir in den kommenden Heften darauf eingehen wollen. Wie denken Sie werden sich die digitalen Medien auf das Zeitschriftenmachen auswirken?
MM: Ich glaube, die ewige Diskussion darum, dass die digitalen Medien die Zeitschriften plattmachen werden, hat sich erübrigt. Ich glaube sogar, dass die Zeitschriften dadurch noch kostbarer geworden sind. Das Medium ist ein Traum, die haptische Qualität, das Knistern beim Blättern, der Duft. Andererseits besteht die digitale Möglichkeit darin, dass man heute ohne viel Aufwand Zeitschriften selber machen kann. Es geht schneller, professioneller im technischen Sinne.
ALN: Es bestehen somit eigentliche ideale Voraussetzungen für das, was in den 60ern und 70ern passiert ist.
MM: Ja, die Chance der digitalen Medien besteht gerade in ihrer schnellen Machbarkeit. Aber derzeit ist das meiste absolut belanglos, die Sachen sind zwar super gestaltet, kommen wichtig daher, aber es sind vorwiegend frisierte PR-Texte. Man muss richtig suchen bis man Dinge entdeckt, wo das Visuelle und der Inhalt eine fruchtbare Verbindung eingehen. Das Problem ist, dass die Leute zu wenig wagen. Alles sieht toll aus, weil man heute alles toll aussehen lassen kann. Aber das ist alles nur Make-up. Ich glaube, das Grundproblem liegt darin, dass es nur ganz wenige Überzeugungstäter in den Redaktionen gibt, die eine Idee, eine Haltung haben, für die sie auch einstehen. Das ist sicherlich auch ein Problem der Verlage, die einfach Geld verdienen wollen. Nicht, dass man nicht Geld verdienen will, aber man muss erstmal eine Idee haben, man muss eine Haltung gegenüber den Dingen entwickeln, die in der Welt passieren. Mitte der 90er habe ich drei Jahre mit Peter Saville das Joint Venture „The Apartment“ in London gehabt. Wir haben kaum gearbeitet, wir saßen immerzu auf dem Sofa und haben geredet. Das ist auch eine wahnsinnige Qualität von Saville, dass man sich erst einmal über die Dinge im Klaren sein muss, bevor man beginnt. Es geht um Stoßrichtungen, um Intensität. Wir haben heute zu viele talentierte Tuner. Ich glaube, Talent ist das geringste Problem, das wir in Deutschland haben, vielmehr ist es ein Fehlen an historisch verwurzelter Haltung, an radikalem Engagement, um Dinge zu erschaffen, die für den Diskurs relevant sind. Dinge, die die richtige Schwingung haben. Manchmal ist diese Schwingung richtig gefährlich, vielen vielleicht zu gefährlich.
ALN: Ihr Verhältnis zur Typografie ist ...
MM: ... konzeptionell, absolut konzeptionell. Ich bin kein klassischer Typograf.
ALN: Abgesehen davon, dass die Futura in der ersten Arch benutzt wurde, gibt es für Sie andere Gründe, sie jetzt mit der Times wieder einzuführen?
MM: Das führt uns wieder zu der Frage zurück: Was heißt heute modern? Ich arbeite in der Regel mit drei, vier Schrifttypen, darunter die Helvetica oder die Futura als Grotesk. Für mich steht die Futura nicht allein wegen ihres Namens für Modernität. Was ich an ihr mag, ist, dass sie so geometrisch aufgebaut, so konstruiert ist. Auch die Moderne ist ja eine Kopfgeburt, ein Konstrukt. Die Futura besitzt eine Reinheit, die ich wieder entdecke. Das sieht man zum Beispiel ganz gut am kleinen a. Bei der Helvetica hat man einen Bogen drüber und einen kleinen Bauch, bei der Futura lediglich einen Kreis und einen Strich. Die Futura ist im Grunde eine Architekturschrift. Sie hat mehr Rückgrat. Ihre Gangart ist linearer, radikaler als die Helvetica.
Und wenn sich Dinge für mich noch auf einer Gedanken- oder Theorieebene befinden, dann arbeite ich gerne mit einer Schreibmaschinenschrift, also der Courier. Und wenn ich den Leser feuilletonistisch zum Lesen verführen, ihn auf eine andere Ebene überführen möchte, damit er sich in der Geschichte verliert, dann kommt die Times als Serif zum Einsatz, weil sie den Duktus eines Buches vermittelt. Aber Arch ist kein Buch, und die Courier würde auch nicht funktionieren. Die Futura gibt dem Layout eine gewisse Gradlinigkeit, die aber durch eine gewisse Rotzigkeit gestört wird. Wir werfen immer wieder Sand ins Getriebe. Das sind beispielsweise die Faksimiles, die teilweise unscharf sind, teilweise nicht perfekt, teilweise angegilbt, die bewusst in dieses strenge Raster gepresst werden. Das ist die Sollbruchstelle, die Komplexität der Gegenwart, von der ich gesprochen habe. Ich möchte die Dringlichkeit von Pornoseiten, in dem Sinne, dass ich das Triebgesteuerte zum Thema machen möchte.
ALN: Wie verbindet sich das mit einer theoretischen Zeitschrift?
MM: Was mich an Arch interessiert, ist nicht in erster Linie die Intellektualität, sondern dass die Redaktion sich ihren Trieben stellt. Sie trägt diesen Wahn in sich, alles akribisch aufzuklären, zu hinterfragen, das ist eigentlich irre, das ist so nerdy, aber das ist so kostbar, weil es Arch von anderen unterscheidet. Wenn wir nach Beuys alle Künstler sind, wenn Steve Jobs uns alle ein Laptop gegeben hat, dann können wir alle alles machen, wo ist der Unterschied?
ALN: Da wären wir wieder bei Peter Saville: „Das Einzige, was es noch nicht gab, ist man selbst.“
MM: Genau, dann ist man als befreites oder als lustgeplagtes Individuum gefordert, man kann dann seine Triebe ausleben oder sich ihnen stellen. Wir leben in einer Kulturgesellschaft und wir machen diese Kultur. Diejenigen, die sich nicht bewusst einbringen, werden letztlich Opfer ihrer eigenen Untätigkeit.
ARCH+, So., 2008.04.20
verknüpfte ZeitschriftenARCH+ 186/187 Radikale Architektur