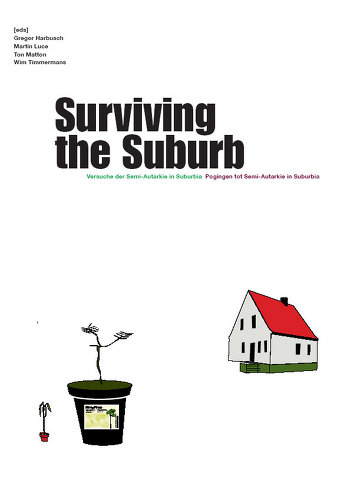Kritik
Sieg der Theorie
Schön war die Zeit. Die Architekturtheorie konnte aus dem Vollen schöpfen, als das Projekt der Moderne in den 1960er Jahren in...
Kritik
Sieg der Theorie
Schön war die Zeit. Die Architekturtheorie konnte aus dem Vollen schöpfen, als das Projekt der Moderne in den 1960er Jahren in eine „Legitimationskrise“[1] geriet und die Disziplin sich neu vergewissern musste. Die Sinnkrise bot die Möglichkeit, den kanonisch erstarrten Architekturdiskurs an zeitgenössischen gesellschaftlichen und kulturellen Diskursen neu auszurichten und Architekturtheorie im Sinne einer eigenständigen wissenschaftlichen Praxis jenseits der Architekturgeschichte zu begründen.[2] Über das Instrument einer „kritischen Theorie“ sollte das Projekt der Moderne einer Revision unterzogen und „kritisch“ fortgeführt werden. Da die Architektur bisher keine eigenen Instrumente einer Selbstkritik entwickelt hatte, lag daher nichts näher, als beispielsweise Anleihen zu nehmen an der „Kritischen Theorie“ der Frankfurter Schule, oder am Kanon der marxistischen Ideologie-Kritik, wie sie Manfredo Tafuri[3] in den Architekturdiskurs einführte, hielten sie doch Werkzeuge einer politischen Kritik der Architektur bereit. Darüber hinaus gewannen in den folgenden drei Jahrzehnten vor allem in Amerika andere außerdisziplinäre Fragestellungen in der Theorieentwicklung an Bedeutung: So wechselten sich in schneller Folge sprach- und sozialwissenschaftliche, psychoanalytische sowie philosophische Paradigmen wie Semiotik und Strukturalismus, Postmodernismus und Poststrukturalismus ab, von der Phänomenologie und den Naturwissenschaften ganz zu schweigen. Es sah alles nach einem Siegeszug der Theorie aus.
Einerseits gewann die Architektur(theorie) durch die oben beschriebene Öffnung an kultureller Relevanz und wurde interdisziplinär, da sie „auf Augenhöhe“ mit den anderen Disziplinen verkehren konnte. Andererseits geriet sie mit ihrem Anschluss an andere kulturelle Strömungen zugleich unter Druck, ihre Autonomie unter Beweis stellen zu müssen. Infolgedessen entwickelte sich an den amerikanischen Hochschulen ein selbstreferentieller Diskurs, der spätestens seit dem IAUS von Peter Eisenman mit den Zeitschriften Opposition, Skyline, später ohne Institut, aber mit eigenem Büro und mit der Zeitschrift ANY und den ANY Konferenzen für mehrere Jahrzehnte beherrscht wurde. Den amerikanischen, durch den Theoriehunger der 1960er Jahre geprägten, z.T. aus Europa exilierten Intellektuellen und Eisenman ist es zu verdanken, dass sich eine äußerst einflussreiche amerikanische Architekturtheorie entwickeln konnte, die die in Europa abgebrochenen Ansätze zu einem eigenständigem Theoriegebäude ausbaute. Im Unterschied zu Europa basiert diese Entwicklung auf einem linguistic turn, während die zeitgleichen Entwicklungen in Europa auf einen spatial turn hinauslaufen, mit dem Typus als raumstiftende Kategorie.
Beispielhaft für die Wendung der amerikanischen Architekturtheorie zu einem linguistisch fundierten Theoriegebäude ist Eisenmans 1979 geschriebener Essay „Aspekte der Moderne. Die Maison Dom-ino und das selbstreferentielle Zeichen“. Dieser Essay ist eine Auseinandersetzung mit Le Corbusiers berühmtem Maison Dom-ino. Dieses Konstruktionsschema interpretiert Eisenman nicht als Gerüst eines Wohnhauses, sondern als ein Zeichen, das unabhängig von allen Fragen der Funktion oder Konstruktion autonom fungiert. Sah Colin Rowe im Konstruktionsschema der Maison Dom-ino noch das klassische Diagramm des horizontal geschichteten, frei fließenden Raums der Moderne, so Eisenman nur noch das Emblem „moderne(r) oder selbstreferentielle(r) Zeichenhaftigkeit“.[4]
Mit diesem linguistic turn der Architekturtheorie, den er später erweitern wird um die generative Grammatik (Chomsky), Phänomenologie (Husserl), Philosophie (Derrida), ist der Grundstein gelegt für den Siegeszug der amerikanischen Architekturtheorie seit den 1980er Jahren.
Tod der Theorie
Zu welchem Preis dieser Sieg errungen wurde, zeigte sich erst nach und nach. Indem Eisenman durch Anleihen aus linguistischen Theorien eine „kritische Architektur“ als rein intertextuelles System, eine „Architektur über Architektur“ propagierte und K. Michael Hays unter Rückgriff auf die Tradition der „Kritischen Theorie“ eine „dialektische Argumentation für eine Autonomie der Disziplin gegenüber den sie erzeugenden gesellschaftlichen Bedingungen“ entwickelte[5], konnten sie eine Autonomie der Disziplin gegenüber der Gesellschaft behaupten. Dies hatte zur Folge, dass die „kritische Architektur“ zwar die gesellschaftlichen (Fehl-)Entwicklungen kommentieren bzw. „indizieren“ konnte, dafür jedoch jeglicher Möglichkeit unmittelbarer Einflussnahme beraubt und infolgedessen marginalisiert wurde.
Das Karussell der Theorie drehte sich derart schnell, dass viele Architekten, die nur auf der Suche nach einer passenden Entwurfstheorie für ihren praktischen Alltag waren, sich schwindelig abwandten - ernüchtert und enttäuscht, dass diese schönen Theorien sich nicht unmittelbar in die Praxis „umsetzen“ ließen. Wie ein neues Spielzeug, das zu komplex ist und nur erratisch funktioniert, wird die Theorie von vielen seitdem mit Nichtbeachtung gestraft. Zudem scheint es, als habe sich die Theorie in dieser rasanten Entwicklung selbst verausgabt.
Das langsame Sterben der Theorie wurde anfänglich von der spielerisch bunten Programmatik holländischer Prägung überdeckt. Erst nachdem auch SuperDutch seine Zugkraft verlor, trat die Sprachlosigkeit des grauen Theoriealltags vollends ins Bewusstsein: Eine bleierne Begriffs- und Theoriemüdigkeit hat sich über den Architekturdiskurs gelegt. Mit der Abwendung von den linguistischen Leitbildern der 1970er und 80er Jahre ging der Abschied von der „kritischen Theorie“ einher.
Diese amerikanisch dominierte, jedoch dezidiert auf europäische Diskurstraditionen aufbauende Theorieproduktion wurde mit dem Milleniumswechsel zu Gunsten eines genuin amerikanischen Projekts aufgegeben: Die Wiederentdeckung des Pragmatismus als eigenständige amerikanische Philosophie war gewissermaßen die Geburtsstunde einer jüngeren Theoretikergeneration, die sich damit aus der Umklammerung des von Peter Eisenman und Co. über Jahrzehnte beherrschten, kritischen Diskurses befreien konnte.[6]
Post-Kritik
Get down and dirty
Diese Kontroverse um die so genannte Post-Kritik ist jedoch nicht nur ein akademischer Generationskonflikt. Sie spiegelt vielmehr das Unbehagen einer jüngeren Generation wider, die in der Gleichsetzung der Architektur mit Widerstand und Negation eine für sie nicht hinnehmbare Einschränkung der Praxis sieht. Diese Generation wirft den Protagonisten des kritischen Projekts vor, mit ihrer Haltung die Kluft zwischen Theorie und Praxis vertieft und damit die beschriebene Marginalisierung vorangetrieben zu haben, da die „kritische Architektur“ freiwillig wichtige gesellschaftliche Felder, wie die Beschäftigung mit der Konsumwelt, preisgegebenen habe. So betrachtet waren die Debatten um den (Neo-)Pragmatismus[7] lediglich „Lockerungsübungen“ und Vorboten einer Polemik um "das Ende der „kritischen Architektur“ [...], die bis zur Prophetie vom Ende der Theorie reichen."[8] Mit der nun von Robert Somol und Sarah Whiting ausgerufenen „projektiven Architektur“[9], die statt auf Kritik auf Praxis, d.h. auf Projekt, Wirkung und Performanz ausgerichtet ist, wird dieser Pragmatismus in ein architektonisches Programm überführt.
Vom europäischen Standpunkt aus betrachtet handelt es sich um eine typische, hoch elitäre Ostküstendebatte, die jedoch eine gewisse Ambivalenz besitzt: Die Texte changieren im Ton zwischen akademischem Diskurs und Bezügen zur Populärkultur. Diese Verweise auf die Popkultur, auf Kino, Musik und Fernsehen signalisieren den Wunsch, den Elfenbeinturm der Theorie zu verlassen und sich stärker auf die Alltagswelt einzulassen, sich die Hände schmutzig zu machen.
Wie schnell deutlich wird, geht es den Protagonisten dieser Debatte also nicht darum, die Theorie ad acta zu legen, sondern den performativen Charakter der Architektur wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Oder anders gesagt: Es erfolgt eine Verschiebung vom Was der Repräsentation hin zum Wie der Präsentation. Genau hier rührt die Debatte im Kern an ein wiederkehrendes programmatisches Grundproblem: Der Widerstreit zwischen Theorie und Praxis, Ratio und Gefühl, Repräsentation und Präsenz, Sinn und Performanz oder zeitgenössischer: „hot“ und „cool“[10].
Konjunktur des „Affektiven“
Es ist eine alte Kontroverse, deren theoretische Ausformulierung man bis ins 18. Jahrhundert zurück verfolgen kann. Im Grunde lässt sich diese Auseinandersetzung auf die Dualität von Geist und Körper, von „Abstraktion und Einfühlung“[11] zurückführen, auf das Ungenügen, das angesichts der Moderne immer wieder beklagt wurde: die einseitige Bevorzugung des abstrakten Verstands. Der Philosoph Jürgen Safranski fasst dieses Ungenügen in seiner Schiller-Biographie prägnant in den Satz: "Aufklärung und Wissenschaft haben sich bloß als „theoretische Kultur“ erwiesen, eine äußerliche Angelegenheit für „innerliche Barbaren“."[12] Für Safranski stellt Schillers Abhandlung „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ in diesem Kontext gar ein „Gründungsdokument einer Theorie der Moderne“ dar. In der Schrift gehe es vor allem „um die Lokalisierung des Ästhetischen im gesellschaftlichen Zusammenhang und damit auch um die Bedingungen und Möglichkeiten der Lebenskunst in der Moderne.“[13] Und diese Lebenskunst ist nur in der Versöhnung von Ratio und Gefühl zu erreichen, durch eine Erkenntnis, die „eingehüllt ist ins Gefühl“. Diese gesellschaftliche Verortung des Ästhetischen, des Ausdrucks und der Wirkung ist heute, in einer Welt, die das Ästhetische zum Paradigma erhoben zu haben scheint, aktueller denn je: "Die ästhetische Welt ist nicht nur ein Übungsgelände für die Verfeinerung und Veredelung der Empfindungen, sondern sie ist der Ort, wo der Mensch explizit erfährt, was er implizit immer schon ist: der „homo ludens“"[14]
In dieser Entwicklungslinie betrachtet ist es nicht verwunderlich, dass einer der Schlüsselbegriffe in der post-criticality-Debatte die „Sensibilität“ ist, ein Begriff, der einem ganzen Zeitalter seinen Namen geliehen hat: das Zeitalter der Empfindsamkeit. Denn in dieser Epoche wurde das Gefühl als Medium konzipiert, das zwischen einer „Sensibilité morale“ und „Sensibilité physique“ vermitteln sollte, um den Graben zwischen Geist und Körper zu überbrücken.[15]
Ist diese Sensibilität vielleicht auch geeignet, um die „Entfremdung“, die durch die etablierte Arbeitsteilung zwischen Theorie und Praxis in der Architektur entstand, zu überwinden?
Gegenwärtig kann man wieder eine regelrechte „Konjunktur des Affektiven“[16] nicht nur innerhalb der Architektur, sondern als allgemeinen gesellschaftlichen Trend feststellen: In der Kunst, den Kulturwissenschaften und Medien, selbst in den Wissenschaften spielt die Erforschung der Affekte eine große Rolle. Die Hinwendung zu den Affekten spiegelt die Sehnsucht wider, über die ästhetische Wahrnehmung einen basalen Zugang zur Welt zu erschließen. Für die Architektur bedeutet das, dass statt einer reflexiven/kritischen und interpretierenden Praxis die Wirkung von Architektur wieder in den Vordergrund tritt, und zwar Wirkung in dem Sinne, dass die Architektur fähig ist, (alternative) Lebensentwürfe zu projektieren. Über die Effekte, die wiederum Affekte produzieren, soll Architektur unmittelbar und nicht über den Umweg der Sinndeutung wirken. Damit ist natürlich ein ganzer Bündel architektonischer Mittel bereits impliziert: Materialität, Performanz, Körperwahrnehmung, Taktilität, Stimmung, Sinnlichkeit, Sensibilität und nicht zuletzt Atmosphäre.
Atmosphäre
Die Atmosphäre als allumfassende, weil diffuse Kategorie wird in diesem Kontext gerne bemüht. Sie bietet in ihrer Unbestimmtheit einen Raum für Projektionen, der viele Sehnsüchte befriedigt. Denn die „atmosphärische Interaktion“ scheint als eine vorbewusste, prä-sprachliche, kognitive Reaktion, die beim Affekt ansetzt, für eine „konzeptionelle Einbeziehung der Wahrnehmung und Vorstellungswelt des Betrachters“[17] immer schon besonders geeignet. Seit jeher wurde diese „Einbeziehung“ vor allem als Herrschaftsinstrument erfolgreich angewandt: So bedienen sich Religion und Politik seit Jahrtausenden der Atmosphäre der Sakralität und der Macht. Neu an dem Interesse am Atmosphärischen ist der emanzipatorische Aspekt, der dabei in den Vordergrund rückt. So treten die Protagonisten der Post-Criticality für die „Produktion von individuellen, mehrdeutigen und synästhetischen Rezeptionsmöglichkeiten“ ein.[18] Statt wie gewöhnlich das Atmosphärische als Beiwerk und dekorative Ausmalung aufzufassen, wird das identitätsstiftende Potential von Atmosphären, Geist und Wesen einer Lebensverfassung transportieren zu können, angesprochen.
Genau an diesem Punkt gewinnt das Atmosphärische an sozialer Prägnanz: „Atmosphären haben, da sie innerhalb der westlichen, visuell dominierten Kultur beiläufig wirken, authentifizierende Funktionen (übernommen).“[19] In einer Welt, die in Subkulturen zerfallen ist, gewinnt das Authentische, das eine Aura der Dinge zu vermitteln in der Lage ist, immer mehr an Bedeutung. Daher besitzt das Atmosphärische für den Philosophen Reinhard Knodt ein wichtiges gesellschaftliches Potential, das er in einer Art „atmosphärische Kompetenz“ verortet: „Diese ist eine wichtige Verständnisbasis für Gemeinsamkeit in einer Weltkultur der subkulturellen Differenz.“ In der Atmosphäre besitzt die Architektur demnach ein Kommunikationsmittel, das einer übergreifenden und einbeziehenden Verständigung dienen kann, da „jedermann im Alltag [...] in einem gewissen Maß über diese Kompetenz (verfügt).“[20]
Auch wenn das Potential des Atmosphärischen gerade in der Abwesenheit verbindlicher ästhetischer Kategorien besteht, was es zugleich so schwierig macht, darüber zu diskutieren, ist dieses optimistische Konzept von Atmosphären durchaus fraglich. Denn wie die (Architektur-)Geschichte zeigt, lassen sich Atmosphären nicht nur als Herrschaftsinstrument vereinnahmen, sie sind darüber hinaus keineswegs so voraussetzungslos und inkludierend, wie dies häufig angenommen wird, sondern beruhen ihrerseits wiederum auf kulturellen Konventionen, die sehr wohl eine „Entschlüsselungsleistung“ voraussetzen.[21]
Produktion von Präsenz
Es wäre daher treffender und erhellender, statt von Atmosphären zu raunen, mit Hans Ulrich Gumbrecht von der „Produktion von Präsenz“ zu sprechen: Präsenz im Sinne einer Diesseitigkeit, einer „affektiven“ Körperlichkeit. In diese Richtung zielt Gumbrecht, wenn er in seinem Buch „Diesseits der Hermeneutik. Über die Produktion von Präsenz“ die Dichotomie „Sinnkultur“ versus „Präsenzkultur“ zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung der Präsenz auflösen möchte. Denn nach Gumbrecht habe die westliche Diskurstradition zu lange zu einseitig auf die hermeneutische Methode, d.h. auf die kritische Diskussion von Begriffen und deren Interpretation gesetzt und dabei das ästhetische Erleben als Grundkonstante menschlichen Daseins verdrängt, so dass uns der sinnliche Zugang zur Welt größtenteils abhanden gekommen sei.
Mit dem Begriff der Präsenz werden Körper und Sinne wieder in den theoretischen Diskurs eingeführt. Die damit verbundene „Relativierung der (Wort-)Sprache zugunsten anderer Kommunikationsformen“ führt nach der Kulturwissenschaftlerin Marie-Louise Angerer zu einer "doppelte(n) erkenntnistheoretische(n) Umkehrung: von der Frontalposition des „Gegenüber“ (Buch, Theater) zum „Eintauchen“. [...] Das Eintauchen und Hineingezogenwerden gehört zu den interessantesten Neuerscheinungen: Es führt zu einem „Ende der Theorie“ und der sie begleitenden Distanz".[22]
Genau auf die Überwindung dieser Distanz gehen alle Bemühungen der Debatte um Post-Criticality. Wenn Robert Somol und Sarah Whiting in ihrem Manifest den Gegensatz „hot“ versus „cool“ aufstellen und das Performative der Architektur herausstellen, wenn Sylvia Lavin die Architekturtheorie im Sinne eines „Criticism“ neu begründen möchte und das Verhältnis des Kritikers zum Gestalter als ein Liebesverhältnis beschreibt und dabei eine „critique passionée“ einfordert, dann zielen sie auf eine Nähe, ein Involviertsein, eine Zeitgenossenschaft, die charakteristisch ist für diese Bestrebungen. Leidenschaft wird der Kühle der analytischen Kritik vorgezogen, auch wenn man sich damit angreifbar macht.[23] Nur in diesem Sinne und nicht politisch ist die Abwendung von der „Kritik“ gemeint, denn man kann die meisten Protagonisten dem aufgeklärten liberalen Lager zurechnen, die alternative Lebensentwürfe projektieren möchten, statt nur die gesellschaftlichen Bedingungen zu kritisieren. Und nur in diesem Sinne kann man auch den Beteuerungen Glauben schenken, dass Atmosphären „soziale Möglichkeiten“ beinhalten.[24]
Das Prinzip der Immersion
Wie diese Distanz mittels einer Produktion von Präsenz überwunden werden kann, hat Angerer mit den Stichworten „Eintauchen und Hineingezogenwerden“ angedeutet: Sie sind der Schlüssel für die Schaffung von immersiven Environments. Angerer benennt damit zugleich das Besondere der „architektonischen Betrachtungsweise“, wie sie der Kunsthistoriker Dagobert Frey in seinem berühmten Essay „Wesensbestimmung der Architektur“ aus dem Jahre 1925 ausgearbeitet hat. Nach Frey liegt das Wesen der Künste nicht in abstrakten kunsthistorischen Systemen, sondern in der Art und Weise, wie wir sie ästhetisch betrachten. Innerhalb einer Fülle von ästhetischen Betrachtungsweisen wie malerisch oder plastisch ist die „architektonische Betrachtungsweise“ lediglich eine Modalität des ästhetischen Erlebens neben anderen, die sich durch ein spezifisches einschließendes Wirklichkeitsverhältnis auszeichnet. Mit der „architektonischen Betrachtungsweise“ wird also ein ästhetischer Vorgang beschrieben, den wir heute zeitgemäß mit Immersion umschreiben würden.
In dem Sinne ist Architektur nach Peter Sloterdijk „vor allem anderen Immersionsgestaltung“[25] und Architekten machen nichts anderes als In-Theorie.[26] Auch für Sloterdijk steht dabei das Gefühl im Mittelpunkt, denn es gehe „beim Häuserbauen um ein Problem der Liebe“. Architektur sei ein Ort, an dem man sich „total“ öffnen und hingeben müsse: „Der Totalitarismus der Architektur ist ein Totalitarismus der Liebe, der Raumliebe, der Hingerissenheit durch das, was uns nicht nur gegenüber ist, sondern uns wie eine Hülle umgibt.“[27] Dieses „topophile Gefühl“[28] sei Voraussetzung dafür, dass der Mensch sich entgrenzen und in künstliche Environments eintauchen kann. Immersion ist daher eine Technik der Entgrenzung, gewissermaßen „ein Entrahmungsverfahren für Bilder und Anblicke“[29].
„Doch was, wenn wir Bilder nicht mehr als getrennt von unserem Körper wahrnehmen können, sondern wenn wir in die Bilder hinein gezogen werden?“, fragt Marie-Louise Angerer zu recht. Was, „wenn diese Bilder die repräsentative Ebene umgehen und auf den präsprachlichen Körper einwirken“? Genau hier greift für Angerer der Affektbegriff, da "der affektive Körper als „framer“ der nicht mehr gerahmten Bilder besonders gefragt" sei.[30] Hier schließt sich der Kreis: Sloterdijks „Entrahmungsverfahren“ produziert also immersive Umwelten, die am Ende auf den Körper als „Rahmen“, als Wahrnehmungsinstrument angewiesen sind.
Ausblick auf eine projektive Architektur
Und die Moral der Geschichte? Wie lässt sich aus all dem ein „Projekt“ ableiten? Lassen wir die Theoretiker noch einmal zu Wort kommen, bevor die Praktiker sich ans Werk machen dürfen. Was die Moral betrifft, ist Sloterdijk auch hier um keine Antwort verlegen: „Zur Ethik der Raumerzeugung gehört die Verantwortung für die Atmosphäre.“[31] Eine Ethik ist sicherlich ein solides Fundament für ein avanciertes Projekt, darauf lässt sich bauen. Fragt sich nur mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck?
Zwei der zentralen Begriffe der Diskussion, nämlich „projektiv“ und „performativ“, geben zumindest einen Hinweis auf die Richtung: „Das Adjektiv projective bietet hierbei ähnliche Assoziationen wie im Deutschen: es bezieht sich sowohl auf Projektion, also ein bildgebendes Verfahren (...), als auch auf Projekt, also Plan, Entwurf oder Vorhaben für die Zukunft.“[32] Mit der Ausrichtung am Plan greifen Somol/Whiting eine Richtung der Architektur auf, die auf den russischen Konstruktivismus zurückgeht und über Rem Koolhaas in die Gegenwart ausstrahlt: den Plan als sozialen Kondensator zu begreifen, als eine Disposition, die zu unvorhergesehenen Verhaltensweisen anregen und damit neue Lebensformen umschreiben und hervorbringen kann. Dieses Verständnis hatte Koolhaas in Delirious New York anhand der Beschreibung des Downtown Athletic Clubs zu reaktivieren versucht.
Und gerade wenn es darum geht, neue, auch unvorhergesehene Verhaltensweisen anzuregen, vielleicht sogar anzustiften, kommt die Performanz als zweiter zentraler Begriff der Diskussion zum Tragen. Denn schließlich ging es dem Konstruktivismus letztlich um die Überzeugungskraft des avantgardistischen Plans, welche eine Modellierung des Neuen Menschen nach einem utopischen Menschenbild und dessen Alltag nach vorgreifenden Lebensformen gewährleisten sollte. Der Plan war die konkrete Utopie, die Projektion in die Zukunft und die geplante Welt der soziale Kondensator.
Statt jedoch die gescheiterten Utopien des 20. Jahrhunderts zwanghaft zu wiederholen oder sich gar grundsätzlich vom Projekt der Moderne zu verabschieden und sein Heil in einem neuen Formalismus, welcher Provenienz auch immer, zu suchen, will die „projektive Architektur“ performativ nach vorne denken. Projektiv meint demnach Projekt und Projektion, wie man in Anspielung auf Manfredo Tafuri sagen könnte, und nicht mehr progetto e utopia. Doch was bedeutet es gegenwärtig, den Plan performativ in die Zukunft zu verlängern, wenn uns der Glaube in lineare Projektionen abhanden gekommen ist?
Somol/Whiting und Co. bleiben hier eigenartig strategisch diffus. Ohne sich weiter zu positionieren, wechseln sie das Schlachtfeld und eröffnen einen neuen Schauplatz der Auseinandersetzung: Im Visier ist nicht mehr der Sozialkörper des Menschen, wie er durch gesellschaftspolitische Strukturen definiert und geformt wird, sondern die Modellierung seines realen Körpers, dem sie sich unter dem Aspekt der Emotionen, Affekte und Empfindungen zu nähern versuchen. Zielte der russische Konstruktivismus auf den Sozialkörper des Menschen, so suchen sie einen unmittelbareren Zugang und den direkten Zugriff von den Effekten auf die Affekte. Dieses neue Terrain, das sich z.T. mit der Werbung, der Werbephotographie, dem Werbefilm überschneidet, soll hier für eine politische Debatte gewonnen werden, um Gesellschaftspolitik durch eine „Politik am Körper“[33] zu ergänzen. Doch wie kann diese Politik aussehen und wie kann die Architektur hierbei eingreifen - das wären wohl die Fragen, um die es gehen müsste, gerade auch im Hinblick auf die allseitige Kritik. Und vielleicht ist es darum gerade an dieser Stelle, mit Blick auf die fehlenden Antworten, auch Zeit für fruchtbare Missverständnisse.
Politik am Körper
Die Debatte um Post-Criticality erscheint bisher als eine durch und durch amerikanische Angelegenheit, scheinbar leicht zu erklären aus den Bedingungen eines akademischen Architekturdiskurses, im Gegensatz zu der europäischen Tradition, wo an den Universitäten vorwiegend Praktiker lehren und die Verknüpfung von Theorie und Praxis immer schon zu Gunsten der Praxis ausgefallen ist. Damit hängt auch die eingangs erwähnte Theoriemüdigkeit zusammen: immer weniger Studenten und Architekten an den Universitäten scheinen bereit für eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Disziplin und bevorzugen dagegen eine immer stärkere Ausrichtung auf die Praxis. Aus diesem Blickwinkel, und das ist eben das möglicherweise produktive Missverständnis, erscheint nun die Debatte um die Post-Criticality in gewisser Weise nicht als ein Weniger sondern ein Mehr an Theorie: eben als eine Möglichkeit, die Praxis wieder stärker an einen theoretischen Diskurs anzubinden, gerade durch die Fokussierung auf die affektiven Aspekte der Architektur. Denn nur wenn es den Vertretern der Post-Criticality gelingt, das Gerede von möglichen alternativen Lebensentwürfen auch tatsächlich in einem Projekt zu benennen, wird es sinnvoll sein, die kritische Position hinter sich zu lassen und sich im Sinne der affektiven, unbewussten Qualitäten der Architektur wieder stärker politisch im Sinne einer „Politik am Körper“ einzumischen.
Diese „Politik am Körper“ sucht über die Effekte, die Affekte steuern, einen unmittelbaren Zugang zum Menschen und nicht mehr mittelbar über den Umweg hermeneutischer Interpretationen. Damit zeichnet sich ein Architekturkonzept ab, das um drei ineinander verschachtelte Begriffe kreist, nämlich projektiv, performativ und affektiv. Auf Seiten der Architektur gewinnen dadurch Fragen der Materialität, Textur, Atmosphäre eine gänzlich neue und neu zu diskutierende Bedeutung, während es auf Seiten der Benutzer die Fragen der Kontextualisierung, historisch die Fragen der Empfindsamkeit sind. Mit der Möglichkeit einer neuen sozialen Relevanz erwächst jedoch zugleich die Gefahr einer Architektur der materialen Verführung, oder abgeschwächter, der materialen Wirkung. Eine Gefahr, die in ihrer Affektsteuerung und ihrer Nähe zu den „heimlichen Verführern“[]aus Werbung, Marketing und behaviourism liegt.
Nun kann man einwenden, dass die Moderne immer schon eine bestimmte Form von „Politik am Körper“ war. Sieht man nämlich in der Politik mehr als Machtkämpfe, und im Politischen einen Konflikt um die Schaffung oder Verweigerung von Einfluss - im Rancièreschen Sinne eine Bühne der Sichtbarmachung -, dann kann man beispielsweise die Auseinandersetzung um die Frankfurter Küche durchaus politisch führen, gerade weil sie Politik ausschließlich als eine raum-zeitliche Frage thematisiert. Gemeinhin wird die Frankfurter Küche entweder als ein Beispiel für die Anwendung des Taylorismus in der Architektur kritisiert oder als eines für die Emanzipation der Frau verteidigt. Beide Positionen übersehen paradoxerweise ihre architektur-räumlichen Folgen, was die Ordnung des Wohnens im Ganzen wie der Küche im Einzelnen betrifft. Die Kritik an der Abkehr von der Wohnküche zugunsten einer funktionalen Serviceeinheit vernachlässigt, dass erst mit dieser neuen Ordnung der Dinge im Kleinen die Ordnung der Dinge im Großen in Form des freien Grundrisses möglich wurde. Also nicht Fragen der Emanzipation der Frau von unnötiger Hausarbeit durch die Mechanisierung der Hausarbeit machen das, zugegeben Zeittypische der Politik der Architektur aus, sondern die Beziehung zwischen Architektur und Gesellschaft, die im Fall der Frankfurter Küche zu neuen Raumdispositionen und somit zu neuen Lebensformen und -räumen führte.
Diese „Politik am Körper“ konstituiert somit eine neue Ordnung der Dinge - Wahrnehmungsweisen, die nicht mehr differenzieren nach Innen und Außen, Raumdispositionen, die nicht mehr unterscheiden nach Privatheit und Öffentlichkeit und Zeitvorstellungen, die nicht mehr gerichtet sind. Nur dass der Unterschied heute darin besteht, dass es nicht mehr um ideale Sozialkörper, sondern um konkrete Körper geht. Auch haben sich die Techniken des Zugriffs soweit ausdifferenziert, dass eine ganz andere Art von individueller Modellierung möglich wird, die auch dem Individuum einen größeren Spielraum lässt.[34]
An dieser Stelle können wir noch einmal Marie-Louise Angerer bemühen, für die die Neuen Medien und die viel beschworene „digitale Revolution“ eine, sagen wir, „affektive Wende“ eingeleitet haben. Was zunächst paradox erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als eigentlicher Paradigmenwechsel unserer Zeit. Denn erst mittels der technischen Entwicklung sind wir in der Lage, Subjektivität auf „radikalste Weise“ zu erleben: "Denn in der Tat war es die „digitale Revolution“, die den Umschwung von der Sprache hin zum Affekt und Gefühl eingeläutet hat. Von Taktilität war von Anfang an die Rede, von Augenblicklichkeit, Unmittelbarkeit, von der Auflösung von Zeit und Raum [...]. Herrliche Zeiten stünden bevor, weil wir uns endlich von all diesen poststrukturalistischen Denkern verabschieden könnten: Ihre Theorien würden uns nämlich im Netz leibhaftig begegnen."[35]
So gesehen ist der zu Beginn ausgestellte Totenschein für die Theorie ungültig. Nicht der Tod der Theorie ist also zu beklagen, vielmehr deren Aufgehen in der Praxis, deren Performanz gilt es zu feiern.
ARCH+, Do., 2006.06.15
verknüpfte Zeitschriftenarchplus 178 Die Produktion von Präsenz