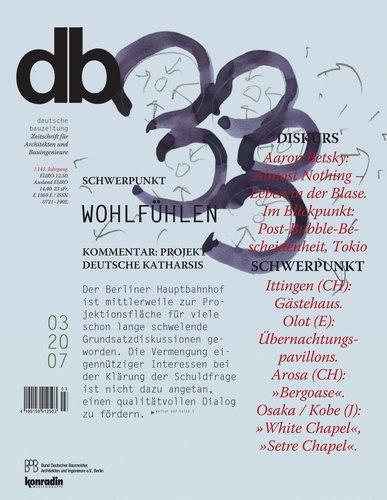Editorial
Die einen bilden die vermeintliche Plüschigkeit heimischer Wohnzimmer nach, damit sich die Übernachtungsgäste bei ihnen wohlfühlen. Andere nehmen die Maxime, dass der Kunde König sei, etwas zu ernst und bauen regelrecht Paläste. Wieder andere lassen ihre Designer-Einrichtungen alle vier Jahre neu stylen, um weiterhin als »hip« zu gelten. Doch eigentlich benötigt der Reisende im Hotel nur die Möglichkeit, sich für einige Momente zurücklehnen zu können und zur Ruhe zu finden. Schließlich werden die Aufenthalte immer kürzer, die Reisen hektischer.
Einige Hoteliers spüren zusammen mit ihren Architekten den Möglichkeiten nach, jenseits von Messingglanz und Designer-Spleens Erlebnisse mit Mitteln der Architektur zu schaffen. Neben dem rein körperlichen Wohlbefinden spielt dabei auch das seelische Gleichgewicht eine bedeutende Rolle. Die Ansätze reichen von Askese bis Naturerlebnis, von Wellness bis Spiritualität. ge
Inhalt
Diskurs
03 Kommentar
Projekt deutsche Katharsis – Berliner Hauptbahnhof | elp
06 Magazin
12 On European Architecture
Almost nothing: Life in the bubble | Aaron Betsky
14 Im Blickpunkt
Architektur und Stadtentwicklung in Tokio | Ulf Meyer
18 Schwerpunkt: Wohlfühlen außer Haus
20 »Parkhotel« in Ottensheim bei Linz (A), Andreas Strauss, Gunda Wiesner | Romana Ring
24 Unteres Gästehaus, Kartause Ittingen (CH), Regula Harder, Jürg Spreyermann | Judit Solt
32 Hotelpavillons »Les Cols« in Olot (E), RCR Arquitectes | Klaus Englert
38 Wellnessbereich »Tschuggen Bergoase« in Arosa (CH), Mario Botta | Andrea Eschbach
42 Zur Lichtplanung der »Tschuggen Bergoase« | cf
46 White Chapel, Hyatt Regency, in Osaka (J) und Kapelle Des Setre Hotels in Kobe (J), Jun Aoki & Associates; Ryuichi Ashizawa Architects | Sergio Pirrone
52 ... in die Jahre gekommen
Madonna Inn in San Luis Obispo, Kalifornien | elp
Empfehlungen
58 Kalender
58 Ausstellungen
- Eero Saarinen (Oslo) | Ulf Meyer
- Modernity in the Tropics (Rotterdam) | Hubertus Adam
60 Neu in …
- Berlin | Urte Schmidt
- Freiburg | Falk Jaeger
- Zürich-Altstetten (CH) | Hubertus Adam
62 Bücher
Trends
64 Energie
Bauen mit Lehm
~Jola Horschig
72 Ökonomie
Eine Wohnung in Berlin
~Gudrun Escher
76 Produkte
Sanitärtechnik, Küchen, Inneneinrichtung | rm
90 Infoticker | rm
92 Schaufenster
Armaturen | rm
94 Schwachstellen
Abdichtungen im Mauerwerk | Rainer Oswald
Anhang
100 Planer / Autoren
101 Bildnachweis
102 Vorschau / Impressum
Detailbogen
103 Wellnessbereich »Tschuggen Bergoase« in Arosa
106 Unteres Gästehaus, Kartause Ittingen
Inneres Glühen
Am Fuß der spanischen Pyrenäen errichteten die ortsansässigen Architekten in minimalistischer Glasarchitektur fünf außergewöhnliche Hotelpavillons. In den Innenräumen der meditativen Unterkünfte stört nichts den Eindruck von Klarheit, Ruhe, Einsamkeit.
Mit weit über fünf Millionen Besuchern jährlich verzeichnet Barcelona derzeit die höchste touristische Zuwachsrate unter den europäischen Städten. Die Hotelbranche hat sich bereitwillig auf diese Entwicklung eingestellt und reagiert mit bemerkenswerten Neubauten: Vom Meeresufer bis weit über Barcelonas neues Stadtsignet – Jean Nouvels Torre Agbar für die Wasserwerke »Aguas Barcelona« – hinaus, bis in die südliche »zona franca« zwischen den Vororten der Metropole und dem Flughafen hinein, entstehen Hotels namhafter Architekten. So baut zum Beispiel Dominique Perrault an der Avenida Diagonal das »Habitat Sky«, ein 120 Meter hohes, mit einer metallisch glänzenden Haut überzogenes Zweischeiben-Haus, und Enric Ruiz-Gelis das »Hotel Hábitat«, dessen Fassade in der Nacht von einem Netz aus Fotovoltaikzellen erleuchtet werden soll.
Doch auch Reisende, die es vorziehen, eher außerhalb des städtischen Trubels zu wohnen, kommen auf ihre Kosten: Weit entfernt vom Zweitresidenz-Gürtel deutscher Touristen am Meer empfiehlt sich das Städtchen Olot inmitten des Vulkangebiets Garrotxa als Refugium für den Großstadtflüchtling. Die intimen Hotelpavillons »Les Cols« des heimischen Architekturbüros RCR sind eine überzeugende Alternative zu den Designhotels Barcelonas.
Architektur im Vulkangebiet
Hinter dem Kürzel RCR verbergen sich die Architekten Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramón Vilalta. Die drei hatten sich während des Studiums an der renommierten Architekturfakultät in Barcelona kennengelernt und entgegen der Ratschläge ihrer Professoren und Kollegen entschieden, der Karriereschmiede der katalonischen Metropole den Rücken zu kehren und in ihrer gemeinsamen Heimatstadt Olot ein Büro zu gründen. Dabei bauten sie eine lebendige Arbeitsgemeinschaft auf, die auf kollektive Entscheidungen setzt. Seit Ende der neunziger Jahre entstanden fast alle Projekte von RCR im Vulkangebiet La Garrotxa. So zum Beispiel ein schmaler, lang gestreckter Badepavillon, der wie selbstverständlich am Ufer des Río Fluvia steht, oder das Stadion Tussols-Basil, eine Leichtathletikanlage, die sich in die Lichtung eines Eichenwaldes einfügt und sich als gelungene Verbindung von Natur und Architektur erweist.
Im letzten Jahr hat das Büro zwei weitere Projekte am östlichen Stadtrand von Olot realisiert: ein Restaurant, das in ein altes katalonisches Bauernhaus eingefügt wurde, und fünf Gästepavillons, die auf dem angrenzenden Grundstück entstanden sind. »Les Cols« (katalanisch: die Kohlköpfe) ist in Spanien bereits zu einem Geheimtip geworden; die Küche verbindet lokale Tradition mit ausgetüftelter Finesse, und die Architektur zeigt, dass RCR einem spanischen »paisajismo« folgen, der keineswegs orthodox ist, sondern immer wieder für originelle Raumlösungen sorgt. So haben sie den traditionellen Gemeinschaftsraum des Bauernhauses in einen goldlackierten Bankettsaal mit einem zwanzig Meter langen goldenen Tisch, goldenen Stühlen und Wänden verwandelt.
Ganz aus Glas
Nach diesem Farbenrausch überraschen die Pavillons durch ihre nüchterne, fast unauffällige Erscheinung und Konstruktion. Doch die Architektur ist hier längst nicht alles, auch das Zelebrieren von Ritualen gehört dazu: Der Hotelgast wird von der jungen Hotelbesitzerin Judit Planells in ein kleines, schummriges Vestibül geleitet, in dessen Mitte lediglich ein Tisch mit Kohlköpfen und brennenden Kerzen steht. Hier wird der Gast charmant mit den Gesetzen des Hauses vertraut gemacht, den Hotel- und Zimmercodes sowie den Servicezeiten. Das ist in der Tat notwendig, denn in »Les Cols« ticken die Uhren etwas anders. In Begleitung von Judit Planells gelangt man nun auf einem eingefassten Pfad mit schwarzem vulkanischen Kieselboden, vorbei an Palisaden aus grünlich schimmernden Glaslamellen, zum eigenen Pavillon, dessen Tür sich nur mit dem selbst gewählten Zahlencode öffnen lässt. Jede Wohnstatt besitzt einen eigenen Patio aus vulkanischem Gestein, einem ausschließlich fürs Auge geschaffenen Meditationsgarten. Doch der intime Innenhof ist keineswegs das Überraschendste an dieser Anlage: Von einem Vestibül, das lediglich durch eine gläserne Schiebetür vom Wohnbereich getrennt ist, gleitet der Blick ins Innere, und schon kommen erste Zweifel auf: »Und hier soll ich wohnen?« Ist dieser transparente und grünlich schimmernde Zen-Raum, in dem es weder Tisch noch Stuhl und auch keinen High-Tech-Flachbildschirm gibt, tatsächlich bewohnbar? Sichtbar sind nur die Membranen der Matratze, alles andere ist hinter der Wand verborgen. Über Touchscreens im Durchgang zwischen Wohn- und Badezimmer lassen sich in diesem intelligenten Haus sowohl die Beleuchtung als auch Raumteiler und Jalousien bewegen. Nichts stört den atmosphärischen Eindruck von Klarheit, Ruhe und Einsamkeit.
Die Pavillons wirken nie völlig transparent, sondern wie eingetaucht in ein grünliches Dämmerlicht. Es gibt keine Zentralbeleuchtung, sondern viele kleine Lichtquellen, die sich zum Glück ohne längeres Suchen und Probieren an- und ausschalten lassen. In der Nacht kann man dann sehen, dass sich unterhalb des gläsernen Bodens winzige, nach unten gerichtete Strahler befinden. Der gesamte Gebäudekörper hängt an L-förmigen Stahlstützen, von denen die Stahlrahmenkonstruktion abgehängt ist. Diese Konstruktionstechnik erlaubt eine Glasarchitektur bei der, neben gläsernen Wänden, auch gläserne Böden und Decken dominieren. Alles zusammen mit den leicht verspiegelten, stählernen Oberflächen von Wänden und Sanitäreinrichtung verstärkt die immaterielle Ausstrahlung des Pavillons. Allerdings rührt diese Atmosphäre nicht allein von der durchgehenden Transparenz und den Spiegeleffekten her, sondern auch von der klaren räumlichen Ordnungsstruktur, die RCR geradezu mit mönchischer Rigidität eingehalten haben. Stets sind es Kubus und Quader, von denen sich die Architekten inspirieren ließen. Diese Regel setzten sie auch konsequent im Badezimmer, bei der Gestaltung von Duschzone und Badebecken um.
Duschen im Kiesbett
Selten haben sich Architekten mit mehr Sorgfalt dem Badekabinett zugewandt. Es ist eine kompositorische wie ästhetische Meisterleistung, auch wenn man einräumen muss, dass dafür bei einigen Details funktionale Anforderungen geopfert worden sind. Das Wasser im grün schimmernden Waschbecken ist ein gemächlich fließender Fluss und gerät immer dann in Bewegung, wenn sich der Benutzer nähert. Unter der genial einfachen Dusche fühlt man sich wie unter einem Wasserfall, während die Füße in einem seichten Flussbett aus schwarzen Marmorkieseln zu stehen kommen. Nach dem Duschen empfiehlt es sich, in das angrenzende, in den Boden eingelassene Becken – ein sprudelndes japanisches Bad – zu steigen, um sich langsam in den Tag hineinzuträumen. Das ständig zirkulierende Wasser macht es möglich, dass diese Wanne auch für Bademuffel eine Wonne ist.
Alsbald ertönt, etwas unsanft, die Klingel an der Pavillontür und gemahnt an die Gesetze des Hauses. Judit Planells bringt das Frühstückstablett mit Oloter Spezialitäten. Am besten setzt man sich auf die Stufe des Vestibüls, schaut hinaus auf die sanften, gleichmäßigen Linien des Steingartens und genießt beim Frühstück die ruhige Morgenstimmung.
Peu à peu fügt sich der Gast bereitwillig der Ordnung dieser ostasiatisch anmutenden »Mönchszellen« und fragt erst gar nicht nach, was alles fehlt. »Les Cols« dürfte das einzige Hotel der Welt sein, in dem man sich in der Dämmerung auf die Matratze legen und durchs Oberlicht die vorbeiflatternden Fledermäuse beobachten kann. Währenddessen plätschert im Badezimmer sanft das Wasser, und durch die geöffnete Schiebetür strömt frische Luft. Spätestens wenn man des frei umherfliegenden Federviehs im Restaurants gewahr wird, ist klar, dass man sich mitten auf dem Land befindet. Kein Zweifel, in diesem Hotel ist alles unvergleichlich.db, Fr., 2007.03.02
02. März 2007 Klaus Englert
verknüpfte Bauwerke
Hotelpavillons »Les Cols«
Arosa setzt die Segel
Unter hoch aufragenden »Lichtsegeln« schmiegt sich der neue Wellness-Bereich des Fünf-Sterne-Hotelpalastes in den Berg. Mit Behandlungszimmern, Saunen, Ruheräumen, Fitness-Bereich und Schwimmbecken ist das Traditionshaus für die Wintersaison und somit für die Zukunft gerüstet.
Sie sind das neue Wahrzeichen von Arosa: Weißglänzende »Segel«, die überdimensionalen Blättern gleich in die Landschaft ragen. Neun bis 13 Meter sind die Konstruktionen aus Stahl und Glas hoch, tags lenken sie die Sonnenstrahlen in den Wellness-Tempel des Tschuggen Grand Hotels, nachts leuchten sie geheimnisvoll in die Bergwelt von Arosa. Die neun Segel der »Bergoase« setzen ein deutliches Zeichen: Mit dem jüngsten Wurf von Mario Botta erweitert der deutsche Multimilliardär Karl-Heinz Kipp, Besitzer der Tschuggen Hotelgruppe, sein Fünf-Sterne-Haus. Mit Kalkül: Denn das Tschuggen Grand Hotel, 1888 als Sanatorium gegründet, 1966 niedergebrannt und 1970 wiedereröffnet im Gewand funktionaler Architektur, hatte wirtschaftlich schon bessere Zeiten gesehen – keine Ausnahme in der Schweizer Hotellerie, die in den vergangenen Jahren mit sinkenden Übernachtungszahlen und Überkapazitäten zu kämpfen hatte.
Die »Bergoase« ist ein Bau der Superlative: Mit 5000 Quadratmetern Nutzfläche ist es das größte Wellness-Zentrum der Schweizer Hotelszene, die Investitionssumme von 35 Millionen Franken macht es zum teuersten Spa des Landes. Das muss sich auszahlen: Der Ritt auf der Wellness-Welle soll helfen, die Zimmer auch außerhalb der Hochsaison besser auszulasten. Ab 2008 wird das Grand Hotel Tschuggen erstmals auch im Sommer öffnen. Das Hotelmanagement hat eine neue Zielgruppe im Blick: »Die Bergoase hilft uns, die Kundschaft zu verjüngen«, erklärt Spa-Direktorin Corinne Denzler. Galt das Luxushotel bis dato als Refugium einer konservativen Klientel, die in Abendkleid und Smoking zum wöchentlichen Galadinner erschien, soll nun dank Spa und einer gründlichen Renovierung des Hoteltraktes ein neuer Geist Einzug halten. Am 1. Dezember vergangenen Jahres wurde der Wohlfühltempel eröffnet, kurz zuvor war das Tschuggen vom Züricher Wirtschaftsmagazin »Cash« bereits zum »Aufsteiger des Jahres« unter den Schweizer Winterhotels gekürt worden.
»Ich wollte die natürliche Kraft und Schönheit dieser Landschaft nicht stören, schon gar nicht zerstören, und trotzdem hier einen großzügigen Ort der Entspannung und Erholung schaffen«, erklärt Botta. Das ist ihm meisterhaft gelungen. Dabei befand sich der Tessiner Architekt auf unbekanntem Terrain: Eine Wellness-Anlage hatte er noch nie zuvor gebaut. Vor über vier Jahren hatte das Büro Botta in Lugano den Spa-Wettbewerb gewonnen, zusammen mit der Churer Planungsfirma Fanzun realisierte man nun in rund zwei Jahren Bauzeit den Entwurf. Er zeigt deutlich die Handschrift des Meisters. Wie in seinen Kirchen, Banken und Museen nutzt Botta auch hier eine schlichte Formensprache. Und er verwendet nur wenige Materialien: roh belassenen sowie glatt geschliffenen Duke-White-Granit aus Domodossola, Glas und kanadischen Ahorn. Ein Dreiklang, der dem Gast ein Naturgefühl vermitteln und die Verbindung zur alpinen Umgebung herstellen soll. »Arosa ist weder Dubai noch Zürich«, konstatiert Botta. Weder asiatischer Zen-Tempel noch römische Therme sollte sein Spa werden, Klischees galt es zu vermeiden. »Wir wollten eine Anlage, die zeitlos ist und in die Alpen passt«, sagt auch Corinne Denzler.
Geschickt hat Botta die Wellness-Landschaft in den Berghang hinter dem »Tschuggen« gepflanzt. Dass darin fünftausend Quadratmeter Gebäudefläche versteckt sind, vermutet man kaum. »Wir haben uns vorgestellt zu bauen ohne zu bauen« sagt Botta. Dafür wurde der Fels gesprengt, rund 22000 Kubikmeter Stein wurden ausgehoben, zu Steinmehl verarbeitet und dem Beton wieder beigemischt. Die hauptsächlich den Hotelgästen vorbehaltene Anlage ist terrassenförmig auf vier Etagen verteilt. Eine schmale verglaste Passerelle verbindet den zehngeschossigen Hotelbau auf der Höhe des zweiten Stockwerks mit dem Spa. »Wer die Brücke überquert, tritt in eine andere Welt ein«, sagt Botta. Und diese ist keineswegs ein »Höhlen-Spa«, sondern ein freundlicher, sinnlicher Kosmos mit kluger Zonierung. Die Hotelgäste treffen auf der dritten Etage auf eine großzügige Empfangslounge, Garderoben und die Saunawelt. Eine breite Treppe führt von dort hinab in die zweite Etage, die zwölf Behandlungsräume für Schönheitspflege und zwei geräumige Spa-Suiten enthält, aber auch die Schwimmbadtechnik und Lagerräume. Im Erdgeschoss befinden sich Zugang und Garderoben für die externen Gäste, das Medical Wellness Center, ein Fitness-Studio mit Hightech-Geräten sowie Gymnastik- und Meditationsräume. Die nichtöffentlichen Bereiche verfügen über eine eigene Infrastruktur mit Räumen und Treppenhäusern, so dass die Gäste kaum je Angestellten mit Schmutzwäsche begegnen werden. Ohne Wasser kein Spa: Die vierte Etage gehört ganz der Wasserwelt. Betritt man das oberste Geschoss, ist man überwältigt vom Licht- und Schattenspiel. Die Rippen der Sonnensegel zaubern grafische Muster auf Boden, Wände und Wasser. Ein luftiger Ruheraum mit großzügig verstreuten Liegen öffnet sich zu vier Innenbecken hin, die von einer Wand aus unbehandeltem Granit begrenzt werden – der sanfte Schwung der Wand löst die Härte des Steins optisch auf. Der helle Stein färbt das Wasser hellblau-fluoreszierend, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Das große Wasserbecken vor der sanft geschwungenen Wand ist vom etwas kühleren Schwimmerbecken nur durch eine Überlaufrinne getrennt – dadurch erscheinen beide wie eine einzige große Fläche. Daran schließt ein Kneippbecken an sowie ein Duschparcours in der so genannten Arosa-Grotte, der den Besucher die Jahreszeiten durchleben lässt – vom feinen Frühjahrsnieseln über Blitz und Donner. Abgetrennt davon liegt ein Kinderbecken, eine Glaswand sorgt für Geräuschdämmung – nichts soll den Entspannung suchenden Gast ablenken. Der beheizte Außenpool lädt zum Baden mit grandioser Bergsicht ein. Zum sinnlichen Erlebnis wird der Aufenthalt im Spa aber vor allem, wenn es dunkel wird: Man sitzt im Jacuzzi der Spa-Suite und sieht den Schneeflocken zu, man lauscht im Chill-out-Bereich dem Prasseln der offenen Feuerstelle oder man schwitzt in der Bergsauna und lässt danach auf einer der Außenterrassen frische Bergluft an die Haut. Kurzum: Ein Ort, an dem man die Welt vergessen kann.
Großzügigkeit prägt den Bau: weite Korridore, große Freiflächen und hohe Räume umgeben den Besucher mit viel Luft – kein Gedanke daran, dass man sich in einer im Berg versenkten Grotte befindet. Das Ambiente wirkt ruhig und klar. Während die Böden aus poliertem Granit sind, wurden für die Deckenverkleidung Tausende von Ahorn-Lamellen verarbeitet, aus Ahornholz sind auch die fest installierten Möbel. Die Wände sind schlicht grau gestrichen, was den stringenten Materialeinsatz betont – dank dem oft aus überraschenden Perspektiven einfallenden Licht herrscht dennoch keine düstere Stimmung. Denn Botta demonstriert in Arosa die hohe Kunst der Lichtführung. Sein Instrument sind dabei die Lichtsegel. 3,8 Tonnen schwer sind diese postmodernen Varianten des Oberlichts – und wirken dabei doch erstaunlich leicht. Als stilisierte Tannen verweisen sie auf die alpine Umgebung. »Die Form haben mir die angrenzenden Wälder diktiert«, erklärt Botta. Er setzt die Lichtsegel gezielt zur punktuellen Beleuchtung des Bades und der öffentlichen Bereiche ein. Dank versetzter Zwischenböden und viel Glas fällt das Licht durch alle Stockwerke, Durchblicke eröffnen sich von der Pool-Ebene bis ins Fitness-Center: Sehen und Gesehen werden zählt eben nicht nur an der Zürcher Bahnhofstraße, sondern auch in der »Bergoase«. Das Oberlicht war den Auftraggebern jedoch nicht genug: Entgegen Bottas ursprünglichem Plan wurde die Westseite komplett verglast – statt kontemplativer Innensicht also Aussicht auf Skifahrer und Panorama. Wer es besonders licht mag, mietet eine der zwei Spa-Suiten: Dort steht jeweils ein Segel über dem Mosaik-Jacuzzi – ein Luxus für besonders Betuchte. Gegen neidvolle Einblicke von außen schützen dabei eigens angefertigte automatische Jalousien an den Segeln. Bei Einbruch der Dämmerung werden die Lichtbäume von innen heraus weiß, gelb und blau angestrahlt. Ein Bild, das sich einprägt – und genutzt wird: Zusammen mit dem Slogan »Botta-les-Bains« werben die Segel auf Plakaten für einen Besuch in der »Bergoase«.
Einziger Wermutstropfen des kühnen Baus ist die Innenausstattung, mit der Carlo Rampazzi betraut wurde. Der Tessiner Innenarchitekt, der schon bei der Renovation des Hotels auf Prunk und Glamour setzte, versieht Bottas Bau mit Dekor und Mobiliar, das gar nicht zum klaren Stil der Anlage passen will. So finden sich an den Wänden der Behandlungsräume grafische Dekorelemente aus Stucco Veneziano, Trompe-l’oeil-Vorhänge zieren die Damensauna und neo-barocke Sessel laden in der Spa-Suite zur Rast ein. Kitschige Exzentrik prallt hier auf archaische Schlichtheit. Dies fand Botta selbst zuviel des Guten: »Meine Architektur braucht keinen Dekor«, ließ der Baumeister verlauten. Dem ist nichts hinzuzufügen.db, Fr., 2007.03.02
02. März 2007 Andrea Eschbach
verknüpfte Bauwerke
Wellnessbereich »Tschuggen Bergoase«