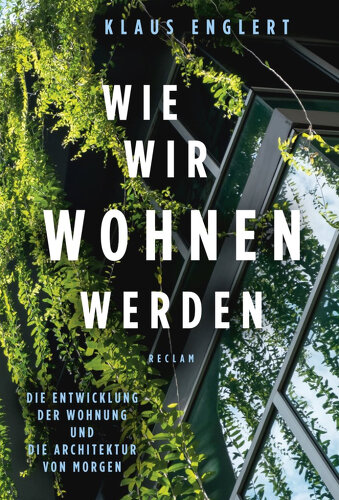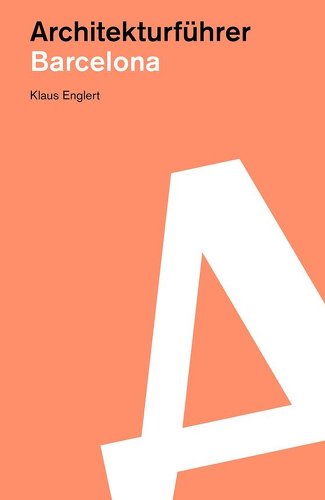Die Niederlande haben sich in den letzten Jahren zu einer architektonisch führenden Nation entwickelt. Dies hat sich keineswegs zufällig ergeben. Eine staatlich koordinierte Baupolitik hat viel zu einer besseren Ausbildung, einem starken öffentlichen Interesse an Architektur und einer Planung von Projekten beigetragen, die im nationalen Interesse sind. Holländische Architekten sind absolute Frühstarter: Sie stehen bereits mitten im Berufsleben, wenn etwa ihre Schweizer Kollegen noch fürs Studium büffeln müssen.
Die Niederlande haben sich in den letzten Jahren zu einer architektonisch führenden Nation entwickelt. Dies hat sich keineswegs zufällig ergeben. Eine staatlich koordinierte Baupolitik hat viel zu einer besseren Ausbildung, einem starken öffentlichen Interesse an Architektur und einer Planung von Projekten beigetragen, die im nationalen Interesse sind. Holländische Architekten sind absolute Frühstarter: Sie stehen bereits mitten im Berufsleben, wenn etwa ihre Schweizer Kollegen noch fürs Studium büffeln müssen.
Vorzüge der Architekturpolitik
Von der pessimistischen Grundstimmung gegenüber Städteplanung und Architektur in unseren Gegenden sind die Niederländer, ein Volk von technokratischen Machern, weit entfernt. Spricht man beispielsweise den Maastrichter Architekten und niederländischen Reichsbaumeister Jo Coenen auf dieses Problem an, verweist er darauf, dass ein grundlegender Reformwille in seinem Heimatland vieles zum Besseren gewandelt hat. «Wir sind dabei, die Niederlande neu zu gestalten», bekennt er selbstbewusst und zeigt die Programmschrift «Die Niederlande gestalten». Es handelt sich um eine sogenannte Nota, in der ausgeführt wird, welchen Richtlinien die staatliche Baupolitik, unabhängig von den jeweiligen Legislaturperioden, in den nächsten Jahren folgen soll.
Coenen, der viele Jahre lang «Gebäudelehre und Entwerfen» an der Technischen Universität Karlsruhe unterrichtet hat, kennt die klaren Vorzüge der niederländischen Architekturpolitik. So versucht er derzeit, die zehn «Grossen Projekte» voranzubringen. Sie reichen von der Erweiterung des Amsterdamer Rijksmuseum bis hin zur «Delta Metropolis», die die Umwandlung des fragmentierten Lebensraums Randstad in ein kohärentes städtisches System bei gleichzeitiger Verbesserung der Verkehrswege vorsieht. Die Effizienz der holländischen Baupolitik liegt aber nicht einfach in der zentralen Koordinierung durch den Reichsbaumeister, sie resultiert aus der Vernetzung verschiedener Initiativen, seien es lokale, regionale oder staatliche Architekturzentren, deren Zusammenspiel die öffentliche Diskussionskultur wesentlich befruchtet. So konnte die Nota «Belvedere», die darauf abzielte, die Wucherung der Städte einzudämmen und den Wert der Landschaft neu zu bestimmen, einen ähnlichen Erfolg erzielen wie die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark, die innerhalb von zehn Jahren das industrielle Ruhrgebiet in einen völlig neuen Kulturraum transformierte.
Piere als Paradiese
Von dieser architektonischen Kultur profitieren selbstverständlich viele in Holland arbeitende Architekten. Beispielsweise der Rotterdamer Adriaan Geuze: Nachdem der Stadtrat in den achtziger Jahren beschlossen hatte, die seit 1979 aufgegebenen Docklands östlich des Hauptbahnhofs zu bebauen, überlegte er, wie das «Oostelijke Havengebied» am Ij revitalisiert und die Stadt näher ans Wasser herangerückt werden kann. Mit Stadtplanern und Investoren setzte Geuze auf die Wiederbelebung der «hollandse waterstad». Auch Jo Coenen war anfangs mit von der Partie. Die beiden erstellten einen Masterplan für die Bebauung einiger Piere, die nicht mehr von Frachtschiffen angelaufen werden.
Coenen war für das erste Projekt, den Wohnungsbau auf der KNSM-Halbinsel, verantwortlich, auf der heute Hans Kollhoffs monumentaler «Piräus-Block» und Wiel Arets' schwarzer Wohnturm wie Landmarken prangen. Geuze widmete sich den Halbinseln Borneo und Sporenburg, wobei er sich an städtischen Konzepten orientierte, die man längst vergessen glaubte: «Im 17. Jahrhundert hatte es in Amsterdam eine hervorragende Stadtplanung hinsichtlich der Strassenführung und der Wasserlinien gegeben. Doch in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatte man jegliche Vorstellung davon verloren, wie eine Stadt gebaut wird. Erst in letzter Zeit kam es zu einer Rückbesinnung auf die alten urbanistischen Vorstellungen des 17. Jahrhunderts. Man versucht nun, das eigene städtische Erbe zu begreifen und wiederzubeleben.»
Adriaan Geuze bewundert Sjoerd Soeters' Bebauung der benachbarten Java-Halbinsel, weil es dort gelungen ist, an die Tradition der Amsterdamer Grachten anzuknüpfen. Aber er weiss, dass dies nicht mit nostalgischer Wehmut, sondern mit einer zeitgenössischen Interpretation der Architektur einhergehen muss. Soeters setzte auf Blockrandbebauung am Ufer und enge Grundstücke an den neuen Grachten, aber jeweils mit einem demonstrativen Individualismus.
Verdichtetes und differenziertes Bauen
Borneo und Sporenburg sind derweil zu einem Paradebeispiel für verdichtetes und differenziertes Bauen geworden. Von langweiligen Reihenhaus- Silhouetten will Adriaan Geuze nichts wissen: «Mich interessiert, dieselben strengen Regeln beizubehalten und doch individuelle Architektur zuzulassen.» Drei Superblöcke, die wie Gletschermassive das ruhige Meer der Wohnhäuser überragen, werden bald die Attraktion der beiden Halbinseln ausmachen. Von den zwei bisher fertiggestellten ist Frits van Dongens «Walfisch», der wie ein gestrandeter Moby Dick aussieht, zweifellos der spektakulärste. Die massiven Blöcke stehen im Kontrast zur niedrigen Gebäudehöhe, die man entlang der Strassen antrifft. Dabei konnte Geuze jegliche Eintönigkeit vermeiden, weil er jedem Architekten gestattete, mit verschiedenen Wohnungstypen zu experimentieren.
Das berühmteste Beispiel ist die Scheepstimmermanstraat auf Borneo, die mittlerweile für viele Architekturbegeisterte zu einem Mekka experimentellen Bauens geworden ist. Hier durften die Architekten ihren ganz eigenen Stil verwirklichen. So errichtete Koen van Velsen für einen holländischen Bergsteiger ein Wohnhaus, dessen gläserne Fronten um einen freistehenden Baum herum angeordnet sind. Anders ging das Rotterdamer Büro MVRDV (Maas, van Rijs, de Vries) vor. Die mittlerweile international bekannten Architekten bieten intelligente Raumaufteilung anstelle kapriziöser Bau-Kunststücke. Ihnen gelang es, extrem engen Grundstücken von 2,5 Metern Breite «das denkbar schmalste Haus» (MVRDV) abzuringen, in dem dennoch räumliche Vielfalt und, dank verglasten Seitenfronten, verblüffende Transparenz geboten werden.
Triumph der Newcomer
Überhaupt sind die Newcomer aus Rotterdam die eigentliche Überraschung in der holländischen Architekturszene. Erst 1999, als sich niemand einen Reim auf das merkwürdige Kürzel MVRDV machen konnte, verblüfften sie alle mit der Sendeanstalt VPRO in Hilversum. Und ein Jahr später debütierten sie auf internationalem Parkett mit ihrem kurios-phantastischen Sandwich-Pavillon für die Expo in Hannover. Auf einmal waren die drei jungen Rotterdamer in aller Munde. Trotz zahlreichen Aufträgen aus dem Ausland ist es ihnen wichtig, weiterhin in den Niederlanden zu bauen, und sogar auf den Amsterdamer Pieren sind sie mit lukrativen, aber höchst unterschiedlichen Projekten vertreten.
Auf der Oostelijke Handelskade renovieren sie erstmals einen denkmalgeschützten Altbau. Das Gebäude, das vor 60 Jahren der Gestapo noch als Internierungslager für Waisenkinder diente, überführt das Rotterdamer Trio derzeit in ein Luxushotel. Ein weiteres Projekt auf dem Silodam ist vor zwei Jahren fertiggestellt worden. Neben zwei ehemaligen Getreidesilos, einer säkularen Backsteinkathedrale und einem Speichergebäude im kargen «Béton brut»-Stil der fünfziger Jahre setzten sie ihr «Containerschiff» ans Kopfende des Silodams. Eine niederländische Tageszeitung titelte damals: «Ein hipper Ozeandampfer, klar zum Auslaufen». Und tatsächlich, der «Dampfer» mit seinen gestapelten Wohncontainern ragt mit seinen wuchtigen Stelzen aus dem Hafenbecken heraus. Weil MVRDV für jeden einzelnen «Container» individuelle Wohnungstypen entwickelte, deren Fassaden durch unterschiedliche Farben hervorgehoben sind, wirkt die knallbunte Schachtel aus dem Experimentallabor des Rotterdamer Avantgarde-Büros wie eine Farbattacke auf die Nüchternheit der sie umgebenden Hafenlandschaft.
Rotterdam gegen Amsterdam
Frits van Dongen, der sein Büro im Amsterdamer Jordaan-Viertel hat, profitierte in den letzten Jahren von der Umnutzung des Amsterdamer und des Rotterdamer Hafens. Beispielsweise errichtete er in Rotterdams «Kop van Zuid», dort, wo internationale Stars wie Renzo Piano und Norman Foster ihre modernen Landmarken an der Maas hochzogen, den Wohnblock «De Landtong» und machte die zuvor verpönte Blockbebauung wieder populär. Auf die lange Rivalität zwischen Amsterdam und Rotterdam angesprochen, meint van Dongen: «In Amsterdam bewegt sich momentan ungeheuer viel, obwohl bis vor einigen Jahren Rotterdam die Speerspitze der modernen Architektur war. Lange Zeit hat man sich hier in Amsterdam von der Vorstellung leiten lassen, die Stadt so gut wie möglich zu konservieren, da Kohärenz, Schönheit und Gemütlichkeit über alles gestellt wurden.
Anders in Rotterdam, wo man nach dem Krieg bestrebt war, eine gänzlich neue Stadt aufzubauen. Man wollte eine Stadt, die sich von der traditionellen holländischen Bauästhetik unterscheidet und gegenüber Experimenten aufgeschlossen ist.» Frits van Dongen gibt aber zu bedenken, dass Rotterdam in den letzten Jahren mächtig aufgeholt hat. Immerhin gebe es hier Rem Koolhaas' Office for Metropolitan Architecture, die legendäre Talentschmiede für junge Architekten, aus der etliche internationale Stars hervorgegangen sind. Und man solle nicht vergessen, dass Koolhaas auf der Wilhelminapier, direkt hinter Ben van Berkels grandioser Erasmusbrükke, den spektakulären MAB-Tower, ein hybrides Gebilde aus geschichteten Volumina, bauen wird.
Aber van Dongen erinnert sogleich daran, dass Amsterdam mittlerweile ganz neue Massstäbe gesetzt hat: «Neben den neuen Zentren in der Hafengegend sind wir damit beschäftigt, auf dem künstlichen Archipel Ijburg eine neue Stadt entstehen zu lassen. Das Ijburg-Projekt ist typisch holländisch. Es wird 50 000 bis 60 000 Menschen neuen Wohnraum verschaffen.»
Rem Koolhaas und seine Talentschmiede
Vor allem Rem Koolhaas, der in London wohnt, in Rotterdam arbeitet und sich in den Flughäfen der Welt zu Hause fühlt, hat die städtebauliche Entwicklung in den Niederlanden massgeblich geprägt. Für den Utrechter Universitätscampus «de Uithof» entwickelte er Anfang der neunziger Jahre einen Masterplan, der einen avantgardistischen Gegenpol zur Altstadt mit ihrer Grachtenseligkeit markiert. Die Delfter Architektengruppe Mecanoo baute hier die «Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management», eine Hochschule als kleine in sich gekehrte Stadt mit drei künstlerisch gestalteten Patios. Und Koolhaas selbst errichtete die Pädagogik-Fakultät «Educatorium», deren ansteigender Hörsaal-Trakt wie eine Biskuitrolle über dem Mensabereich hinausragt.
Der Name Rem Koolhaas ist seit den letzten Jahren auch mit der holländischen Provinz verbunden. In den Poldern von Flevoland, 30 Kilometer von Amsterdam entfernt, modelt er das kleinstädtische Almere in ein Klein-Manhattan für 400 000 Menschen um. Internationale Architekten lud er ein, um dem Ort gemeinsam die kleinstädtische Gemütlichkeit auszutreiben. Das japanische Team Sanaa baut inmitten des Weerwater ein «Stadtheater», während das Amsterdamer Büro Claus en Kaan die neue Skyline von Almere durch einen skulpturalen Turmbau begrenzt. Neben dem Urban Entertainment Center, das William Alsop, der Popkünstler unter den Architekten, errichtet hat, lässt Koolhaas momentan sein Grosskino «Megabioscoop» aufrichten.
Almere als Wallfahrtsort
Schon jetzt ist absehbar, dass Almere in den nächsten Jahren zum Wallfahrtsort für Architekturfreaks wird. Floris Alkemade, Projektleiter beim Office for Metropolitan Architecture, spricht bereits von «Dutchtown», dem architektonischen Neuland in den Poldern: «Das Fehlen historischer Architektur bot uns die Chance, Almere neu zu erfinden. Wir wollen nicht, dass alles schön und gut sein muss. Lieber möchten wir dem Bestehenden eine neue Dynamik und einen neuen Massstab hinzufügen.» Mit diesem Grundsatz haben die holländischen Architekten in den letzten Jahren international Furore gemacht.
Neue Zürcher Zeitung, Mo., 2004.05.24
verknüpfte Beiträgeeuropa1 Niederlande