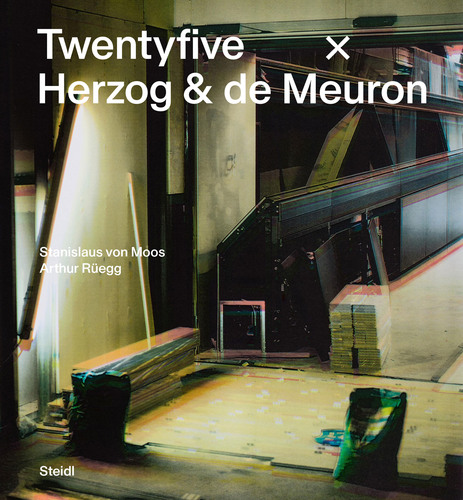Wir leben in einer Zeit überhandnehmender Ruinenbilder. In den Medien werden Städte und Bauten vor allem dann abgebildet, wenn es Schaden zu melden gibt: Explosionen, Feuersbrünste oder Überschwemmungen interessieren ebenso wie Zerstörungen durch Krieg und Terror. Es gibt aber auch die umgekehrte, ins Optimistische gewendete «Ruinenästhetik» der Rohbauten, die von Aufbau und wirtschaftlicher Dynamik künden.
Wir leben in einer Zeit überhandnehmender Ruinenbilder. In den Medien werden Städte und Bauten vor allem dann abgebildet, wenn es Schaden zu melden gibt: Explosionen, Feuersbrünste oder Überschwemmungen interessieren ebenso wie Zerstörungen durch Krieg und Terror. Es gibt aber auch die umgekehrte, ins Optimistische gewendete «Ruinenästhetik» der Rohbauten, die von Aufbau und wirtschaftlicher Dynamik künden.
Der alltäglichen Ästhetik des Katastrophalen, wie wir sie von Erdbeben, Flutkatastrophen oder Terroranschlägen her kennen, stehen Bilder von umgekehrten «Ruinen», von Rohbauten und Bauprovisorien entgegen, die von Zukunftsoptimismus zeugen. Die Stadt erscheint in solchen Bildern als gigantische Werkstatt. Architekten lieben solche Bilder. In Louis Kahns Büro in Philadelphia hing Piranesis berühmte Rekonstruktion des Campo Marzio. Rom ist auf diesem Blatt gleichzeitig als Zeugnis des eigenen Verfalls und als utopische Fiktion vergegenwärtigt. Für Kahn stand fest, dass sich Architektur irgendwo zwischen den beiden Polen der Ruine und der Utopie definiert, definieren muss. Während seines Aufenthalts an der American Academy in Rom, 1950/51, faszinierte ihn daher wenig so sehr wie die Ruinen von Rom und der Campagna.
Bilder Des Turmbaus zu Babel
Die Ambivalenz der Ruine als Bauplatz (und umgekehrt des Bauplatzes als Ruine) ist freilich keine Erfindung Kahns. Ihre Vorgeschichte reicht auch weit hinter Piranesi zurück – mindestens bis ins 16. Jahrhundert. Die Ikonografie des Turms zu Babel gibt nützliche Aufschlüsse. Allein im 16. und 17. Jahrhundert gehen die Abwandlungen dieses Themas in die Tausende: Zwei der berühmtesten davon hat Pieter Bruegel d. Ä. gemalt. Sie hängen im Kunsthistorischen Museum in Wien und im Museum Boymans van Beunigen in Rotterdam. Das eine Bild zeigt den babylonischen Stufenturm unvollendet, im Aufbau begriffen, von Gerüsten, Kranen, Baracken, Backsteinbrennereien umstellt, mit einer erst im Rohbau ausgeführten Turmspitze. Ein Menschenwerk von kolossalen Ausmassen – die Spitze des Baus, von einer vorbeiziehenden Wolkenbank teilweise verdeckt, liegt schon fast ausserhalb des Blickfeldes. So gross ist der Turm, dass sich die Arbeiter an diesem Bau wie ein Volk von Ameisen zu schaffen machen. Die Baumaschinen und die Segelschiffe im Hafen überleben in dieser Nachbarschaft nur gerade als Miniatur.
Auf dem anderen, kleineren Bild hingegen, das sich in Rotterdam befindet, ist der Turm bis auf die noch unvollendete Spitze fertig gestellt. Die Gerüste und Baracken sind abgeräumt, eine Baustellenbesichtigung wie auf dem Wiener Bild, wo ein Potentat mit grossem Gefolge zur Inspektion erscheint, findet keine mehr statt.
Bis heute gibt es keine wirkliche Klarheit darüber, was genau die eine oder andere Fassung bedeutet bzw. wie man den offensichtlichen Unterschied zwischen den beiden Fassungen zu verstehen hat. Weder im einen noch im anderen Fall liefert die Bibelstelle, in der vom babylonischen Turmbau und von der Verwirrung der Sprachen die Rede ist, die Gott als Strafe für das vermessene Projekt über die Erbauer verhängt hat, eine ausreichende Erklärung. Zwar scheint nichts näher zu liegen, als das «Non-Finito» des Turms «biblisch» zu deuten. Steven Mansbach versteht die Wiener Fassung, also jene, die den Turm als gigantische Baustelle gibt, noch 1982 als «Mahnbild». Er erkennt im Non-Finito das Indiz der gescheiterten Hybris. Ganz im Gegensatz zur Rotterdamer Fassung. In diesem Bild, so Mansbach, habe Bruegel nicht das Scheitern einer gesellschaftlichen Utopie dargestellt, sondern ihr Gelingen. Der Turm sei hier gewissermassen post-biblisch umgedeutet zum Symbol einer idealen Gemeinschaft. Und hier liegt genau der Punkt, wo neuere Deutungen von Bruegels Bild ihre Zweifel geltend machen.
Die Götterdämmerung des Plans
Die Zuordnung des Wiener «Prozessbildes» mit der Idee der Hybris und des «fertig gestellten» Turms mit der Idee der idealen Gemeinschaft erscheint ihnen fragwürdig. Sie schlagen gerade die umgekehrte Zuordnung vor: In der Vergegenwärtigung des Aufbauprozesses erkennen sie eine Metapher für die Vitalität und die Prosperität einer an der langen Leine geführten, im Grunde dörflich strukturierten Gesellschaft. Statt vom nahen Weltende kündet der ins Stocken geratene Aufbau des riesigen Turms, nach dieser Lesart, vom Triumph technischen Wissens und baukünstlerischer Fertigkeit über die leblose Natur: als eine vorweggenommene Apotheose der Polytechnik. Das Rotterdamer Bild sei demgegenüber gerade nicht als Inbegriff eines gesellschaftlichen Idealzustands anzusehen, sondern als finstere Metapher einer bürokratisch verwalteten Gesellschaft. Der Turm zu Babel als Metapher, letztlich, für den Prozess der Zivilisation? Für die Verwandlung von Natur in Kultur?
Die Vorstellungen davon, wie eine ideale Stadt und darüber hinaus eine ideale Gemeinschaft aussieht bzw. aussehen müsste, haben sich in den letzten Jahren rasant verändert. Speziell unter Architekten. Für eine Mehrheit von ihnen wäre heute die Idee, eine ideale Stadt bzw. eine ideale Gemeinschaft in eine kompakte architektonische Form zu pressen, in der Praxis undenkbar. Selbst die kunsthistorischen Deutungen des Babelbildes von Bruegel sind, wie soeben angedeutet, in den Sog dieses Bewusstseinswandels geraten. Wenn nicht alles täuscht, ist andererseits das Non-Finito, die permanente Metamorphose als ästhetische Kategorie im Städtebau, bzw. die Fähigkeit zum Non-Finito als Qualitätskriterium im Städtebau ein relatives Novum. 1931 war das real gebaute Algier des 19. Jahrhunderts für Le Corbusier ein heilloses Geschwür, dessen «désordre effrayant» in Anbetracht der «impossibilité de se développer entre la falaise et la mer» nur darauf wartete, mittels der Radikalkur des «Plan Obus» mit Stumpf und Stiel ausgerottet zu werden.
Knapp vierzig Jahre später haben dann die Architekten damit angefangen, die Klagebrille in Anbetracht der «real gebauten Stadt» abzulegen und die Lernbrille aufzusetzen. Kurz nach 1970, nachdem Venturi, Scott Brown und Izenour mit «Learning from Las Vegas» das Startsignal gegeben hatten, wurde immer entschiedener das Prozesshafte des Phänomens urbaner Besiedlung ins Blickfeld genommen. Man begann «städtebauliche Porträts» zu entwerfen. Am vorläufigen Ende dieser Entwicklung stehen die «Wetterkarten» zur «Siedlungsmeteorologie» des Landes in der Publikation des ETH-Studios Basel («Die Schweiz, ein städtebauliches Porträt», 2006). Hier haben Architekten ein Inventar energetischer Kraftlinien zur Besiedlungsdynamik des Landes erarbeitet und sozioökologische Lackmustests vorgenommen, die nicht festgelegte urbane Räume oder architektonische Konfigurationen dokumentieren, sondern etwas, was primär gar keine physische Qualitäten aufweist. Und was sich permanent im Fluss befindet.
Brasilia und Chandigarh
In letzter Zeit ist viel von der «Ikonizität» von Architektur die Rede: von der Art und Weise, wie Bilder von Architektur und Stadt entstehen und welche Rolle sie im Haushalt der visuellen Kommunikation spielen – auch davon, ob (und wenn ja, wie) diese Bilder wieder auf die Baukunst zurückwirken. Neue Städte – zumal Hauptstädte junger Nationen – waren immer Bauprojekte und Medienkampagnen in einem. Chandigarh und Brasilia, die zwei exponiertesten Beispiele von ab ovo geplanten Gründungsstädten des 20. Jahrhunderts, bieten besonders reichhaltiges Beweismaterial für diese These. Ist es ein Zufall, dass sich ein beträchtlicher Teil der Mediatisierung von Chandigarh und Brasilia darauf konzentriert hat, diese Orte als gigantische Baustellen zu dokumentieren; als Bühnen, auf denen sich in vielfältigster Form ein Drama spektakulär inszenierter Arbeitsleistung abspielte? Man denke an die Aufnahmen Marcel Gautherots. Die berühmtesten und auch am meisten reproduzierten unter ihnen zeigen nicht fertig gestellte Bauten, sondern zyklopische Baustellen, ätherisch verzaubert als Lichterscheinungen im Wüstensand.
War die Mediatisierung der Baustelle Brasilia Sache der Regierung, so liefen die Fäden der Mediatisierung von Chandigarh im Atelier Le Corbusiers zusammen – entsprechend der zweiten Natur des Büros als einer eigentlichen Bildagentur der architektonischen Modernität. Der vor wenigen Monaten verstorbene Lucien Hervé zum Beispiel steuerte Bilder bei, die Qualitäten der im Entstehen begriffenen Architektur in die Sprache einer konstruktiven (konstruktivistischen?) Fotografie übersetzen. Statt Baukunst lediglich zu illustrieren, paraphrasieren sie sie in einer autonom gewordenen Bildsprache aus kontrastierend interagierenden Fragmenten.
Gewisse Medialisierungsprojekte blieben mangels Interesse im Entwurf stecken. Das interessanteste unter ihnen stammt von Ernst Scheidegger. Er trat 1956 an Hans Girsberger heran mit dem Plan, eine Reihe von Fotobüchern zur Baugeschichte von Chandigarh herauszugeben. Ein erster Band liegt als fertig geklebtes Layout vor. Die darin zusammengestellten Bilddokumente zur Entstehung von Chandigarh sind nicht nur ethnografische Dokumente aus erster Hand, sie dokumentieren darüber hinaus eine Faszination des Provisoriums, des Fragments und – so paradox es klingen mag – der Ruine. Scheideggers Bild des Sekretariats mit dem Hohen Gericht im Hintergrund liesse sich im Blick auf Piranesi als eine «umgekehrte Ruine» beschreiben – analog zu den Industrielandschaften New Jerseys, die Robert Smithson um 1960 als «Ruins in reverse» beschrieben hatte.
Pieter Bruegel d. Ä. ist kein abwegiger Schlüssel zur modernen Rhetorik der Baustelle. Ein Haus, das um einen Felsen herum gebaut wird bzw. geradezu aus dem Felsen herauszuwachsen scheint, wobei aus dem Felsen gleich noch Wasser sprudelt, als hätte Moses mit seinem Stock darauf geschlagen: Wo, in der modernen Architektur, hat man schon so etwas gesehen? – Selbstverständlich bei Frank Lloyd Wright (Fallingwater, 1935). Der Unterschied besteht darin, dass der Felsen bei Bruegel im Prozess des Ausbaus abgetragen, gewissermassen verdaut, dem Stoffwechsel der Zivilisation unterworfen und in einen anderen Aggregatszustand – Haustein, Backstein und Mörtel – übergeführt wird, während er bei Wright so, wie er gewachsen ist, wie in einer kostbaren Fassung erhalten und gerahmt wird. Hier wird Natur nicht «neutralisiert», hier wird sie unbehauen, in ihrer ganzen Rohheit in den Bau integriert.
«Into the Nature of Materials» lautet Wrights Schlagwort, doch was versteckte sich dahinter? Ein biologischer Befund? Eine Sache der Materialkunde? Fraglos ist nur, dass das Phantom «Materialechtheit» einen der grossen Architektenmythen der Moderne verkörpert. Dies vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil Wright sie so eindrücklich beschworen hat. Etwa, als er die Felshöcker in der Nähe seines Wohnorts Spring Green, Wisconsin, beschrieb, Felshöcker, die ein Gletscher in der Vorzeit reingewaschen hat und in deren Umgebung sich heute (wie zufällig!) riesige Kiesgruben befinden. Wright schreibt weiter von Kieselhaufen, von Zementfabriken, die den Schotter zu jenem «magischen Staub» zermalmen, «der meiner Vision Form gibt». Dann wendet er sich dem Holz zu und sieht in den Schindeln und Brettern den Wald, gefällt und zerkleinert nach dem Architektenmass von Fuss und Inch . . . Ergo ist «The Nature of Materials» in allererster Linie die Eigenschaft der Materialien, dem Schöpfer-Architekten zu Diensten zu sein.
Fragment und «offene Form»
«Baustelle»? – In der Architektur hat die Ästhetik des Fragments, des Non-Finito, der «offenen Form», die das Stadium ihrer Vollendung entweder längst hinter sich gelassen oder noch gar nicht erreicht hat, eine lange Tradition (Dalibor Vesely, Neil Levine u. a. haben darüber geforscht). Joseph Gandys Darstellung von Sir John Soanes Projekt für die Bank of England in London (1830) ist nur ein besonders naheliegendes Beispiel unter vielen. Indem Soane (bzw. Gandy) das Projekt in einem möglichen künftigen Zustand des Verfalls zeigt, bettet er es in den grossen erdgeschichtlichen Zusammenhang von Aufstieg und Fall der Kulturen. Doch hat das Unterfangen auch eine pragmatische Komponente. Zwar evoziert der vorweggenommene Zerfall der Anlage die Hinfälligkeit von Menschenwerk überhaupt und ist insofern auch ein Stück Vanitas- und Melancholie-Metaphorik in der Tradition des 18. Jahrhunderts.
Gleichzeitig gibt es dem Betrachter aber auch Einblick in die konkrete Materialität und in die konstruktive und tektonische Faktur dieses Baus: Die fiktive Zerstörung wird so zu einem Modus der didaktischen Explikation der Art und Weise, wie das Gemäuer und wie die Gewölbe, aus denen sich der Komplex zusammensetzt, konkret gemacht sind. Die Ruine wird so zum didaktischen Präparat, zum Demonstrationsobjekt baukünstlerischer Tektonik. Vor dem Hintergrund von Soane liesse sich auch über den tieferen Sinn des «ruinösen» Charakters von Chandigarh spekulieren.
Dass Ruinen nicht nur Zerfall dokumentieren, sondern im Zerfall auch ihren Anfang offenbaren und insofern den Anfang von Architektur überhaupt, das ist beinah eine Generallinie der modernen Architektur – speziell natürlich dann, wenn man Louis Kahn dazurechnet. Um 1950, ausgerechnet zu einer Zeit, als Europa damit beschäftigt war, den Schutt der beschädigten oder zerstörten Städte aus dem Weg zu räumen, scheint Kahn die Ruine als Versprechen entdeckt zu haben. Fertig gestellte Bauten hätten es in sich, uns etwas über das Abenteuer ihrer Faktur erzählen zu wollen, schreibt er. Doch seien sie durch die Zeichen sich überlagernder Nutzungen daran gehindert, das auch wirklich zu tun. Erst wenn der Gebrauch erloschen sei, könne die Architektur wieder zu sich selbst kommen: «But when its use is spent and it becomes a ruin, the wonder of its beginnings appears again.» Das Ziel von Baukunst müsse es demzufolge sein, dieses Wunder des tektonischen Anfangs im konkreten Bauwerk so deutlich in Erscheinung treten zu lassen, dass die anderen Charakteristiken – die Wohnfunktion, die Lebensform, die Darstellung staatlicher oder anderer Autorität mit Hilfe stilistischer oder typologischer Anleihen – dagegen an Bildmacht gar nichts mehr aufzubieten haben.
Das Resultat sind, eben, die «orphischen Urworte» der Architektur des späten Louis Kahn (Adolf Max Vogt): die vermutlich präzisesten Aktualisierungen der Idee vom «Rohbau», die in der Architektur des 20. Jahrhunderts versucht worden sind. Das Parlament von Dacca, die Universität von Ahmedabad, die Bibliothek der Exeter Prep School im Norden von Massachusetts: In allen diesen Bauten ist der Gegensatz von Rohbau und Ausbau aufgehoben, fallen die beiden Zustände in exemplarischer Weise zusammen.
Neue Zürcher Zeitung, Sa., 2007.09.22
![]()