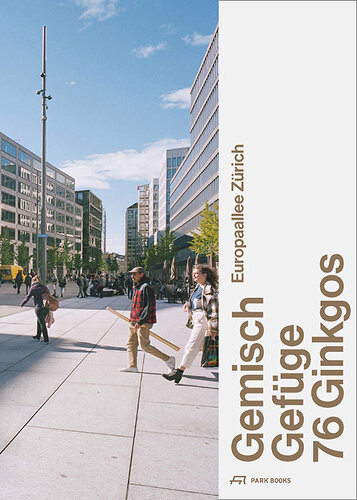Jedes Jahr findet der Eidgenössische Wettbewerb für Kunst, Architektur und deren Vermittlung statt. Stolze 720000 Franken vergab die Jury. Ihre Entscheide machen oft ratlos. Wie lauten die Kriterien und Ziele? Der Präsident, ein Mitglied und drei der Architektur-Experten geben Auskunft.
Jedes Jahr findet der Eidgenössische Wettbewerb für Kunst, Architektur und deren Vermittlung statt. Stolze 720000 Franken vergab die Jury. Ihre Entscheide machen oft ratlos. Wie lauten die Kriterien und Ziele? Der Präsident, ein Mitglied und drei der Architektur-Experten geben Auskunft.
Isa Stürm: Zuerst sichten wir die eingesandten Dossiers. Wir Experten lesen uns durch die Architektur-Dossiers – dieses Jahr etwa fünfzig völlig unterschiedliche Portfolios. Diese geben meist mehr zu lesen als jene der Künstler, weil die Architekten mehr zu erklären haben.
Schaut jede Expertin und jeder Experte alle Dossiers an?
Carlos Martinez: Ja, alle gehen einmal durch und machen sich ihre Gedanken. Nachher diskutieren wir in der Runde.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich für dieses Studium?
Andreas Reuter: Fast einen ganzen Tag. Zunächst arbeiten wir einen halben Tag, dann schlafen wir darüber. Nachher wird es spannend: Wir nehmen uns gemeinsam jedes Dossier vor und entscheiden aufgrund der Diskussion, ob es ausgeschlossen wird oder weiterkommt. Am Ende haben wir eine gewisse Anzahl, die wir der Kommission vorschlagen, damit diese zur zweiten Runde eingeladen werden.
Die Expertenrunde ist damit so etwas wie die Architekturjury des Eidgenössischen Wettbewerbs für Kunst. Schauen sich die Mitglieder der Kommission ebenfalls alle Dossiers an?
Hans Rudolf Reust: Nein, bei der ersten Auswahl nicht. Die vier Experten studieren die Dossiers genau und bringen die Vorschläge ein. Wichtig und interessant für beide Seiten ist aber die Begründung der Auswahl und die nachfolgende Diskussion. Bis jemand einen Preis erhält, müssen wir dies zweimal voreinander argumentieren.
Peter Hubacher: Die Kommission hat jederzeit Zugriff auf sämtliche Dossiers. Sie kann über Wiedererwägungen die Experten fragen, warum sie dieses Dossier ausgeschieden haben und ein anderes weiterempfehlen.
Wie muss man sich die Architekten-Dossiers vorstellen?
Isa Stürm: Wie gesagt, sie sind sehr unterschiedlich. Manche bringen schon im Portfolio einen Vorschlag, was sie später als Installation machen würden. Andere befassen sich mit einem Thema, bei dem man sieht, das könnte was werden. Wiederum andere haben einfach ein gutes Projekt, das es verdient hätte, in einer Ausstellung gezeigt zu werden.
Die einen geben ein Portfolio ein, beinahe wie bei einer Stellenbewerbung, andere zeigen schon Ansätze zu einer konkreten Arbeit. Sind solch verschiedene Eingaben überhaupt vergleichbar?
Peter Hubacher: Es geht weniger ums Vergleichen, sondern ums Ausloten eines Potenzials, das man einem Bewerber zutraut. Zum Beispiel interessiert uns die Auseinandersetzung mit einem architektonischen Gedanken, ohne dass schon festgelegt sein muss, wie dieser in der Ausstellung thematisiert und verarbeitet wird.
Andreas Reuter: Wir geben bewusst keine Empfehlung ab, in welcher Form die Eingaben zu erfolgen haben. Es ist jedem und jeder selbst überlassen, wie er oder sie sich und die Arbeit präsentieren möchte.
Hans Rudolf Reust: Man muss diese Offenheit als Wert betrachten. Wir suchen keine Tricks, sondern eine Art der Kommunikation, die dem Gegenstand oder einem Thema entspricht. Auf jeden Fall müssen wir herausfinden, was die Message ist. Und die kann man jurieren und auszeichnen.
Dieser Preis spricht also eine besondere ‹Gattung› von Architekten an – solche, die den künstlerischen Kontext suchen und sich darin bewegen?
Isa Stürm: Wir suchen die reflektierenden, forschenden, experimentierfreudigen Architektinnen und Architekten. Und sie müssen mutig an die Tat gehen.
Carlos Martinez: Es ist keine spezielle Art von Architekten gefragt, sondern eine spezielle Art der Arbeit und der Herangehensweisen. Wir wollen absichtlich nicht, dass die Architektinnen und Architekten einen Grundriss, einen Schnitt und drei Visualisierungen abgeben.
Diese Offenheit in Ehren, aber gehorchen Kunst und Architektur nicht unterschiedlichen Regeln?
Carlos Martinez: Mich würde interessieren, ob sich die Arbeitsweisen eines guten Architekten und eines guten Künstlers unterscheiden. Zu Beginn ihrer Arbeit haben doch beide einen Hintergrund, ein Konzept, oder sie kommen über ein Konzept zu einer Idee. Es sind verschiedene Disziplinen, aber ähnliche Arbeitsformen.
Warum werden die zwei Bereiche dann überhaupt aufgeteilt?
Hans Rudolf Reust: So wie ich es verstehe, stehen Felder der Architektur zur Diskussion. Diese Felder sind breit, und ein Teil dieser Aktivitäten überlagert sich mit künstlerischen Prozessen bis hin zu enger Zusammenarbeit. Eigentlich geht es um die Arbeitsweisen der Architektur, die hier möglichst breit dargestellt werden sollen.
Isa Stürm: Vielleicht sollte auch einmal die Professionalität der Architektur hinterfragt werden. Architekten neigen dazu, sich mit ihrem Professionalismus zu schützen. Ich finde es ganz gut, wenn sich Architekten wie Künstler fragen, was sie denn genau machen, und neben dem Dienstleistungsanspruch auch inhaltliche Fragen stellen.
Was ist am Schluss ausschlaggebend: allein die Ausstellung in Basel oder auch noch das eingereichte Dossier?
Peter Hubacher: Alles, was in Basel zu sehen ist, auch die Projekterläuterungen, werden juriert. Zu diesem Zeitpunkt kommen wir nicht mehr auf die Dossiers zurück; wir beurteilen also ausschliesslich die Arbeit der zweiten Runde.
Führt die Ausstellung auch zu Enttäuschungen?
Andreas Reuter: Es gibt Enttäuschungen und es gibt Überraschungen, gerade das finde ich spannend. Ich habe aber bemerkt, dass Architekten unglaublich Mühe haben, wenn sie sich im Raum frei entfalten können.
Sollte man dann nicht etwas ändern, zum Beispiel an der Ausgangslage, am System oder an den Kriterien?
Carlos Martinez: Wir wollen keine Richtlinien aufstellen. Es geht auch darum, den Architekten zu zeigen, dass es andere Medien gibt als nur gerade die ihnen vertrauten.
Hans Rudolf Reust: Wir leben in einer Zeit, in der es keine Unité de doctrine mehr gibt. Den Mangel an deutlichen Kriterien wirft man heute vielen Auswahlgremien vor. Man vermisst die ideologischen Entscheidungen. Es gibt so viele verschiedene Quellen, aus denen sich auch die Architektur nährt. Die wollen wir alle anzapfen. Darum ist unser Verfahren zeitgemäss. Der Preis ist ein Diskursfenster, in dem viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen werden.
Aber entscheidend ist offensichtlich die Ausstellung. Und offenbar kämpfen damit ausgerechnet die Architekten?
Isa Stürm: Längst nicht alle. In den letzten Jahren haben sich die Beiträge der Architekten sichtlich verbessert. Die jüngeren Architekten haben Fertigkeiten entwickelt, wie sie ihre Arbeiten in einer Schau darstellen können. Die Installation ist zu einem selbstverständlichen Medium für architektonische Ideen geworden.
Dennoch: Das Risiko bleibt, jemanden aufgrund eines Dossiers zur Ausstellung einzuladen, der dort dann scheitert. Ist das überhaupt vertretbar angesichts der hohen Preissumme?
Hans Rudolf Reust: Wenn man kein Risiko eingeht, wird es öde. Wir müssen uns dieser Auseinandersetzung stellen.
Carlos Martinez: Der Kritikpunkt – dass keine klar fassbaren Kriterien da sind – ist genau unser Potenzial. Das Risiko, das wir eingehen, diese Offenheit, ist etwas Einzigartiges.
Führen Sie über die Beurteilung ein schriftliches Protokoll?
Peter Hubacher: Aufgrund der Fülle von Dossiers ist es schlichtweg unmöglich, über sämtliche Entscheide Protokoll zu führen. Wir halten aber die mehrstufigen Abstimmungsresultate in einem internen Protokoll fest.
Sie publizieren keinen Jurybericht. Würde dies nicht der Glaubwürdigkeit und der Transparenz dienen?
Andreas Reuter: Man kann diesen Preis nicht mit einem klassischen Architekturwettbewerb vergleichen. Beim Architekturwettbewerb gehen alle vom Gleichen aus: Raumprogramm und Aufgabe. Und alle liefern eine Lösung für diese Aufgabe ab. Hier ist es breit gestreut, die Teilnehmer können bringen, was sie wollen.
Peter Hubacher: Es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht kommunizieren. Einen Jurybericht gibt es zwar nicht, aber wir suchen das persönliche Gespräch mit den Teilnehmern, falls nötig auch im Vorfeld bei Fragen zur Eingabe und zum Dossier. Ausserdem sind wir bei der Vernissage anwesend, damit alle bei Bedarf mit uns über die ausgestellten Projekte sprechen können. Doch diese Gelegenheit nutzen die Künstler und Architekten leider wenig.
Der Wettbewerb
Den Eidgenössischen Wettbewerb für Kunst gibt es seit 1899 – er ist damit der älteste Kunstwettbewerb der Schweiz. Das Verfahren hat zwei Runden. Zuerst senden die Bewerber aus den Sparten Kunst, Architektur sowie Kunst- und Architekturvermittlung Dossiers ein, dieses Jahr gegen 600 Stück. Daraus wählt die Jury, die Eidgenössische Kunstkommission, rund 130 Bewerberinnen und Bewerber, die jeweils im Juni in Basel gleich neben der Kunst-messe ‹Art› eine Arbeit ausstellen dürfen. In dieser Ausstellung entscheidet die Kommission, welche Arbeiten sie auszeichnet. Pro Jahr vergibt sie 20 bis 30 Preise zwischen 18000 und 25000 Franken. Bewerben kann man sich bis zum 40. Altersjahr, höchstens aber siebenmal. Höchstens dreimal erhält man einen Preis. www.bak.admin.ch
Kommentar
Die Juryentscheide des Eidgenössischen Kunstpreises lassen die Teilnehmerinnen wie auch Beobachter ratlos. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Jury vorgeht, warum sie sich für die eine oder gegen die andere Arbeit entscheidet. Diese Kritik entschärfen die Juroren und Experten im Interview nicht. Offen bleiben drei Punkte.
Erstens: Das Programm. Die Kommissäre und Expertinnen erklären im Interview, sie wünschten sich als Teilnehmer Architekten, die jenseits der Alltagsarbeiten forschen. Im Programm steht das nicht. Kann man überhaupt von Programm sprechen? Es nennt formale Teilnahmebedingungen, aber weder inhaltliche Leitlinien noch Hinweise zu den Erwartungen in den einzelnen Sparten. Freie Auseinandersetzung ist gut, auch in der Architektur. Die Trennung von Kunst und Architektur macht durchaus Sinn. Doch selbst ein kurzes Bekenntnis der Kommission zu den Erwartungen in diesen beiden Sparten fehlt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleibt nur, auf die Erfahrung der Kommission zu vertrauen. Und der Kommission bleibt nur, immer wieder auf einen ‹guten Jahrgang› zu hoffen. Nötig aber ist eine präzise programmatische Arbeit der Kommission und vor allem des Bundesamts für Kultur: Was soll dieser Wettbewerb leisten?
Zweitens: Das Dossier und die Ausstellung. Die Kommission ist gegen verbindliche Kriterien und beharrt auf der Offenheit der Eingaben zuerst im Dossier, dann in der Ausstellung. Al-le sollen mitmachen können und alle auf ihre Weise. Die Kommission schreibt sich die Fähigkeit zu, mit dieser Offenheit umgehen zu können. Sie bürdet sich damit schwierige Arbeit auf. Und hohe Erwartungen. Die Zweiteilung Dossier und Ausstellung ist heikel. Denn ein Dossier ist ein anderes Medium als eine Ausstellung. Auch die Offenheit bei der Bewerbung – ob Werkschau oder bereits Projektskizze – ist fraglich. Lädt die Jury aufgrund einer Werkschau jemanden zur zweiten Runde ein und stellt dieser Teilnehmer dann Enttäuschendes aus, ist das bitter für all jene, die in der ersten Runde abgelehnt wurden. Erst recht dann, wenn dieselben Bewerber mehrmals zur zweiten Runde eingeladen werden und dann mehrmals leer ausgehen. Kurz: Es ist nötig, die Art der Bewerbung kritisch zu prüfen.
Drittens: Die Rechenschaft. Die Eidgenössische Kunstkommission hat viel Macht. Sie verteilt Geld, beeinflusst Karrieren und setzt Themen in der Debatte um Kunst und Architektur. Während acht Jahren kann ein Mitglied oder eine Expertin den Wettbewerb mitbestimmen – subjektiv und unabhängig. Das ist gut und richtig. Unhaltbar aber ist, dass die Kommission keinen Beurteilungsbericht abgibt. Wer 720000 Franken öffentliche Gelder verteilt, ist sowohl den Teilnehmern als auch der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig. Viele Teilnehmer sind von den Resultaten enttäuscht und ratlos. Dass sie eingeladen sind, Jurymitglieder an der Vernissage zu befragen, genügt nicht. Es ist wichtig und nötig, dass die Kommission ihre Entscheide beschreibt, die Preis-träger würdigt und über den Stand der Dinge berichtet. Und sich so selbst der Kritik stellt. Ohne Jurybericht, ohne Transparenz der Entscheide sind wir zu Spekulationen gezwungen. Diese enden in Vorwürfen der Mauschelei, der Seilschaft und gar der Lotterie. Rahel Marti
Die Eidgenössische Kunstkommission
Die neun Mitglieder der Kunstkommission wählt der Bundesrat für eine Amtsdauer von acht Jahren. Kandidatinnen und Kandidaten schlagen das Bundesamt für Kultur und die Kommission selbst vor. Diese wiederum ernennt die zurzeit vier Architekturexpertinnen und -experten, ebenfalls für acht Jahre. Da die Amtszeiten nicht synchron verlaufen, ändert die Zusammensetzung der Kommission Jahr für Jahr.
--› Der Präsident: Hans Rudolf Reust, Kunstkritiker und Dozent, Bern
--› Die Mitglieder: Stefan Banz, Künstler, Cully VD; Mariapia Borgnini, Künstlerin, Lugano; Peter Hubacher,
Architekt, Herisau; Simon Lamunière, Künstler, Genf; Jean-Luc Manz, Künstler, Lausanne; Hinrich Sachs, Künstler, Basel; Nadia Schneider, Direktorin Kunsthaus Glarus; Sarah Zürcher, Direktorin Centre Fri-Art, Fribourg
--› Die Experten: Geneviève Bonnard, Architektin, Monthey VS; Carlos Martinez, Architekt, Berneck; Andreas Reuter, Architekt, Basel; Isa Stürm, Architektin, Zürich.
hochparterre, Mi., 2007.08.15
verknüpfte Zeitschriftenhochparterre 2007-08
![]()