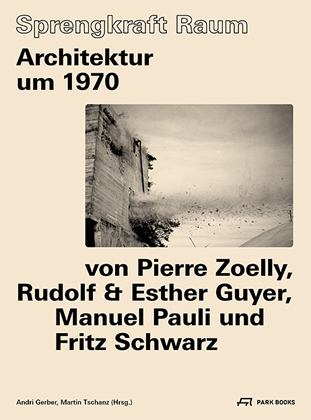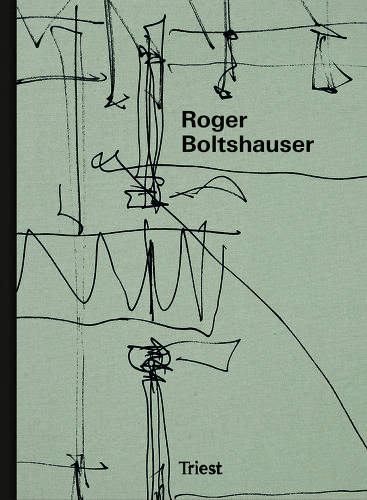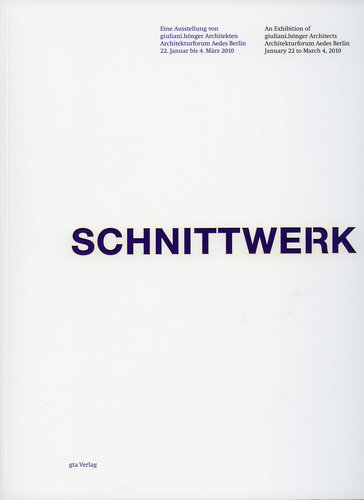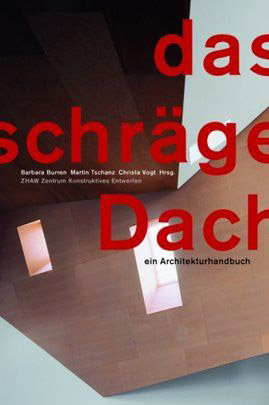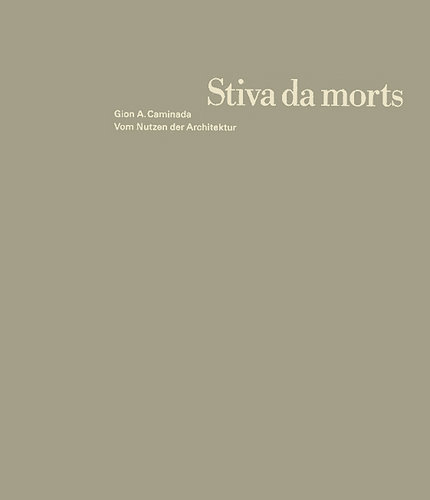Der Minimalismus der Nullerjahre steckt in einer Sackgasse. Auf ihn folgt eine Architektur mit Variationen zu Tradition und Tektonik. Was in den 1980er-Jahren als aufmüpfiges Postulat der Analogen Architektur begann, hat mittlerweile Boomtown Zürich erreicht. Eine Spurensuche.
Der Minimalismus der Nullerjahre steckt in einer Sackgasse. Auf ihn folgt eine Architektur mit Variationen zu Tradition und Tektonik. Was in den 1980er-Jahren als aufmüpfiges Postulat der Analogen Architektur begann, hat mittlerweile Boomtown Zürich erreicht. Eine Spurensuche.
Walmdächer auf Hochhäusern! Und das heute, mitten in Zürich! Ist die Analoge Architektur, die einst als subversive, um nicht zu sagen sektiererische Bewegung in den 1980er-Jahren an der ETH ihren Anfang genommen hatte[1], salonfähig geworden? Die Europaallee kann als die Bahnhofstrasse unserer Zeit gelten. Hier treibt der gegenwärtige Immobilienboom die wildesten Blüten (vgl. TEC21 41 und 42/2014). Die Erwartung an die Rendite ist enorm, und deshalb würde hier niemand in etwas investieren, das nicht mainstreamtauglich ist. Und nun also gewalmte Dächer auf den hochschiessenden Türmen!
Tatsächlich fallen die Grossbauten im Zentrum Zürichs nicht aus dem Rahmen der gegenwärtigen Architekturströmungen, im Gegenteil. In den Wettbewerben der jüngeren Zeit verdrängt zunehmend und auf breiter Linie eine komplexere, differenziertere und bisweilen auch traditioneller anmutende Architektur die «Minimal Tradition» und die «Swiss Shapes»[2], die noch vor zehn Jahren die hiesige Architektur geprägt haben. Die Fassaden sind plastisch durchgearbeitet, oft gibt es eine tektonische Gliederung; die Gebäude haben ein klar ersichtliches Unten und einen Abschluss nach oben, sind also Häuser mit Sockel und Dach; die Fenster haben artikulierte Gewände und Flügel, die zeigen, dass sie von Menschen bedient werden können – wie überhaupt konstruktive und technische Gefüge nicht mehr unterdrückt, sondern für den Ausdruck der Bauten genutzt werden.
Das alles klingt banal und selbstverständlich, markiert aber doch einen Richtungswechsel der gegenwärtigen Tendenzen. Die Architektur entlang des Zürcher Gleisfelds ist dafür ein getreuer Spiegel. Das Wohnhaus von EM2N an der Langstrasse/Neufrankengasse zum Beispiel scheint aufgrund seiner Radikalität einen Endpunkt zu markieren. Was sollte in dieser Richtung noch kommen nach solch einem Bau? Abstrakter kann eine Fassade kaum noch gedacht werden, härter an die Grenze zwischen Raffinement und Banalität geschoben, grösser das grosse Fenster. Die Reduktion, die vor 20 Jahren am Basler Barfüsserplatz mit dem Bürogebäude von Diener & Diener einen ersten Höhepunkt erreicht hatte, scheint hier zu einem Ende gekommen zu sein.
Ebenfalls einen Endpunkt, wenn auch einen anderen, markiert die Gebäudehülle von Gigon/Guyer im Baufeld C an der Europaallee. Abgesehen von einer verwischten Andeutung von Geschossen verschwindet hier alles, was gesagt werden könnte, hinter einer aufwendig gestalteten Oberfläche. Was bleibt, ist der stumme, hermetische Baukörper.
Für die Stadt sind aber weder die harte Abstraktheit der grossen Fenster noch die schillernde Sprachlosigkeit einer Hülle genug. Wenn die ersten beiden Etappen der Europaallee, die Baufelder A und C, so problematisch erscheinen, liegt das nicht nur am Städtebau mit seinen falschen Hierarchien zwischen öffentlich und privat, dem Vorspiegeln einer offensichtlich nicht existierenden Parzellierung und der möglicherweise doch etwas zu hohen Dichte. Es liegt auch an der Architektur. Selbst wenn der abstrakte Rationalismus von Max Dudler und die tiefe Glasfassade von David Chipperfield etwas stärker ausdifferenziert sind als die Hülle von Gigon/Guyer, leiden doch alle diese Bauten an einer mangelhaften Verknüpfung mit der Stadt. Dies zeigt sich in dieser dichten innerstädtischen Umgebung besonders deutlich, vor allem aber auch in Nachbarschaft zu der anders gearteten Architektur der folgenden Europaallee-Etappen am Gustav-Gull-Platz.
Man mag die Fassaden des Baufelds E von Caruso St John und Bosshard Vaquer für etwas übertrieben inszeniert halten, diejenigen des Baufelds G von Graber Pulver und Masswerk für etwas allzu kühl und reduziert (vgl. Bild links). Offensichtlich nutzen aber beide die jeweils eingesetzten Elemente, um mit der Stadt zu kommunizieren, indem sie den architektonischen Aufbau der Häuser und deren Beziehung zur Umgebung zum Ausdruck zu bringen. Oben und Unten sind hier ebenfalls artikuliert, das öffentliche Erdgeschoss ist in den Büro- und Wohnungsetagen differenziert und reagiert mit unterschiedlichen Vor- und Zwischenbereichen auf die anschliessenden Stadträume. Es gibt eine Hierarchie der Eingänge. Das Öffnen und Schliessen der Fenster ist gestaltet, die Fassaden suchen mit der Tiefe ihres Reliefs eine Verknüpfung von Innen und Aussen und so weiter und so fort. Ob nun die umhüllte Tektonik oder die tektonisch gestaltete Hülle angemessener sei, die Annäherung des Wohnens an die Büros oder die stärkere Ausdifferenzierung, Aluminium oder Kunststein: Man soll und kann es an diesen Beispielen diskutieren und wird es noch besser können, wenn demnächst die Bauten des Baufelds F von Roger Boltshauser mit ihren Stahl-Naturstein-Fassaden das Ensemble um einen weiteren, möglicherweise «mittleren» und zweifellos nicht weniger virtuosen Beitrag zu den gleichen Themen ergänzen werden.
Architektur der Architekturen
Die Bauten am Gustav-Gull-Platz greifen die traditionellen, seit jeher immer wieder und in unzähligen Varianten durchgespielten Themen der Architektur auf. Es ist selbstverständlich, ja unvermeidlich, dass dies in Bezug zu anderen Epochen geschieht. Ohne die Referenz auf Marc Saugey und andere Architekturen um 1960 wäre der Baublock von Graber Pulver und Masswerk nicht so, wie er ist, genauso wenig wie derjenige von Caruso St John und Bosshard Vaquer ohne das Wissen um die Stadtarchitektur des frühen 20. Jahrhunderts, zum Beispiel in Mailand. In beiden Fällen ist die Architektur in Analogie zu anderen Architekturen entstanden und zu verstehen.
Eine solche Architektur der Architekturen ist nun aber nicht eine Erfindung von Aldo Rossi oder gar der «Analogen Architektur»[3], sie ist vielmehr charakteristisch für die gesamte traditionelle Architektur und insbesondere für die klassische Tradition von Marcus Vitruvius Pollio bis Gottfried Semper. Ein Streben nach Verständlichkeit oder gar Verbindlichkeit der Architektur ist ohne Referenz auf ein konventionelles System schlechterdings undenkbar. Ein solches Streben ist nun aber heute an vielen Orten und in unterschiedlichen Strömungen zu erkennen. Es ist das Bemühen, die Architektur von den Spielwiesen der Meta-Architektur, der Iconic Architecture und des Starsystems wieder zu den «Essentials» zurückzuführen und sie auf einen «Common Ground» zu stellen – so kann sie wieder in das Zentrum der Stadt zurückkehren, statt bloss als Exotin an der Peripherie ihr Dasein zu fristen.
Was nun beinahe wie eine weitere Architekturmode erscheinen mag[4], kennzeichnet selbstredend auch das Architekturverständnis, das basierend auf den Erfahrungen der Analogen Architektur von Miroslav Šik seit Jahrzehnten in der Praxis erprobt und an der ETH gelehrt wird. Aber selbst in dessen näherem Umfeld gibt es unterschiedliche Entwicklungslinien, die in eine ähnliche Richtung weisen und hier nur grob und unvollständig angedeutet werden können. Peter Märklis Untersuchung der Prinzipien der tradierten Architektur zum Beispiel, um bei den Zürcher Generationsgenossen zu beginnen, hat längst über das Persönliche hinaus seine Relevanz erwiesen. Seine Recherche zur archetypischen Sprachlichkeit und zur unmittelbaren Wirkungsweise von Architektur scheint eine Art Mittelstellung einzunehmen zwischen Peter Zumthors Essenzialismus und Hans Kollhoffs erneuerter Befragung der Klassik. Vittorio Magnago Lampugnanis wertkonservative Haltung wiederum lehrte und lehrt Skepsis gegenüber allen Arten von Moden. Von der gleichen Basis ausgehend wie Šik[5] untersuchen Marcel Meili und Markus Peter in ihren Projekten nicht zuletzt das Ausdrucks- und Organisationspotenzial von Baustruktur und Konstruktion, während Knapkiewicz & Fickert über Umwege eine opulente und bildlastige Architektur entwickelt haben, die sich heute gut in den «Midcomfort» von Lukas Imhof und Miroslav Šik integrieren lässt.[6]
Alternativen zur Konzeptarchitektur
Zu nennen sind aber auch internationale Positionen, etwa der Neobrutalismus von Lacaton & Vassal, oder, damit verwandt, die «arme» Architektur der jüngeren Belgier. Und selbstverständlich, um zu Caruso St John zurückzukommen, jene Engländer, die an die feinfühligeren Spielarten der britischen Nachkriegsarchitektur anschlossen und so zu ihrem sensiblen Realismus fanden.
Sie alle können schwerlich als Kinder der Analogen Architektur bezeichnet werden, auch wenn niemand im luftleeren Raum arbeitet und es ganz offensichtlich parallele Interessen und Kreuzbestäubungen gibt. So ist es fraglos kein Zufall, dass eines der besten Werke über die jüngere Schweizer Architektur in London entstanden ist und von Irina Davidovici stammt, der Lebenspartnerin von Jonathan Sergison vom Architekturbüro Sergison Bates.[7]
All die erwähnten Positionen und Strömungen verbindet, dass sie Alternativen zu jener Konzeptarchitektur darstellen, die zur Schärfung eines Themas, sei dies ein formales oder ein theoretisches, eine Reduktion der Komplexität in Kauf nehmen oder sogar anstreben. An der ETH führten Aldo Rossi und seine Assistenten in den frühen 1970er-Jahren eine Entwurfsmethode ein, die auf dem Dreischritt Stadtanalyse – Entwurfsidee – Entwurf basierte. Die Entwurfsidee bestand bei Rossi in der Festlegung auf einen architektonischen Typus, in der Praxis der Lehre auch in der Wahl einer Referenz unter den Projekten des Meisters.[8] In abgewandelter Form prägte dieser dreiteilige Entwurfsprozess aber bis weit in die 1990er-Jahre hinein den Architekturunterricht an der ETH, sein Einfluss reicht sogar bis in die Gegenwart.
Die Entwurfsidee oder, wie man auch sagte, das Konzept konnte später je nachdem auch in einem Bild, einer Atmosphäre, einem funktionellen Szenario oder einer abstrakten Idee gefunden werden. Wichtig blieb, dass ein solches Konzept geschärft und die Architektur gleichsam auf den Punkt gebracht wurde.[9] Das förderte einerseits eine «Einfachheit», die gern in die Nähe der Minimal Art gerückt wurde, andererseits Entwürfe von Gebäuden, die «wie etwas» waren: wie ein Vogelnest, wie eine Höhle oder ein Monolith, wie ein Tango tanzendes Paar und so weiter. Dass dabei vieles unterdrückt werden musste, was üblicherweise die Komplexität von Architektur ausmacht, versteht sich von selbst. Oft war es die Realität des Bauens, die aus der Vorstellung der Gebäude ausgeblendet wurde, sodass grösste Virtuosität aufgeboten wurde, um die Konstruktion unsichtbar oder zumindest «einfach» werden zu lassen. Fugenlos! hiess das Postulat der Stunde.
Kult der Mitte
Die Analoge Architektur, wie sie sich 1987 in der gleichnamigen Ausstellung und der diese begleitenden «schwarzen Kassette» präsentiert hatte, war von solcher Konzeptarchitektur weniger weit entfernt, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Die Entwurfsidee fand sich hier allerdings nicht in einem Typus, einer metaphorischen Idee oder einem abstrakten Prinzip, sondern in einem Bild, das in Analogie zu einem Vorbild entwickelt wurde. Dass dieses mit Vorliebe eine Reformarchitektur paraphrasierte, die in ihrer Zeit unter Rückgriff auf das Handwerk die Entfremdung zwischen Fertigung und Erscheinung überwinden wollte, hätte bei oberflächlicher Betrachtung darüber hinwegtäuschen können, dass genau diese Entfremdung die Entwürfe mitprägte. Oft waren es konstruktiv «umgesetzte», nicht aus einer zeitgemässen Konstruktion heraus entwickelte Bilder, die damals präsentiert wurden. In ihnen erfüllte sich nur ungenügend jenes alte, von Gottfried Semper auf den Punkt gebrachte Postulat einer inneren Kohärenz, wonach jede Änderung der technischen oder kulturellen Faktoren, die einem Werk zugrunde lägen, auch zu einer Änderung seiner Gestalt führen müsste. Hier lag der wahre Grund für die Melancholie dieser Bilder, die in den braunstichigen Tönen der Kreidezeichnungen eine adäquate Form fand.
Die «altneue» Baukunst von Miroslav Šik und seine heutige Lehre an der ETH haben diese Nostalgie weitgehend abgelegt. Sie sind von den Bildern der «Seelenmaler»[10] fast ebenso weit entfernt wie die Architektur der anderen Protagonisten der oben skizzierten Tendenz. Was bei ihnen aber bleibt, sind ein gewisser antimoderner Reflex und ein ausgeprägter Kult der Mitte, der die Sehnsucht des entfremdeten Künstlers nach Normalität widerspiegelt. Solche Abgrenzungsmechanismen spielen bei der jüngeren Architektengeneration kaum noch eine Rolle. Den Protagonisten von Baumberger Stegmeier, bernath widmer, Buol & Zünd, EMI, Esch.Sintzel, GFA, Guignard Saner, huggenbergerfries, KilgaPopp, um nur einige wenige weitere Büros der mittleren Generation zu nennen, dürften diese Reste einer kämpferischen Avantgarde im Gewand einer Anti-Avantgarde weitgehend fremd sein.
Dasselbe gilt auch für die damaligen Studierenden der Analogen Architektur. Allerdings war deren Werdegang so unterschiedlich, dass über sie keine verallgemeinernden Aussagen gemacht werden können. Viele grenzten sich zunächst stark von ihren Arbeiten der Studienzeit ab, doch heute lassen sich manche gut in die skizzierte Tendenz einordnen – auch dies ein Hinweis darauf, wie wenig sinnvoll es wäre, diese linear und einseitig auf die Analoge Architektur zurückführen zu wollen (vgl. Interview S. 28).
Konstruktion als Ausdrucksmittel
Bereits Ende der 1990er-Jahre wandten sich viele der jüngeren Architekten gegen die Konzept- oder Bildlastigkeit der Architektur. Was damals bisweilen trotzig als Pragmatismus kultiviert wurde, bedeutete vor allem, deren Bedingtheiten nicht als Hemmnis zu verstehen, das der Annäherung an ein Ideal entgegensteht, sondern als wertvolles Material, das sich zu Baukunst gestalten lässt.[11] Weil sich Architektur aber nie einfach aus den Bedingtheiten heraus «ergibt», bestand parallel dazu ein starkes Interesse an den Urthemen der Architektur. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel die lockere Reihe von Heften mit Titeln wie «Dächer», «Fassaden», «Fenster» und so weiter zu sehen, mit denen die Redaktion von «werk, bauen wohnen» unter der Leitung von Nott Caviezel den grundlegenden Elementen der Architektur und deren Aufgaben nachspürte.
Gegen die Vorstellung, Konstruktion als «Umsetzung» eines Bilds oder eines Konzepts zu verstehen, richteten sich Ausstellung und Publikation «Dialog der Konstrukteure»[12], deren ausserordentlicher Erfolg das entsprechende Interesse beweist. In dieselbe Richtung zielt in besonders offensichtlicher Weise das Konzept des «synchronen Entwerfens», das am Institut für Konstruktives Entwerfen IKE der ZHAW Winterthur unter der Federführung von Astrid Staufer und Beat Waeber vor über zehn Jahren eingeführt und weiterentwickelt wurde.[13] Die materielle Realität des Bauens wird hier radikal und von Anfang an im Entwurfsprozess mitgedacht, mit dem Ziel, das Ausdruckspotenzial der Konstruktion möglichst gut zu nutzen und so eine verständliche, ausdrucksstarke und gleichzeitig effiziente und zeitgemässe Baukunst zu erreichen.
Bauweise und Ausdruck eng verknüpft
Das Thema der Tektonik, das dabei in vielfältiger Weise aufgegriffen wird, ist freilich ebenfalls ein Urthema der Architektur. Deshalb versteht es sich fast von selbst, dass es sinnvollerweise in Kenntnis der Geschichte, um nicht zu sagen in Analogie zu historischen Beispielen weiterentwickelt wird. Was diese Haltung bedeutet, mag ein weiterer Komplex am Zürcher Gleisfeld illustrieren, die Siedlung Letzibach C von Adrian Streich und Loeliger Strub.[14] Die tektonisch gegliederten Fassaden verleihen mit ihrem Betonraster und den Backsteinfüllungen der Skelettstruktur der Bauten Ausdruck und zeigen so eine starke, strenge Gliederung. Diese ermöglicht es, in den Varianten der Öffnungen die Vielfalt der Grundrisse und die Unterschiedlichkeit der Nutzungen anzudeuten. In den ausformulierten Details, in der Fugenteilung und besonders deutlich in der Durchbildung der Ecken wird zugleich die Konstruktionsweise der Fassade sichtbar – als Elementbau, der die Gebäude umgibt und in dem die Backsteine nicht aufgemauert, sondern zu Wandstücken vergossen sind. Das Resultat mag an Beispiele aus der Zeit um 1960 erinnern – weniger, weil entsprechende Vorbilder nachgebaut worden wären, sondern vielmehr, weil Konstruktionselemente in ähnlicher Weise genutzt werden: um Teile und Ganzes, Kleines und Grosses, Oben und Unten, Innen und Aussen und so weiter in einer sprechenden architektonischen Gestaltung miteinander in Beziehung zu setzen. Sogar die gesteigerte Komplexität, die heute aufgrund der Dämmung unvermeidlich ist, wird zumindest angedeutet. Niemand würde hier behaupten, die Form habe sich aus der Konstruktion ergeben, aber Bauweise und Ausdruck sind eng miteinander verknüpft.
Anlässlich der Ausstellung «Switzerland builds» schrieb Hans Hofmann 1946 von einer Entwicklung «vom Neuen Bauen zur Neuen Baukunst»[15], die weggeführt habe vom einseitigen Funktionalismus und Rationalismus der Vorkriegszeit. Heute könnte man in Analogie dazu von einer Entwicklung vom Kunst-Bauen zur Baukunst sprechen, mit der die Konzept- und Bilderarchitektur des jüngsten Fin-de-siècle überwunden wurde. Das «neu» kann man sich in unseren postmodernen Zeiten getrost sparen.[16] Wie Hofmann könnte man aber auch heute vom Ziel einer geschichts- und ortsbezogenen, sachlichen und gleichzeitig kunstvollen Architektur sprechen, von einem vielfältigen Sowohl-als-auch und einem komplexen, schwierigen Ganzen als Ziel. Die Wortwahl ist hier mit Bedacht dem «behutsamen Manifest» aus «Komplexität und Widerspruch» von Robert Venturi entlehnt – damit soll angedeutet werden: Eine solche Haltung gegen die Schärfungen der Extreme und die sie begleitenden Vereinfachungen ist nicht neu, sondern taucht immer wieder auf. Bisweilen setzt sie sich sogar durch – zumindest so lang, bis wieder neue Stimmen mit neuen Glaubenssätzen Klarheit und Einfachheit versprechen und damit zu verführen vermögen.
Anmerkungen:
[01] Die Begriffe Analogie und analog werden hier bewusst und (wie mir scheint) wesensgemäss unscharf verwendet (zum Begriff und seiner Verwendung im Umfeld von Aldo Rossi vgl. Werner Oechslin: Die Reise zum «Mont Analogue» – Erinnerungen an eine Architekturdiskussion, die nicht wirklich stattfand, in: L’opera sovrana – Studien über die Architektur des 20. Jh. für Bruno Reichlin, Mendrisio 2014, S. 18–49, bes. S. 33–39). Wenn die Architekturlehre an der ETH 1983–1991 von Fabio Reinhart und seinen Assistenten Miroslav Šik und Luca Ortelli gemeint ist, die 1987 und 1991 in Ausstellungen und Katalogen präsentiert wurde, ist von «Analoger Architektur» die Rede.
[02] Minimal tradition – Max Bill und die «einfache» Architektur 1942–1996, Baden 1996; Swiss shapes – Junge Schweizer Architekten, Berlin 2006.
[03] Miroslav Šik (Hrsg.): Analoge Architektur, Zürich 1987; Miroslav Šik (Hrsg.): Analoge Architektur – Analogická architektura – Analogous Architecture, Prag 1991. Vgl. auch Anm. 1.
[04] Vgl. Tibor Joanelly: Play it right, in: werk, bauen wohnen 6-2015, S. 66–75.
[05] Vgl. Peter Disch (Hrsg.): Architektur in der deutschen Schweiz 1980–1990, Lugano 1991 (bes. die Beiträge von Martin Steinmann und Marcel Meili).
[06] Lukas Imhof, Professur Miroslav Šik: Midcomfort – Wohnkomfort und die Architektur der Mitte, Wien 2013; Lukas Imhof (Hrsg.): Midcomfort, 6 Hefte, Zürich 2006–2010.
[07] Irina Davidovici: Forms of practice – German-Swiss architecture 1980–2000, Zürich 2012.
[08] Vgl. Aldo Rossi: Vorlesungen – Aufsätze – Entwürfe, Zürich 1974; Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner (Hrsg.): Aldo Rossi und die Schweiz – Architektonische Wechselwirkungen, Zürich 2011.
[09] Bereits Rossi hatte formuliert: «Ich denke, dass der erste und wichtigste Grundsatz im Beharren auf einigen wenigen Themen besteht: Der Künstler (und der Architekt im Besonderen) muss ein zu entwickelndes Thema auf einen Schwerpunkt hin bearbeiten …»; in: Aldo Rossi: Architektur für die Museen, in: ders.: Vorlesungen – Aufsätze – Entwürfe, Zürich 1974, S. 28–35, hier S. 28.
[10] Miroslav Šik: An die Seelenmaler, in: Analoge Architektur, 1987 (vgl. Anm. 3).
[11] Vgl. archithese 2/97: Stand der Dinge – Junge Schweizer Architektur.
[12] Aita Flury, Architekturforum Zürich (Hrsg.): Dialog der Konstrukteure, Sulgen 2010 (Zürich 2006); Aita Flury (Hrsg.): Kooperation. Zur Zusammenarbeit von Ingenieur und Architekt, Basel 2012.
[13] Astrid Staufer: Das simultane Projekt, in: Staufer & Hasler Architekten, Bd. II Methoden, Sulgen 2009, S. 14–22; Astrid Staufer, Thomas Hasler: Bauen, Forschen Lehren, in: Prix Meret Oppenheim 2015, Bern 2015, S. 16–31, bes. S. 19–20.
[14] Marc Loeliger unterrichtet am IKE der ZHAW.
[15] Hans Hofmann: Gedanken über die Architektur der Gegenwart in der Schweiz, Manuskript, publ. in: Christoph Luchsinger (Hrsg.): Hans Hofmann – Vom neuen Bauen zur neuen Baukunst, Zürich 1985, S. 236–137 (engl. in: Switzerland Planning and Building Exhibition, London/Zürich 1946, S. 19–23).
[16] Tatsächlich scheinen mir heute die frühen 1980er-Jahre, als sich die Schweizer Architektur schon einmal intensiv für diese «Neue Baukunst» interessiert hatte, näher zu liegen als das darauf folgende Fin-de-siècle.
TEC21, Fr., 2015.09.18
verknüpfte ZeitschriftenTEC21 2015|38 Analoge Architetkur II: die Praxis