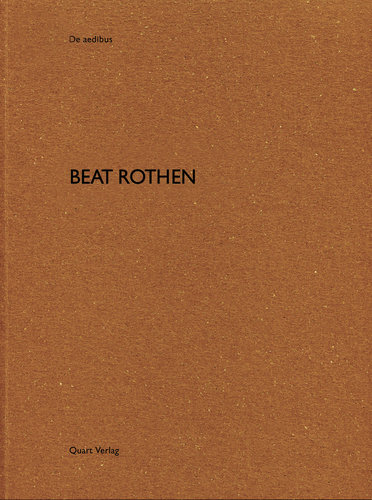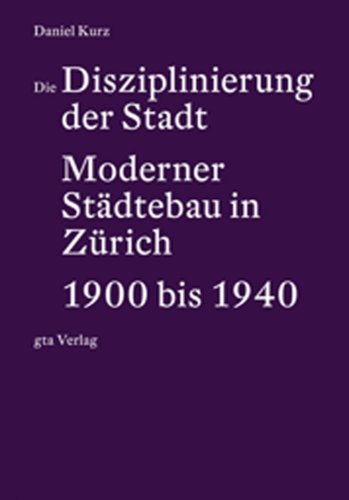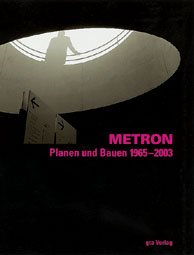Fast über Nacht wurde Zürich Affoltern, ein ruhiges Wohnquartier am Nordrand von Zürich, zu einem boomenden Entwicklungsgebiet. Innert weniger Jahre wurden hier rund 2000 neue Wohnungen gebaut, und 5000 neue B ewohnerinnen und Bewohner zogen ins Quartier. Wie wirkt sich die massive Verdichtung auf das Stadtrandquartier aus?
Fast über Nacht wurde Zürich Affoltern, ein ruhiges Wohnquartier am Nordrand von Zürich, zu einem boomenden Entwicklungsgebiet. Innert weniger Jahre wurden hier rund 2000 neue Wohnungen gebaut, und 5000 neue B ewohnerinnen und Bewohner zogen ins Quartier. Wie wirkt sich die massive Verdichtung auf das Stadtrandquartier aus?
Affoltern ist ein einfaches Quartier – wohnlich, aber ohne besonderen Glamour. 1934 wurde der finanzschwache Vorort Teil der Stadt Zürich, seine Entwicklung zum Stadtquartier begann in der Nachkriegszeit: Von 1941 bis 1961 wuchs die Bevölkerung von 4000 auf 16 000 Personen. Der gegenwärtige Wachstumsschub begann 1999 mit der neuen Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Zürich. Sie gab, nach jahrelangem Seilziehen, die beidseits der Bahnlinie gelegenen Gewerbegebiete «Ruggächer» und «In Büngerten» zur Umnutzung frei. Rund 250 000 m² Entwicklungsfläche wurden darauf neu beplant und in Windeseile überbaut: Heute sind diese Landreserven grösstenteils aufgebraucht. Die zahlreichen Ersatzneubauprojekte im Quartier verstärkten den Eindruck eines städtebaulichen Aufbruchs am Nordrand der Stadt.
In Büngerten und CeCe-Areal
Die Gewerbeareale im Gebiet «In Büngerten» südlich der Bahngleise sind heute fast vollständig zu Wohngebieten umgenutzt. Es entstanden rund 250 Wohnungen mittlerer Preislage in viergeschossigen Zeilen. Das Amt für Städtebau erarbeitete mit den Grundeigentümern ein Leitbild, das die städtebauliche Struktur der Neubauten verbindlich festlegte. Etwas weiter westlich liegt das grosse Areal der ehemaligen «CeCe Graphitwerke» mit ihren imposanten Hallenbauten. Der Unternehmer Leopold Bachmann überbaute dieses 37 000 m² grosse Areal 2007 mit 515 Wohnungen (vgl. TEC21 13/2004). Die vier langen, bis neungeschossigen Zeilen der Architekten Cerv & Wachtl bilden einen mauerartigen Riegel nach Norden zum angrenzenden Quartier «Ruggächer». Der Denkmalpflege gelang es, eine der historischen Hallen als öffentlichen Begegnungsort zu erhalten. Die entgangene Ausnutzung wurde jedoch auf die benachbarten Wohnhäuser umgelegt, die dadurch eine Dichte von 150 % erreichen. Die recht lieblose Ausgestaltung der Aussenräume trägt zu dem nüchternen Bild dieser Wohnsiedlung bei, die aber immerhin sehr preiswerten Wohnraum bietet.[1]
Ruggächer
Nördlich der Bahngleise liegt «Ruggächer», das mit 180 000 m² bedeutendste Neubaugebiet von Affoltern. Die Grundeigentümer hatten sich schon 1982 zusammengeschlossen, um eine Neuüberbauung zu ermöglichen. Die BZO 1999 wies dann den grössten Teil des Gebiets einer dreigeschossigen Wohnzone zu, und noch im gleichen Jahr lancierte das Amt für Städtebau einen städtebaulichen Wettbewerb als Grundlage für den Quartierplan, den Graber Pulver Architekten und Regula Iseli gewannen. Der Quartierplan fasste die bestehenden Grundstücke zu grossen, rechteckigen Baufeldern zusammen, die mit insgesamt sechs Stichstrassen von Norden her erschlossen werden. Entlang den Bahngleisen blieb eine Fusswegverbindung frei, die sich zu drei parkähnlichen Plätzen mit einer Gesamtfläche von rund 6900 m² erweitert. Der ursprünglich vorgesehene grosse Platz wurde zugunsten einer besseren Nutzbarkeit für die Quartierbevölkerung in drei Plätze aufgeteilt, die jeweils eine Zielgruppe ansprechen. So wurde die östliche Fläche mit zurückhaltender Ausstattung für die Quartierbevölkerung gestaltet. Der mittlere Platz wurde für Kleinkinder, der westliche speziell für Jugendliche ausgerüstet. Die Bauherrschaften sind zudem verpflichtet, ihre Baufelder durch das Quartier für Fussgänger durchlässig zu halten. Die Baufelder wurden bewusst so gross angelegt, dass sie in den meisten Fällen eine Arealüberbauung erlaubten: Diese stellt erhöhte Anforderungen an die Gestaltung und gewährt dafür eine erhebliche Mehrausnützung (vgl. Kasten). In der Mitte des Quartiers blieb ein grosses Grundstück für den Bau einer Schule reserviert. Der westlichste, an die Autobahn grenzende Spickel des Areals blieb dem Gewerbe vorbehalten und dient als Reserve für ein geplantes Logistikzentrum der Stadt.
Für die Nutzung und Gestaltung der Baufelder machte der Quartierplan keine Vorgaben, vielmehr sollte «der Spielraum auch auf den privaten Parzellen bewusst offen gehalten werden: für Entwürfe zu einem späteren Zeitpunkt, für unterschiedliche Formen des Wohnens und Arbeitens», schrieb die Stadt im Leitbild zum Quartierplan.[2] Genau diese Offenheit wurde in der Folge zur Zielscheibe der Kritik in der Fachwelt: «Eine städtebauliche Idee fehlt, das Zepter führt der Immobilienmarkt», schrieb Rahel Marti 2007 im Hochparterre.[3]
2007 wurden die ersten Siedlungen bezogen, und inzwischen sind rund 1200 Wohnungen erstellt, ausser dem Bauplatz der geplanten Schule sind nur noch kleine Restareale unbebaut. Zwei Siedlungskolosse stecken das Feld ab: im Osten, mit Anschluss an die Zehntenhausstrasse, die Wohnsiedlung der Genossenschaft ABZ (Baumschlager & Eberle, 2007) mit 278 Wohnungen und Fassaden aus vornehmem, rötlichem Klinker; im Westen die genossenschaftliche «Siedlung Klee» (Knapkiewicz & Fickert, 2010) (vgl. «Insel in der Vorstadt», S. 20) mit 350 Wohnungen und grossflächigen, aber stark gegliederten Fassaden, welche die vorgelagerten Freiflächen mühelos beherrscht. Beide Siedlungen überzeugen durch ihre hohe architektonische Qualität, und beide öffnen sich mit halböffentlichen Freiräumen zum öffentlichen Park und geben ihm so Weite und Leben. Mit Spannung wird jetzt der Bau des grossen Schulhauses Blumenfeld in der Mitte des Quartiers erwartet – den Wettbewerb gewann agps architecture Anfang 2011 mit einem breit gelagerten Flachbau, der auch eine grosse Sporthalle aufnimmt (vgl. TEC21 16/2011).
Die öffentlichen Räume wurden für das ganze Quartier von Hager Partner gestaltet, die 2004 einen gesonderten Wettbewerb gewannen. Erstellt sind die schmalen, von Baumreihen begleiteten Stichstrassen zwischen den Siedlungen und neu auch der Parkstreifen entlang der Bahnlinie. Er wirkt im Verhältnis zu den grossen Baumassen etwas dünn und wird zudem bedrängt von der hohen Lärmschutzwand entlang der Bahn. Nur an den Ausweitungen, die mit Rasenflächen und Spielplätzen unter dichten Baumhainen besetzt sind, wird der Park als Raum spürbar. Anfang 2011 wurde schliesslich auch die Mühlackerstrasse auf städtische Dimensionen erweitert und für die verlängerte Buslinie 61 ausgebaut. Baumbestandene Rasenstreifen trennen die Fusswege von der Fahrbahn. Dieser Strassenraum mutet gegenwärtig noch etwas surreal an: links die grossen Gebäudekörper, rechts auf weite Strecken Wiesen und freies Feld. Die Quartierplanung «Ruggächer» hatte diesen Strassenraum noch nicht thematisiert, doch jetzt ruft er nach einer städtebaulichen Fassung.
Das Amt für Städtebau definierte den Strassenraum, der zugleich die Begrenzung der städtischen Bebauung bildet, im Anfang 2011 publizierten «Leitbild Unteraffoltern».[4] Darin werden nördlich der Mühlackerstrasse kräftige, siebengeschossige Baukörper vorgeschlagen, die jedoch durch die Anordnung von nach Norden hin kleineren Bauten Durchblicke in die freie Landschaft und zum alten Dorfkern ermöglichen. Ausgangspunkt dafür war die mit zahlreichen Auszeichnungen bedachte Überbauung «Aspholz Nord» (pool Architekten, 2007). Das «Leitbild Unteraffoltern» regelt auch die Bebauung im Unterdorf, das bis heute seine Identität als ländliche Siedlung erhalten hat: Seine Bauernhäuser und Scheunen sind zwar vielfach umgenutzt, aber in ihrem Erscheinungsbild immer noch mehrheitlich intakt und von alten Blumen- und Obstgärten umgeben. Das überaus sorgfältig formulierte Leitbild regelt nicht nur die Gebäudetypologie, sondern schützt auch die dörflichen Strassenräume mit ihren offenen Vorplätzen und die Obstbaumpflanzungen als typische Landschaftselemente.
Das Zusammenwachsen von altem und neuem Quartier kann es aber nicht verhindern. Die Überbauung dieser letzten grossen Landreserve kann in architektonischer Hinsicht und auch im Hinblick auf die soziale Durchmischung durchaus als Erfolg gewertet werden. Die mächtigen Volumina der Arealüberbauungen geben dem neuen Quartier einen städtischen, grossen Atem. Dieser gerät nur auf einer kleinen Fläche ins Stocken, wo in Regelbauweise gebaut wurde. Dem Quartier fehlt jedoch weitgehend eine Nutzungsvielfalt – Gewerbe, Büros, Läden oder Cafés. Es fehlt zudem ein Zentrum, das eine übergreifende Identität stiften und zur Begegnung einladen würde. Dass der Grossverteiler Coop nur in einem älteren Gewerbebau ausserhalb des Quartierplangebiets die nötigen Flächen für seinen 2010 eröffneten Verbrauchermarkt fand, zeigt, dass das Thema Quartierversorgung in der Planung zu wenig Gewicht hatte. Dennoch ist diese spontane Ansiedlung ein Erfolg für die Quartierversorgung, den die mit der Dichte gestiegene Bevölkerungszahl ermöglicht hat.
Ersatzneubauten
Wie auch in anderen Stadtzürcher Quartieren geraten die Wohnsiedlungen der 1940er-Jahre in Affoltern immer mehr unter Druck. Spektakulärere Neubauten in erhöhter Dichte verdrängen Zeilenbauten und Reihenhäuschen. An der Wehntalerstrasse setzt die expressiv farbige neue Wohnsiedlung der Baugenossenschaft Frohheim (EM2N / Müller Sigrist, 2010/2012) einen starken Akzent. Hinter einem schützenden Riegel entlang der Strasse erheben sich voluminöse Punkthäuser mit übereck gelegenen Wohnungen, deren ausladende Balkone sich überschneiden. Der private Aussenraum der Balkone ersetzt hier die privaten Siedlungsgärten. Für den Entscheid, die qualitätvolle alte Siedlung abzureissen, war nicht zuletzt die lärmige Lage an der Wehntalerstrasse ausschlaggebend. Gleiches gilt für das Neubauprojekt der Genossenschaft Waidmatt, die weiter stadtauswärts an der Wehntalerstrasse 35 Einfamilienhäuser durch 103 neue Wohnungen ersetzen will: Die Kammstruktur sperrt den Strassenlärm aus und orientiert die Wohnungen zur ruhigen Südseite. Weitere Ersatzneubauten eröffneten 2011 die Genossenschaft Baufreunde und die Werner-Spross-Stiftung. Dass in einzelnen der neuen Siedlungen 3.5-Zimmer-Wohnungen mit 110 m² (Baufreunde) und Vierzimmerwohnungen für fast 3000 Franken Miete (Waidmatt) entstehen, lässt an der sozialen Orientierung mancher Projekte zweifeln. Pia Meier von der «Kerngruppe Affoltern» macht sich über diese Entwicklung Sorgen und drängt auf eine behutsamere Etappierung: «Natürlich braucht es eine gewisse Erneuerung – aber die Mietzinse steigen mit jedem Neubau. Wo sollen die alten Mieter hinziehen? Wer vorher 800 Franken für eine Dreizimmerwohnung bezahlte, kann sich doch die neuen Mieten von 2000 bis 3000 Franken meist nicht leisten.»
Verkehrsprobleme
Nur teilweise gelöst sind die Verkehrsprobleme des Quartiers: Als grosser Erfolg wird die geplante Teilüberdeckung des ausgebauten Nordrings gefeiert. Man rechnet jedoch auch mit Mehrverkehr. Schon die Eröffnung der Westumfahrung von Zürich 2009 brachte der Wehntalerstrasse um 10 % mehr Verkehr. Die Wohnhäuser und Siedlungen entlang dieses Strassenzugs sind in unzulässig hohem Mass von Immissionen belastet, und die breite Durchgangsstrasse bildet eine schwer überquerbare Barriere im Quartier. Eine bewohnerfreundlichere Umgestaltung ist zwar angedacht, liegt aber noch in weiter Ferne.
Auch die 5000 neuen Quartierbewohnerinnen und -bewohner tragen zur erhöhten Verkehrsbelastung bei. Busse und S-Bahn-Züge sind in den Stosszeiten überfüllt. Die öffentlichen Ver-kehrsbetriebe reagierten relativ schnell darauf: Erleichterung schafft die neue Buslinie 61, die das Ruggächerquartier erschliesst, und die S-Bahn-Linie 6 wird ab 2013 alle 15 Minuten verkehren. Die im kantonalen Richtplan verankerte Idee einer Tramlinie nach Affoltern könnte zweischneidige Folgen haben: Die höheren Geschwindigkeiten, die auf neuen Tramstrecken gefahren werden, führen – wie das Tram Schwamendingen, die Glattalbahn und die neue Tramlinie in Zürich West zeigen – zu abgesperrten Gleiskörpern in überbreiten Verkehrskorridoren, die nur wenige Fussgängerquerungen zulassen.
Neue Freiräume am Stadtrand?
Mit den neuen Überbauungen hat sich der Siedlungsschwerpunkt von Affoltern stadtauswärts verschoben: Die höchsten baulichen Dichten finden sich jetzt am äussersten Siedlungsrand unmittelbar an der S-Bahn-Station. Die Stadt findet dadurch eine scharfe, fast wuchtige Begrenzung am Übergang zum weiten Landschaftsraum, der mit der Überdeckung der Autobahn rehabilitiert werden wird. Im Auftrag von Grün Stadt Zürich und vom Amt für Städtebau formulierten Patrick Gmür und Christophe Girot 2004 für diese Landschaft das Konzept «Nordküste»[5].
Anmerkungen:
[01] Hansjörg Gadient: Ausblick in Zürich. TEC21 3-4/2008, S. 28–34
[02] Stadt Zürich, Amt für Städtebau: Quartierplan Ruggächern, Zürich Affoltern, Leitbild zum Quartierplan. August 2000
[03] Rahel Marti: Der Turmbau zu Affoltern. Hochparterre 10/2007, S. 4; vgl. ebenso Steffen Hägele: Das Glücksblatt in der Magerwiese. archithese 3/2011, S. 58–63
[04] Stadt Zürich, Amt für Städtebau: Unteraffoltern – Entwicklungsleitbild. Januar 2011
[05] www.girot.ch/en/project_docs/nordkuste_portfolio.pdf
TEC21, Fr., 2011.10.28
verknüpfte ZeitschriftenTEC21 2011|44 Zürcher Nordküste
![]()