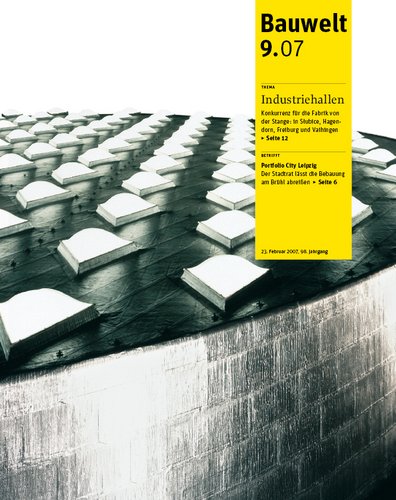Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Wohnort: München. Zukunft findet Stadt | Jochen Paul
03 Spectacular City in Düsseldorf | Jan Friedrich
03 Bogevischs Buero in Berlin | Urte Schmidt
04 Neue Monte Rosa Hütte | Andrea Gleiniger
BETRIFFT
06 Zu wenig Gebote | Uta und Robert Winterhager
WETTBEWERBE
12 La Tour Phare in La Défense | Boris Maninger
15 Groninger Forum | Friederike Meyer
15 Entscheidungen
16 Auslobungen
THEMA
18 Struktur oder Stuck? | Nils Ballhausen
28 Ceauscescu-Elektro House vs. Haute Couture | Wilhelm Klauser
REZENSIONEN
37 Erfolgsfaktor Architektur. Strategisches Bauen für Unternehmen | Christian Brensing
37 Europäischer Kirchenbau 1900–1950 | Thomas Werner
RUBRIKEN
05 Leserbriefe
05 wer wo was wann
36 Kalender
38 Anzeigen
Bauwelt 9.07 „Fabrik“ erscheint am 23. Februar