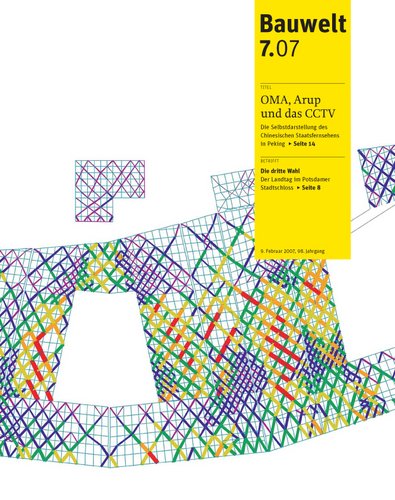Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Wieder bleiben die Pläne zur Bebauung des Hamburger Domplatzes folgenlos | Olaf Bartels
03 Kindertagesstätte Taka-Tuka-Land in Berlin | Brigitte Schultz
03 Schutz für das Schindler House vor dem aufdringlichen Nachbarn | Oliver Hell
04 Durchscheinende Dinge. Regina Poly | Jan Friedrich
04 Bilder aus dem ersten Jahrhundert der Fotografie | Anne Boissel
BETRIFFT
08 Die dritte Wahl | Sebastian Redecke
WETTBEWERBE
10 Kindertageseinrichtungen in Systembauweise, München | Jochen Paul
12 The Sky Space auf dem Dach des ARoS Art Museum in Århus | Friederike Meyer
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Metropolitan Architecture? | Sebastian Redecke
16 China Central Television | Christian Brensing
24 Eine Form von neuer Utopie | Ole Scheeren
28 Die Röhre als Tragwerk | Rory McGowan
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
06 Leserbriefe
34 Kalender
35 Anzeigen